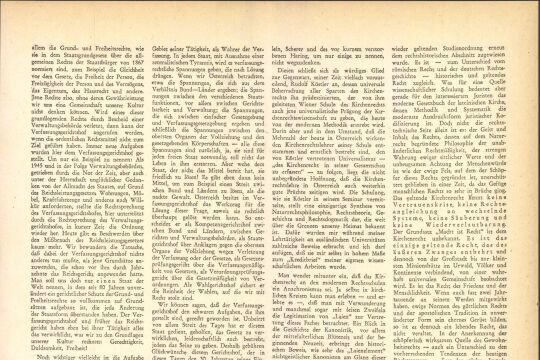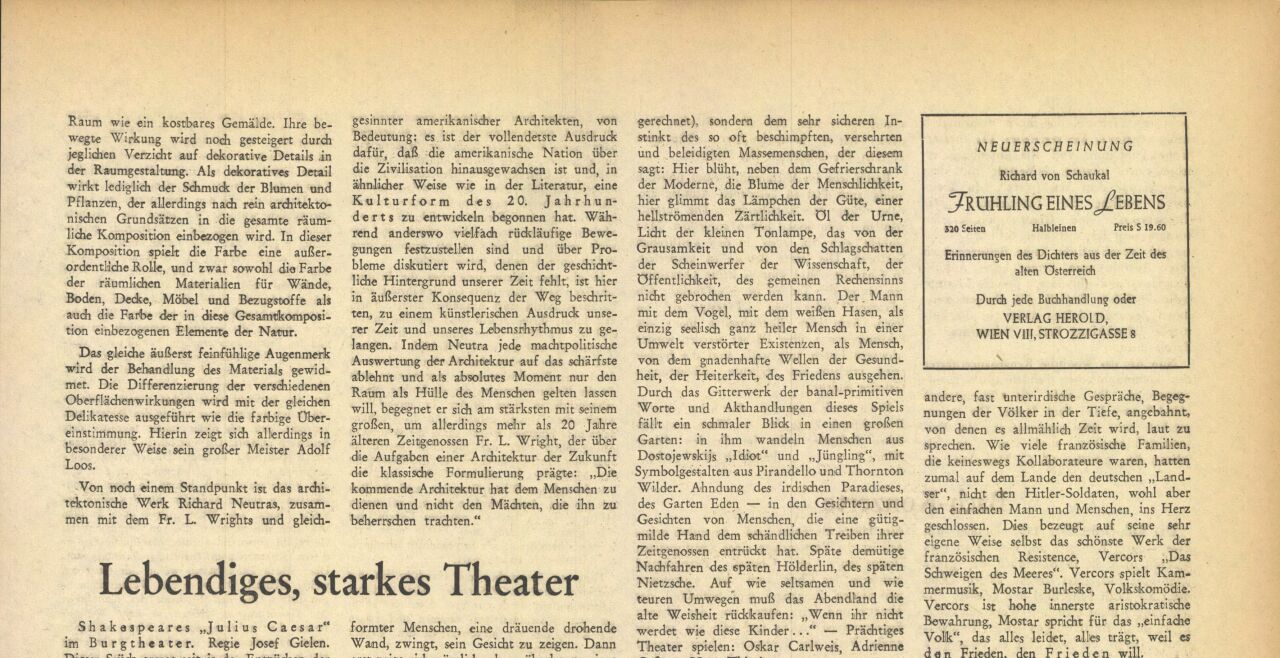
Shakespeares „Julius Caesar“ im Burgtheater. Regie Josef Gielen. Dieses Stück erregt seit je das Entzücken der Schau-Spieler und sehr gemischte Gefühle bei den Freunden hoher Dichtung, hoher Kunst. Der Autor ist auf seine Weise und in seinem Fach ein mindestens ebenso gewalttätiger Herr wie sein Titelheld. Er kennt keine Rücksichten — der Dramaturgie, eines inneren einheitlichen Bauplans, logischer Konsequenz, psychologisch sauberer Motivierungen. Ist Caesar, ist Brutus der Held des Stückes? Oder vielleicht gar jener Falschmünzer und Geck Marc Anton, der, vielleicht sehr edel, wohl aber auch sehr berechnend, sein hochpolitisch-intrigantes Spiel treibt? Nein, nachrechnen darf man den Gestalten dieses Werkes nicht. Ganz fest gebaut erscheint nur jener Oktavian, der so „uninteressant“ und so nüchtern ist, daß er die großen und kleinen Gaukler dieser Weltbühne sicher zu überspielen vermag und Caesars Erbe wird. So unsicher die innere Tektonik, so sicher gebaut sind einzelne Szenen dieses zwielichtigen Stückes. Neben dem Distelwerk voll leertosendem Geräusch und effekthaschendem Theaterdonner blühen Traumgewächse, so in der Szenerie um Portia, die zur edelsten und reinsten Gabe Shakespearescher Poesie gehören.
Ein Stück also voll Versuchungen — für die Schauspieler und für den Regisseur. Offenkundig, daß beide diesen Versuchungen weithin erlegen sind. Dieser Burg-Caesar ist eine Oper geworden, deren Aufmachung bedenklich an die Theatralik des Passo Romano, an die Atmosphäre jenes Caesaren erinnert, dessen zerschundener Leib einer rasenden Plebs auf der Piazza del Duomo in Mailand zur Veneration des Hasses preisgegeben wurde. Der Stern dieser Aufführung ist deshalb mit Recht der Marc Anton Skodas, eine Personifikation des Komödiantischen. Neben ihm vergilbt der Brutus Baisers zum Schulgesicht „römischer Tugend“. Aslans Caesar ist so fern dem wesenlosen Getriebe dieser Verschwörerclique, daß wirklich nur die peinliche Befragung — die Spitze ihrer Dolche — ihn zu „treffen“ vermag. Auch diese Spitze aber trifft nur den Leib, den schweren, müden Leib, der über dieser Komödie der Machthungrigen zusam- menibricht und sie alle wie ein Kartenhaus zerschlägt. Nach ihm bleibt nur mehr Theater. Theater des „Volkes“: dieses armen Burgtheatervolkes! Es ist die ganze Verachtung des aristokratischen England der Shakespeare-Zeit, jener hohen edlen Herren, die sich Truppen von Schauspielern hielten, es ist die Verachtung der Diktatoren des Nihilismus der Gegenwart und es ist die Routine des Burgtheaterspiels, die dieses Volk schuf. Zuletzt sahen wir diese armen Hanswurste im „Egmont“. Durchaus misera plebs, massa damn ata, menu peuple, zu deutsch: ein elend-heilloser Haufen, ohne Rückgrat, halt- und gesinnungslos, Possenreißer, narrentümelnde Hanswurste, Clowns der Gasse und Gosse. Eine dankenwerte Aufgabe, dieses „Volk“ unserer Burg zu reformieren! Der Widerstand, der mannhafte Widerstand dieses erneuerten Volkskörpers — nicht mehr pure Statisterie und papierbunte Girlande zum Hahnenschrei der Hauptrolienbesitzer — müßte sich auf die Dauer überaus günstig für deren innere Verdichtung und Substanzbildung auswirken. Ein „Held“ verliert die Maske und die Mätzchen, wenn ihm der Wider-Stand geformter Menschen, eine dräuende drohende Wand, zwingt, sein Gesicht zu zeigen. Dann erst zeigt sich nämlich, ob er überhaupt eines besitzt. Auf die Burgbühne übertragen heißt dies: Der Regisseur muß sich bemühen, es seinen Hauptkräften nicht leicht, sondern möglichst schwer zu machen. Und eines der wertvollsten Mittel diese zu voller Entfaltung und Ausschöpfung ihrer inneren Möglichkeiten und Potenzen zu zwingen, wäre eben: ein starkes Volk, ein „neues Volk“ der Burg! Das Zwielicht, in das dieser neue „Caesar“ getaucht ist, wird untermalt durch Nehers Bühnenbild. Halb Photomontage, grau in grau, des „alten Roms“, naturalisti- stische Historienmalerei, halb neuromantisches Stimmungsbild, so zumal der an Altdorfers Alexanderschlacht anspielende Deckhimmel der Schlacht bei Philippi. — Die Bilanz dieser Aufführung: Unter geschickter Auswertung eingeborener Anlagen, die altes Erbgut des Burgtheaterdekors sind, wurde hier eine Grenze erreicht, die in Hinkunft nicht überschritten, ja nicht einmal mehr berührt “werden sollte. Die Burg als Sprechoper, ihre ersten Schauspieler als koloratursingende Primadonnen. Die Zukunft sollte der verpflichteten und verpflichtenden Sprache, dem lebendigen, bezeugenden Geist und dem geprägten und prägenden Charakter gehören.
Ein zauberhaftes Spiel in der „Insel“: „Harvey“ von Mary Chase. Dieses von Alfred Polgar übersetzte Stück einer vorher völlig unbekannten Autorin hat in den letzten beiden Jahren einen Sensationserfolg in Amerika errungen. Es wird ihn wohl auch bei uns erringen. Auf den ersten Blick: ein Lustspiel für das breite Publikum. — Amerikanisches Kleinstadtleben. Geschwätz, Berechnung, die geschäftige Betriebsamkeit durchschnittskluger glatter Menschen. Da ist Missis Simmons, die ihre Tochter Myrtle Mae verheiraten will. Ihr gutbürgerlicher Haushalt wird gestört durch das Unwesen ihres Bruders E. P. Dowd. Dieser Junggeselle in den besten Jahren hat, wie wir Sagen würden, einen Vogel, das heißt im Stück: einen Hasen, einen 1,80 m großen weißen Hasen, der in seiner Einbildung lebt; sein guter Geist sozusagen. Dieser würde vielleicht nicht stören, wenn Dowd nicht darauf bestehen würde, Harvey in allen Gesellschaften vorzustellen, mit ihm Kino, Bar und Cocktail-Parties zu besuchen. Um sich den Störenfried — Harvey — vom Hals zu schaffen, versucht Mss. Simmons, ihren Bruder in einer psychiatrischen Klinik internieren, zumindest durch Injektionen normalisieren zu lassen. Mit dem Eintreffen aller Beteiligten in dieser Klinik beginnt der Knoten der Verwicklungen sich zu schürzen, er entfaltet sich in eben dem Moment, in dem die um Harveys Freund strebsam sorgenden Akteure einsehen, daß E. P. Dowd, der Mann mit dem weißen Hasen, feinsinniger, edelmütiger, menschlicher und lebenstiefer ist als sie alle zusammen — und all das mit, nicht ohne „Hase“! Ein Stück, das beschwipst und humorig gespielt und aufgefaßt werden kann, so ist es zum Teil in Amerika geschehen. Seinen Erfolg verdankt es aber nicht einfach nur diesem leichtmoussierenden Duft, nicht der Verulkung des amerikanischen psychiatrischen und psychoanalytischen Betriebs (die USA zählen immerhin 580.000 Irrsinnige, die dem Gemeinwesen pro Tag 1.50 Dollar kosten, die Millionen seelisch nicht ganz Normaler ungerechnet), sondern dem sehr sicheren Instinkt des so oft beschimpften, Versehrten und beleidigten Massemenschen, der diesem sagt: Hier blüht, neben dem Gefrierschrank der Moderne, die Blume der Menschlichkeit, hier glimmt das Lämpchen der Güte, einer hellströmenden Zärtlichkeit, öl der Urne, Licht der kleinen Tonlampe, das von der Grausamkeit und von den Schlagschatten der Scheinwerfer der ‘Wissenschaft, der Öffentlichkeit, des gemeinen Rechensinns nicht gebrochen werden kann. Der Mann mit dem Vogel, mit dem weißen Hasen, als einzig seelisch ganz heiler Mensch in einer Umwelt verstörter Existenzen, als Mensch, von dem gnadenhafte Wellen der Gesundheit, der Heiterkeit, des Friedens ausgehen. Durch das Gitterwerk der banal-primitiven Worte und Akthandlungen dieses Spiels fällt ein schmaler Blick in einen großen Garten: in ihm wandeln Menschen aus Dostojewskijs „Idiot“ und „Jüngling“, mit Symbolgestalten -aus Pirandello und Thornton Wilder. Ahndung des irdischen Paradieses, des Garten Eden — in den Gesichtem und Gesichten von Menschen, die eine gütig- milde Hand dem schändlichen Treiben ihrer Zeitgenossen entrückt hat. Späte demütige Nachfahren des späten Hölderlin, des späten Nietzsche. Auf wie seltsamen und wie teuren Umwegen muß das Abendland die alte Weisheit rückkaufen: „Wenn ihr nicht werdet wie diese Kinder …“ — Prächtiges Theater spielen: Oskar Carlweis, Adrienne
Geßiner, Hans Thimig.
Das „Theater der Courage“ bringt ein Zeitstück des gegenwärtig in Deutschland vielgespielten Hermann Mostą r. „Bis der Schnee schmilzt… (U n d Gottschuf die Besatzun g)“: Satire, Scherz, Ironie und der gute Wille, gute Miene zu einem oft argen Spiel zu machen, zeichnen diese Komödie, in der eine Episode der Jahreswende 1814—15 als Vor- und Widerspiel deutscher Gegenwartszustände aufgefaßt wird. Eine Art Dolmetschertrupp der „Heiligen Allianz“, ein Preuße, ein Russe, ein Engländer und ein Österreicher unter Führung eines französischen Emigrantenoberst, wird auf dem Weg nach Paris eingeschneit und spielt nun in einem abgelegenen Landhaus Besatzung. Was Anlaß zu vielen Anzüglichkeiten gibt. Mostar versteht es, jeder Nation einige bittere und einige frohgesichtige Wahrheiten zu sagen, wobei wir Österreicher über Erwarten gut weg kommen. (Der Berliner Autor hat jahrelang in Österreich gelebt, er scheint sich hier wohl gefühlt zu haben.) Die Quintessenz des Stückes ist eine These, die zum Nachdenken herausfordert und die einen bitterstarken Kern Wahrheit enthält: die Völker, die Menschen haben sich heute dermaßen weit auseinandergelebt, daß vielleicht nur mehr der Druck fremder Besatzungen sie zueinander zu führen vermag. Dieser sicherlich anfechtbare Gedanke kann auf eine Tatsache verweisen, die alles Haßgeschrei und alle tendenziösen Meldungen, Veranstaltungen und leider auch Fakten der letzten zehn Jahre auf die Dauer nicht zu übertönen vermögen:, neben den sehr förmlichen, sehr kalten und oft sehr feindseligen Gesprächen der Völker haben sich in diesen Jahren auchandere, fast unterirdische Gespräche, Begegnungen der Völker in der Tiefe, angebahnt, von denen es allmählich Zeit wird, laut zu sprechen. Wie viele französische Familien, die keineswegs Kollaborateure waren, hatten zumal auf dem Lande den deutschen „Landser“, nicht den Hitler-Soldaten, wohl aber den einfachen Mann und Menschen, ins Herz geschlossen. Dies bezeugt auf seine sehr eigene Weise selbst das schönste Werk der französischen Resistence, Vercors „Das Schweigen des Meeres“. Vercors spielt Kammermusik, Mostar Burleske, Volkskomödie. Vercors ist hohe innerste aristokratische Bewahrung, Mostar spricht für das „einfache Volk“, das alles leidet, alles trägt, weil es d a n Frieden, den Frieden will.
„Der Wald“ ist ein Meisterwerk de9 großen russischen Dramatikers A. N. Ostrowski. Eine seiner besten Komödien. „Komödie“? Man erschauert, man wagt es kaum, dem Stück diesen Namen zu geben. Gewiß, Lichter fehlen nicht — es sind aber nur helle, bunte Flecken, Sonnenflimmer, die das dunkle, düstere Dickicht dieses Urwaldes nicht wirklich aufbrechen, geschweige denn erhellen können. Ostrowski meißelt mit harten hämmernden Schlägen, verbissen, in Wut und unbändigem Gelächter, das Standbild spätfeudaler grundherrlicher Gesellschaft im Rußland von 1850. Dummheit und Stolz, Geldgier und humanitäre Phrasen, Lüsternheit und Prüderie. Grausamkeit und Dünkel dieser Sphäre verkörpert in erschreckender Dichte und Plastizität Raissa Pawlowna Gurmy6chskaja, die Gutsherrin, die Herrin des Waldes (Dorothea Neff). Um sie ein Wespennest von kriechendem Gesinde, schmeichelnden Schlemmern, Intriganten und Spekulanten: das Unterholz dieses Waldes. Da wird für einen Augenblick eine Lichtung geschaffen. Zwei landfahrende Schauspieler, arme Teufel, spielen dieser dekadenten Gesellschaft freie, strömende, herzhaft-warme Menschlichkeit vor. Ostrowski, der als Direktor de9 Kaiserlichen Theaters in Moskau starb, zuvor aber in mannigfachen Fährnissen die weite Welt und Schichtung der russischen Gesellschaft kennenlernte, hat seine Sehnsucht nach einem „neuen Menschen“ immer wieder zwei Ständen übertragen: den Schauspielern und der Jugend. — Die Aufführung des Volkstheaters ist sehenswert, die Ansetzung des Stückes an sich muß als ein wirkliches Verdienst gebucht werden.