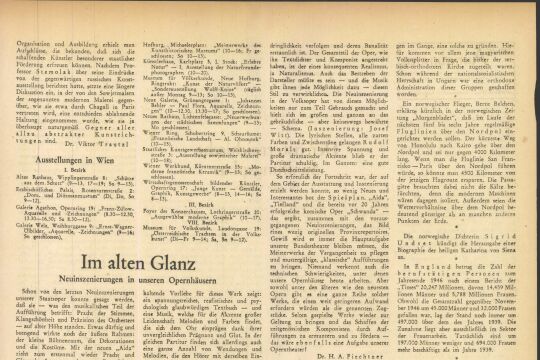Nach den positiven Erfahrungen, die man mit der szenischen Darbietung von „Moses und Aron“ machte, lag der Versuch nahe, auch die drei frühen Einakter Schönbergs auf die Bühne zu stellen. „Erwartung“, „Die glückliche Hand“ und „Von heute auf morgen“ wurden erstmals gemeinsam 1963 im Landestheater Hannover gegeben, im vergangenen Frühjahr folgte Florenz (im Rahmen des Maggio musicale) — und nun die Intendanz der Wiener Festwochen, die die drei Einakter an einem denkwürdigen Abend als Eigenproduktion zeigte.
„Erwartung“, auf eine „Dichtung“ der Dilettantin Ilse Pappenheim geschrieben, wurde innerhalb von 17 Tagen im Spätsommer 1909 komponiert. Der literarisch primitive Text vermittelt aber jene Stimmung und Spannung, die Schönberg (damals wie früher und später) suchte. Das Sujet dieses Monodramas: Eine Frau wartet im nächtlichen Wald auf ihren Geliebten und findet ihn als Toten. Das große Orchester ist auf nie gehörte Weise behandelt: kammermusikalisch an vielen Stellen, farbig und immer ausdrucksvoll, die melodischen Linien bis zum Reißen gespannt. Der Singstimme wird Enormes abverlangt. Helga Pilarczyk meisterte die 30-Minuten-Rolle darstellerisch und stimmlich großartig.
Kurz darnach, 1910 bis 1913, entstand das Drama mit Musik „Die glückliche Hand“, von Schönberg selbst gedichtet und als Gesamtkunstwerk konzipiert, mit genauesten Regieanweisungen, vor allem das Licht betreffend, woran man sich im Theater an der Wien überhaupt nicht hielt. Die „Handlung“ ist eigentlich ein innerer Monolog des Mannes über das Thema „Immer glaubst du dem Traum, immer wieder hingst du die Sehnsucht ans Unerfüllbare“. Dieser Traum ist „ein Weib“, das sich dem Helden verführerisch naht und von „einem Herrn“, einem Mächtigeren, Reicheren, entführt wird. — Nur der Mann singt beziehungsweise spricht. Seine Gegenspieler sind stumm. Dafür gibt es einen „Chor“, bestehend aus sechs Frauen und sechs Männern, links und rechts erhöht postiert. Dazu das Licht-Spiel...
Die „Oper in einem Akt“ mit dem Titel „Von heute auf morgen“ ist ein Spiel zwischen vier Personen in bürgerlichstem Milieu: Mann, Frau, die vom Mann angeschwärmte mondäne Freundin der Frau und ein von der Ehefrau angehimmelter Sänger. Der Versuch Schönbergs, diese banale Handlung In seine Tonsprache von 1928 (die streng dodeka-phonische) einzukleiden, war natürlich zum Scheitern verurteilt, ist aber fast rührend. Der Erfolg von „Jonny spielt auf“, „Neues vom Tage“ und der „Dreigroschenoper“ mag ihn zu diesem Experiment veranlaßt haben. So leicht und durchsichtig die Partitur ist — man wird an dem ganzen nicht froh, und wer der Textautor „Max Blonda“ ist, werden wir wohl nie erfahren... Werner Kelch als jtegisseijUT und Heinz Ludwig als Bühnenbildner entschieden sich für einen Einheitsrahmen: einen von dicken Balken kreuz und quer durchzogenen Raum. Diese Balken stellten in „Erwartung“ Baumstämme, beziehungsweise einen Wald dar; sie wurden im zweiten Stück verschiedenfarbig angeleuchtet und schufen die Illusion einer Alberichschen Höhle; im dritten Stück waren sie bunt bemalt und deuteten das bürgerliche Interieur an. — Willy Ferenz, der einsame „Mann“, hatte als Partnerin die bildschöne Eva Maria Tettinek. In der Komödie sangen Toni Blankenheim, Melitta Muszely, Maurice Besangon und Ruthilde Boesch bemerkenswert flott und sicher ihre schwierigen Partien. Die Meisterschaft der Wiener Symphoniker und des Dirigenten Friedrich Cerha bei der Interpretation kompliziertester Partituren bewährte sich glänzend und aufs Neue.
Von 1920 bis 1927 hat Sergei Prokofieff, mit Unterbrechungen, an einer großen Oper gearbeitet, die kein Opernhaus spielen wollte. (Erst im September 1955, nach des Komponisten Tod, fand in Venedig die Uraufführung statt.) Dem selbstverfaßten Libretto liegt der historische Roman „Der feurige Engel“ des russischen symbolistischen Dichters Valerij Jakowlewitsch Brjussoff zugrunde. Dieser schildert die merkwürdige, mysüsch-tragdsche Geschichte eines jungen Mädchens (angeblich nach tatsächlichen Begebenheiten), der als Kind ein feuriger Engel erschienen ist, der ihr das Martyrium voraussagt, in den sie sich verliebt, von dem sie später glaubt, daß er sich ihr in der Gestalt eines Grafen Heinrich entzieht, und den sie mit Hilfe des Ritters Ruprecht, der sie liebt, suchen will. Das Ende: Renata wird der schwarzen Magie bezichtigt und, nachdem sie die Insassen eines Nonnenklosters mit ihrer Hysterie angesteckt hat, von einem Inquisitionstribunal zum Scheiterhaufen verurteilt. Die Handlung spielt an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert, und es sind historische Gestalten wie Agrippa von Nettesheim und Doktor Faustus eingeblendet.
Die Partitur des „Feurigen Engels“ ist ohne Zweifel Prokofieffs anspruchsvollste und zeigt eine ungewöhnlich reichhaltige Palette der verschiedensten Ausdrucksmittel. Harte Dissonanzen und geballte Bläserladungen, gläserne Klänge, das ganze Orchester erfassende jagende Triolen, barbarische Rhythmen und prestissimo geflüsterte Chorstimmen — es ist alles da, wie bei einer magischen Beschwörung. Nur das Eigentliche, das Atmosphärische und Emotionelle aus erster Hand fehlt dieser merkwürdigen Musik fast ganz. Prokofieff, der kraftvolle, aber immer ein wenig oberflächliche Erfinder, dessen Tonsprache das Athletische, das Motorische und Bizarre auf so frappante Weise wiedergibt,. hat hier etwas gegen seine Natur versucht — und es ist ihm letzten Endes mißglückt.
Zwar holte die Inszenierung durch die Vereinigten Bühnen Graz, deren Gastspiel in der Wiener Volksoper wir diese interessante Bekanntschaft zu danken haben, sicher nicht das letzte aus dem Werk heraus. Aber auch von anderwärts — von Köln 1960 und aus Prag 1963, wo man den „Feurigen Engel“ spielte — sind kritische Stimmen lautge-worden. Der orchestrale Teil der Aufführung mit dem Grazer Opernorchester unter Berislav Klobucar war einwandfrei. Auch mit dem Bühnenbild Wolfram Skalickis, das mit Eisenplastiken in der Art Leinfellners ausgestattet war, kann man sich einverstanden erklären. Weniger mit der
Führung der Hauptakteure, und am wenigsten mit ihrer Besetzung. Denn diese Renata muß nicht nur gut, sondern faszinierend gesungen und gespielt werden...
*
Dsr Festwochenbeitrag des österreichischen Fernsehens war die Produktion und Sendung der Oper „Elga“ von Rudolf Weisshappel nach dem gleichnamigen Stück von Gerhart Hauptmann — das seinerseits auf Grillparzers Novelle „Das Kloster bei Sendomir“ fußt. Die Geschichte von dem Grafen Starschenski und dessen sinnlich-leichtfertiger Frau, die ihren Mann mit ihrem Vetter und Jugendfreund Oginsky betrügt, ist ein echter Opemstofl — und er wurde wohl nicht zum erstenmal vertont. Hauptmann läßt in seinem „Nocturnus in sechs Bildern“ die Rahmenhandlung weg. Der aus Graz stammende Komponist Weisshappel, gegenwärtig als Musik- und Filmkritiker an einer Wiener Zeitung tätig, greift gemeinsam mit seinen Mitarbeitern, dem Regisseur Helrriuth Matiasek und dem Dirigenten Ernst Märzendorfer, wieder auf sie zurück, was verschiedene dramaturgische Vorteile und Möglichkeiten bietet.
Weisshappel ist ein kenntnisreicher Musiker, der, keinem System verschworen, sich von dem dramatisch-düsteren Stoff packen ließ und der seine Akteure so singen läßt, wie eben Sängern der Schnabel gewachsen ist. Was wir bei dieser Fernsehsendung erlebten, war eine richtige Belcanto-Oper, die auch im Bildlich-Szenischen als bestens gelungen bezeichnet werden kann. Die einjährige Arbeit und die hohen Kosten (eineinhalb Millionen Schilling) haben sich also gelohnt, und der Produktionsleiter für Opern im österreichischen Fernsehen, Professor Scheib, bestätigt, daß unter seiner Führung selten eine so gute Teamarbeit geleistet werden konnte wie mit dem Regisseur Matiasek, dem Komponisten, dem mit diesem befreundeten Dirigenten, dem Bühnenbildner Robert Posik, der Kostümzeichnerin Annemarie Köhler und natürlich mit den Sänger-Schauspielern, die man von überallher engagiert hatte: die bildschöne und stimmlich wohlgeschulte Gabriele Schubert (Elga) von der Komischen Oper Berlin, den prächtigen bulgarischen Heldenbariton Stefan Dischliew (Starschensky) aus Leipzig, den gebürtigen Amerikaner William Blankenship (Oginsky), ferner Ira Malaniuk, Lia Montoya, Hilde Konetzni, Paul Schöffler u. a.
;i y;;<V;'^*; ■ **(r r1',: ■ ■:•-. i '■“ '. “T'*.,~
Nach dem Gastspiel der Moskauer hatte das Wiener Staatsopernballett mit seinem Premierenabend am letzten Tag der Wiener Festwochen einen schweren Stand. Mit den virtuosen Tanzkünsten des „Bolschoi-Ballett“ können nur einige wenige unserer Spitzentänzer konkurrieren. Aber die Stärke des Choreographen und Baliettdirektors Aurel vok' Milloss liegt auf anderem Gebiet: Er erfand, zu wertvoller, und interessanter Musik, interessante, geistvolle und bedeutende Choreographien, er hatte in Günther Schneider-Siemssen einen erstklassigen, modernen Bühnenbildner und in Ronny Reiter eine einfallsreiche, originelle und elegante Kostümzeichnerin. Und er hat aus dem Wiener Corps de Ballet ein einheitliches und zugleich vielfältiges Ensemble geformt, das sich sehen lassen kann. Gleich die einleitende „TanzhymnP“ nach J. S. Bachs Orgelpassacaglia c-Moll war ein Exempel hochmusikalischer und erfindungsreicher Choreographie. Wieviel Arbeit in dieser Schöpfung Aurel von Milloss' steckt, ist kaum abzuschätzen. Schade, daß ihr die unschönen und farbengrellen Kostüme nicht adäquat waren.
Hierauf folgte das formal interessanteste, inhaltlich erregendste Stück des Programms „Die Einöde“ auf Edgar Vareses „Deserts“, ein 30 Minuten dauernder Bläsersatz, in
den dreimal elektronische Klänge eingeblendet werden. Diese choreographische Allegorie suggeriert nicht nur die physische Einöde, wie Wüstensand, Meer, weite Schneefelder, Großstadttreiben, Weltraum, sondern auch die Einsamkeit und innere Öde des Menschen von heute. Die rasch wechselnden Hintergrundbüder Schneider-Siemssens, der als Mitschöpfer dieses bedeutenden Werkes bezeichnet werden muß, waren von suggestiver Wirkung: Von einem nachtschwarzen Himmel herunterhängende Metallkreuze, riesige Uhren, endlose Straßen und tiefe Straßenschluchten, Hochöfen, ein Atompilz, bunte Verkehrszeichen u. a. Die Handlung: eine Folge expressionistischer Szenen, im Mittelpunkt: „Der Mensch“ und „Die Mutter“, neben ihnen, nicht weniger eindrucksvoll: „Der Fremde“, „Die Sirene“, und um sie herum die Gruppen der Lüsternen, der Spekulanten und der Lasterhaften.
Als zweite Uraufführung — nach Deserts — zeigtt A. von Miloss im 2. Teil „Les Jambes savantes“ nach Stra-winskys Violinkonzert in D, witzig und heiter-bunt ausgestattet. Vor einem Hintergrund, der Zirkus und Manege gewissermaßen „übereinanderkopiert“, bewegten sich eine Fülle komisch-kapriziöser Gestalten, deren bizarre Gesten der Musik Strawinskys völlig entsprachen. Als Einlage: ein Tanzwalzer von Busoni (vielleicht entbehrlich in diesem Rahmen). Als wirkungsvoll-glänzender Abschluß: Ravels „Bolero“: ein systematisch gesteigerter Rausch von Farben und Bewegung, mit jenen dämonischen Zügen ausgestattet, die auch der Musik Ravels zu eigen sind.
Die Solotänzerin des „Bolero“, der eine wahre Tour de force von 20 Minuten Dauer abverlangt wird, war die glänzende Christi Zimmerl. (Bei der zweiten Besetzung tanzte diese anspruchsvolle Partie Erika Zlocha.) In „Deserts“- zeichneten sich Willy Dlrtl und Lucia Bräuer aus. Mit ihren „jambes' savantes“, die Strawinskys Sprache ebenso fließend wie pointiert' zu sprechen verstehen, *fe-“ zauberten Ully Wührer, Susanne Kirnbauer, Irmtraut Haider und Karl Musil (am 2. Abend abgelöst von Michael Birkmeyer). — Viele wären noch zu nennen und ihnen jene Anerkennung zu zollen, welche die Arbeit des Balletts an der Wiener Staatsoper immer noch nicht erfährt. Denn der Premierentermin am letzten Tag der Festwochen war denkbar lieblos angesetzt, und die Wiederholung fiel bereits in die Hundstage...
Unmittelbar nach dem Abschluß der Wiener Festwochen gab es im Theater an der Wien noch eine Opernpremiere, die wir der Slovakischen Oper Bratiislava zu verdanken haben, welche mit eigenem Chor und Orchester, insgesamt 240 Mann, sowie mit den eigenen Dekorationen zu einem Gesamtgastspiel nach Wien gekommen war, um uns hier Jan Cikkers „Auferstehung“ vorzuführen. Der 54jährige Komponist, der bereits vier Opern geschrieben hat, ist der angesehenste Musikdramatiker seiner Heimat, und man versteht, daß er hochgeschätzt wird. Denn er ist ein echter Dramatiker, der eine sehr moderne Tonsprache redet. Reine Dreiklänge kommen in der Partitur kaum vor, aber auch der Zwölftontechnik bedient er sich kaum. In der stets ausdrucksvollen, nie groben und stets atmosphärischen Art seiner Musik steht er Alban Berg und etwa Dallapiccola näher als seinen slawischen Stammesgencssen Janäcek, Prokofieff oder Schostakowitsch. Was man vermißt, ist die weitgeschwungene Kaatilene, die wirkungsvolle kurze „Nummer“, das mitreißende Duett. Es bleibt alles ein wenig grau, ist dafür aber von größter stilistischer Geschlossenheit und von gleichbleibendem hohem Niveau.
Die Handlung, in acht Bilder gegliedert, folgt Tolstojs großem Roman: auf dem Gutshof bei ihren „Tanten“, die das uneheliche Kind aufziehen, wird die junge Katarina Maslova von dem Gardeleutnant Fürst Nechludov verführt. Auf der Bahnstation verläßt er sie und ihr Kind endgültig. Katjuscha landet im Salon der Madame Kitajevova, wo sie, unschuldig, den Tod des reichen Kaufmanns Smelkov herbeiführt. Unter ihren Richtern, die sie zu acht Jahren Zwangsarbeit in Sibirien verurteilen, sitzt auch ihr Verführer. Erschüttert beschließt er, sich der Unglücklichen anzunehmen, wird aber in der Kanzlei des Gefängnisdirektors von Katarina zurückgewiesen und beschimpft, obwohl er sie zu heiraten bereit ist. Auf dem Weg nach Sibirien sehen sie sich zum letztenmal. Die vom Zaren begnadigte Katjuscha stirbt in Nechludows Armen: Zeichen der Auferstehung des Guten im Menschen.
Diese acht Bilder wurden von Kornel Hajek solid inszeniert und von Ladislav Vychodil vor einen düsteren Hintergrund mit Jessnerschen Treppen gestellt. Auf der unteren Ebene der zweigeteilten Bühne herrscht der dem Roman Tolstojs angemessene Realismus. Die obere Hälfte überzieht eine spinnwebartige Konstruktion, das große Netz symbolisierend, in dem alle gefangen sind. In halber Höhe: ein großes magisches Auge, zuweilen auch als Lupe benützt, hinter der einzelne Gesichter vergrößert auftauchen — das Ganze von nicht ganz klarer Funktion, aber sehr stimmungsvoll. Von den mehr als zwei Dutzend Mitwirkenden seien nur drei genannt: Anna Martvonovä, Bohus Hanäk und Karol Sekera. Das Orchester unter dem souveränen Ladislav Holoubek musizierte vorbildlich differenziert und klangschön.