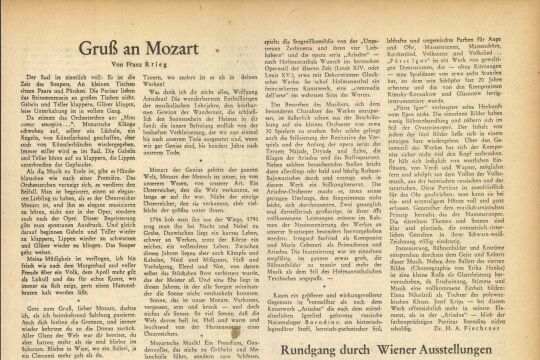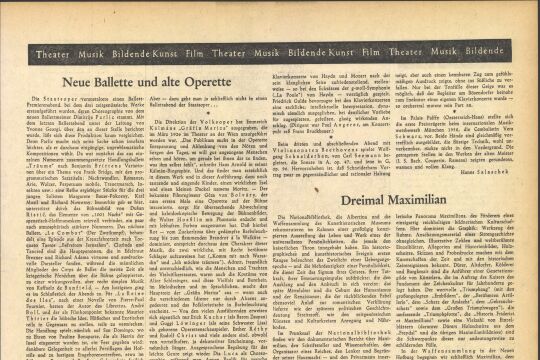Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Unbekannte Opern und neue Ballette
Man muß die Feste feiern, wie sie fallen. Das geplante (und infolge einer Erkrankung Herbert von Karajans abgesagte) Gastspiel der Wiener Staatsoper mit Straussens „Elektra“ an der Scala hat uns nicht nur ein interessantes Gesamtgastspiel der Belgrader Oper, sondern auch die Bekanntschaft mit einer Reihe teils unbekannter, teils neuer Werke des Musiktheaters beschert.
Modest Mussorgskys musikalisches Volksdrama in fünf Akten, „Chowan-schtschina“, in den Jahren 1872 bis 1880 — also nach dem „Boris“ — geschrieben, lag beim Tod des Komponisten nur als Klavierauszug vor, nach dem Rimsky-Korsakow die Partitur herstellte. Die Belgrader spielen das epische, eine Episode aus der russischen Geschichte schildernde Werk in der Neufassung und Instrumentation durch Dimitri Schosta-kowitsch, die merkwürdig kühl-klassizistisch und in den Farben zurückhaltender ist, als wir's von Mussorgsky (in seinen wenigen vollendeten Werken) gewohnt sind. Das russische Volk — Soldaten, Bauern, Sektierer und eine Gruppe Bojaren: die Chowanskys — ist Träger der spärlichen Handlung. Aber in eben dieser epischen Breite, der Zustandsschilderung, dem Atmosphärischen liegt auch der große Reiz des Werkes, das man vielleicht nicht viel anders inszenieren kann, als Mladen SabljU als Regisseur sowie Stasa Belo-ianski (Bühnenbilder) und Milica Dabic (Kostüme) es taten: konventionell, in der Art eines historischen Bilderbogens aus dem alten Rußland. Schon bei dieser ersten Aufführung konnte man auch bereits die besondere Stärke der Belgrader Gäste erkennen: eine Fülle starker und schöner Naturstimmen, die den vielen Chören Glanz und Durchschlagskraft verleihen, ein guteingespieltes Ensemble, sorgfältige, wenn auch nicht gerade einfallsreiche Regiearbeit und ein rundes Dutzend Solisten von bemerkenswerter Qualität. Die kurze Balletteinlage im vierten Bild (Tanz der persischen Sklavinnen) war ein Glanzpunkt der Aufführung, die von Dusan Miladinovii geleitet wurde.
Serge Prokofteff schrieb seine Oper „Der Spieler“ (wie Mussorgsky) auf einen selbstverfaßten Text. Da ihm eine Novelle Dostojewskys zugrunde liegt, sind einzelne Typen und Charaktere, echt Dostojewskysche Menschen, Träger der Handlung, die um 1865 in Roulettenburg — wofür man wohl Wiesbaden oder Baden-Baden, die um jene Zeit von russischen Adeligen am meisten frequentierten westeuropäischen Kurorte, setzen darf. Prokofieffs bereits 1916/17 geschriebene Musik ist intelligent, einfallsreich, beweglich und dramatisch. Diese Qualitäten lassen uns die melodischen „Schlager“ leicht vermissen, Unerklärlicherweise wurde die Oper erst 1929 in Brüssel uraufgeführt und war seither von den Spielplänen verschwunden. Es ist ein Verdienst der Belgrader, das interessante Werk wiederentdeckt zu haben. Inszenierung und Bühnenbild (Mladen SabljU und Miomir Denii) waren wesentlich moderner als in „Chowanschtschina“. Vor einen bunten Hintergrund ä la Kandinsky stellte der Bühnenbildner einige Treppen und Schrägen — was vollkommen genügte. Aus dem Dutzend Solorollen ragten Drago Stare in der Titelpartie und Rad-mila Bacolevii alä Pauline, die Stieftochter des Generals, bei dem Alexej, der Spieler, als Hauslehrer angestellt ist, um Haupteslänge hervor. Die dezenten, zeitechten Kostüme und das noble Spiel der Hauptdarsteller machten das Stück auch optisch eindrucksvoll. Sie bestätigten überdies, was Kenner der osteuropäischen Theater, insbesondere der nissischen, wiederholt hervorgehoben haben: Wolle man auf den Bühnen eine intakte, adelige Gesellschaft mit entsprechenden Typen und Manieren sehen, so müsse man nach Moskau oder Leningrad, nach Warschau oder Sofia reisen ...
Jules Massenets „Don Quichotte“ hat ein ähnliches Schicksal wie Prokofieffs „Spieler“: 1910 für Schaljapin geschrieben, verschwand das Werk nach seiner Uraufführung 1911 in Monte Carlo vom Spielplan. Sehr zu Unrecht, wie man sich überzeugen konnte. Die fünf Episoden, wie sie der Librettist Henri Cain nach dem berühmten Roman des Cervantes gestaltete, ergeben zwar keine „heroische Komödie“, wie der Untertitel der Oper lautet, sondern eher eine „lyrische Tragödie“, eine Art spanischen Tristan. Denn drei von den fünf Bildern handeln von der unglücklichen Liebe des Ritters von der traurigen Gestalt zu Dulcinea, der oberflächlichen, spröden Schönen. In Miroslav Cangalovit hat die Belgrader Oper zwar keinen neuen Schaljapin — wie die Fama noch vor Beginn des Gastspiels zu künden wußte —, aber immerhin einen überdurchschnittlichen Sänger — und einen herrlichen, liebenswürdigen und rührenden Schauspieler mit einer ebenso starken wie menschlich sympathischen Ausstrahlung, der das Ergreifende dieser abenteuerlichen Gestalt aufs schönste vermittelte. Ihm zur Seite — und in jeder Hinsicht, auch als Sänger, ebenbürtig — Latco Korosec als Sancho Pansa, ein Charakterschauspieler ersten Ranges. Der romantisch-gefühlvollen (ein wenig eklektischen, dem damals modernen französischen Hispanismus huldigenden), aber stets geschmackvollen Musik Massenets schien die etwas nüchterne Inszenierung und Ausstattung durch Mladen Sabljit und Miomir Dem'<5 (vor dunklen Vorhängen, mit spärlichen Requisiten) nicht ganz zu entsprechen. Nebenrollen, Ensembles und Chor ließen auch hier kaum einen Wunsch offen.
Das vierte Programm der Belgrader Gäste bestritt das Ballett: ein großes, wohltrainiertes und diszipliniertes Ensemble mit beachtlichen Koryphäen. „Vibrationen“ mit dem Untertitel „Fünf freie Ballettassoziationen über das Thema Mann und Weib“ behandelt in der Choreographie von Vera Kostic das ewige Thema auf slawisch-tragische Weise. Die Musik von Kresimir Fibec, prunkvoll-farbig und in ihrem fast ununterbrochenen lyrisch-dramatischen Espressivo an Skrjabin erinnernd, ist ein wenig amorph und macht es den Tänzern nicht leicht. An diesem Abend fiel auf Fibecs Partitur allerdings auch der mächtige Schatten von Bela Bartöks eruptivem „Wunderbaren Mandarin“, dessen Choreographie (Dimitrije Parlic) einige eklatante Mängel aufwies, unter denen vor allem die beherrschende Gestalt des Mandarins zu leiden hatte. So, wie Zarko Prebil ihn darzustellen hatte, war er nicht mehr als einer unter den vielen Besuchern des Schlupfwinkels, wo die drei Strolche und das Mädchen hausen. Letzteres wurde durch eine ganz erstklassige Tänzerin dargestellt: Dusanka Sijnios, die allerdings, indem sie sich an der dritten Hinrichtung des Mandarins aktiv beteiligt, keineswegs im Sinn des Librettisten Melchior Len-gyel und in krassem Widerspruch zur Musik Bartöks agierte. Dusan Ristic gelang das sehr moderne, zweistöckige Bühnenbild, das der kruden Handlung einen idealen Aktionsplatz schafft, besser als die Kostüme. — Zum Schluß: ein choreographisches Poem nach Musik zu Petar Konjovics Oper „Kostana“, aus der der Komponist — ähnlich wie Hindemith aus seinem „Mathis“ — ein „symphonisches Triptychon“ exzerpiert hat: eine sehr melodische, farbige, auf der reichen heimischen Folklore basierende Partitur von großem Charme, der die Choreographie Dimitrije Parlics bestens entsprach. In den aparten Kostümen, die für die Tänzerinnen allerdings nicht sehr vorteilhaft waren (enganliegende rote Hosen), versucht Milo Milunovic eine Synthese von folkloristischem und modernem Ballettanzug. Sehr dekorativ und kühn, etwa in der Art des Wiener Malers Mikl, der Hintergrund in vielerlei Rot. In Technik und Ausdruck gleichermaßen hervorragend: die beiden Ballerinen Jovanka Bjego-jevic und Katarina Obradovic.
Der musikalische Leiter des Ballettabends sowie der Opern von Prokofieff und Massenet war Oscar Danon, der Chefdirigent der Belgrader Oper: ein erstklassiger Mann, intelligent, präzis und temperamentvoll, äußerlich und in der ganzen Art an Georg Solu erinnernd. Unter seiner Leitung spielte das (nicht sehr große) Orchester stets klangschön und genau. Während der vier Abende war keine einzige Unstimmigkeit zwischen Dirigent, Orchester und Bühne zu bemerken: eine echte Ensembleleistung, um die manches große Opernhaus die Belgrader beneiden kann. Hierdurch — und durch den Mut zum Unbekannten und Neuen —wurdet manche 'Dürftigkeit' im Szenischen, das Fehlen von' Aüsstat-tungsprunk und Klangschwelgerei, reichlich aufgewogen. Fast möchten wir unserem Operntheater etwas von jener stolz zur Schau getragenen Armut wünschen, die durch echten Ensemblegeist und solide Arbeit kompensiert wird.
Publikum und Sänger (denen das aus dem wortwörtlichen Verstehen entspringende Echo fehlte) hatten unter dem Handikap der fremden, serbokroatischen Sprache sehr zu leiden. Um so schöner war es daher, bei den jeweils zweiten Aufführungen zu beobachten, wie sich die Zuschauer von Bild zu Bild mehr erwärmten und den Gästen am Schluß einen wohlverdienten Beifall spendeten, der freilich nicht jene Phonstärke erreichte, wie er bei manchen heimischen Dirigenten zu registrieren ist, noch bevor sich der Vorhang gehoben und ehe noch das Orchester einen einzigen Ton gespielt hat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!