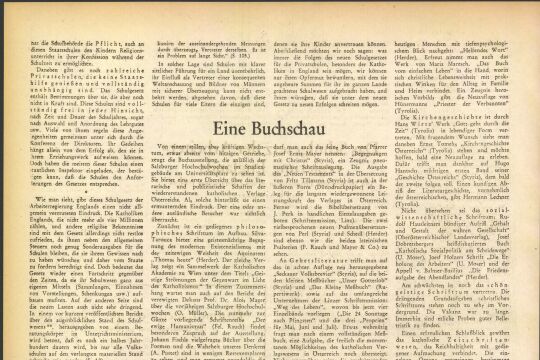Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Neue Wege im Opernstil
Wenn heute in der Öffentlichkeit Fragen und Probleme des Theaters erörtert werden, ist von diesen Diskussionen das Spezialgebiet der Oper oder des „musikalischen Theaters“ von vornherein ausgeschlossen. Sosehr ist im allgemeinen die Oper im Laufe der Jahre auf Kosten der Szene zu einer rein musikalischen Angelegenheit geworden, und so weit hat sie sich von ihrer ursprünglichen theatralischen Aufgabe entfernt. Das war nicht immer so. In früheren Jahrhunderten war das szenische Bild einer Opernaufführung charakteristisch für den Theaterstil einer ganzen Epoche, und große Szenenkünstler, wie Galli-Bibieaa, Schinkel oder Anaglio, sind gerade durch ihre Entwürfe für Operndekorationen unsterblich geworden. Heute regiert in einer gewöhnlichen Opernvorstellung szenisch das Klischee des „Cavalleria“-oder „Bajazzo“-Verismus, jenes Opernstils, der einmal als „natürlich“ galt und heute die ganze Unnatur des darstellerischen Stils in der Oper enthüllt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Auch die Bestrebungen, Ausdrucksformen der zeitgenössischen bildenden Kunst, wie es zu allen Zeiten üblich war, dem Theater nutzbar zu machen, scheitern an der Unduldsamkeit der meisten Musiker, denen man doch gerade in unseren Breitegraden heute mehr denn je auch das inszena-torische Gesieht einer Operaufführung überantwortet sehen möchte. (Bezeichnend: wenn in einem Film eine Opernaufführung vorkommt, wird meist mit ziemlicher Treffsicherheit die Steifheit oder das verlogene Temperament moderner Operndarstellung wiedergegeben.) Nun sind Musiker in den seltensten Fällen berufen, in optischen Dingen mitzureden. Gustav Mahler, der ein Genie wie Alfred Roller für die Bühne entdeckt hat, war in diesem Punkt eine Ausnahme. Thomas Mann hat in seinem „Doktor Faust“ auf diesen Unterschied von „Augen- und Ohrenmenschen“ hingewiesen. Er sagt von seinem Helden, dem Komponisten Leverkühn: „Er war ein Verächter der Augenlust, und so sensitiv sein Gehör war, so wenig hatte es ihn von jeher gedrängt, sein Auge an den Gestaltungen der bildenden Kunst zu schulen. Die Unterscheidung zwischen den Typen des Augen- und des Ohrenmenschen hieß er gut und unumstößlich richtig und rechnete sich entschieden zu dem zweiten.“ Wenn man es einmal zur Regel werden ließe, dem szenischen Bild einer Opernaufführung die gleiche präzise und minuziöse Vorbereitung wie dem einer Schauspielvorstellung ange-deihen zu lassen, so würde man erkennen, welche enormen theatralischen Qualitäten in den meisten Opern neben ihren vokalen und instrumentalen Werten enthalten sind. Wenn schon immer von Zeit zu Zeit einmal wieder gefordert wird, daß der Musiker als höchste Autorität nicht nur in musikalischen, sondern auch in szenischen Fragen gehört werde, so beginne man doch zunächst einmal damit, die Stücke so zu spielen, wie sie geschrieben sind. Die Gralshüter“ verteidigen nämlich meist nicht das Werk, sondern eine falsche Aufführungstradition, über deren Mängel sie sich niemals ernsthaft den Kopf zerbrochen haben. Sonst könnte es nämlich nicht vorkommen, daß heute „Carmen“ völlig stilfremd mit Rezitativen statt mit dem originalen gesprochenen Dialog gespielt wird, was ungefähr der Unsitte einiger romanischer Länder, „Fi-deljo“ und „Zauberflöte“ mit Orchester-rezitativen zu geben, entspricht. Sonst wäre es ferner unmöglich, daß die Opern Verdis und Puccinis in Ubersetzungen gespielt werden, die nicht nur sprachlich unzulänglich sind, sondern auch dem Sinn der Musik und der einzelnen Gesangsphrase völlig zuwiderlaufen. Im Original in den meisten Fällen eine sinnvolle, unschwülstige, realistische Sprache, im Deutschen jenes schwülstige, unverständliche Opernpathos, das noch dazu musikalisch jede Phrase verfälscht. Hier wäre ein wichtiges Gebiet für Proteste und Anregungen.
Wenn heute immer wieder gegen viele Widerstände der Versuch gemacht wird, das konventionelle szenische Bild der Oper zu erneuern, so ist herzlich wenig damit getan, einfach die szenischen Vorschriften der Komponisten zu erfüllen. Ein Werk der Vergangenheit inszenieren, heißt in gleicher Weise die geistigen Strömungen der Entstehungszeit des betreffenden Stücks verstehen, wie sie in unsere Gegenwart zu transponieren. Wäre das so einfach, gäbe es wahrscheinlich Interpreten wie Sand am Meer und alle Probleme wären gelöst. Ob unser Interesse an Werken der Vergangenheit ein lebendiges oder ein historisches ist, harrt noch der Klärung, auf jedem Fall darf unser wissenschaftliches Jahrhundert den Anspruch darauf machen ,daß beide Aspekte bei der Wiedergabe berücksichtigt werden.
Die letzte entscheidende künstlerische Stilepoche war der Expressionismus. Auch das Theater hat von ihm gelernt, und ohne seine Exstenz wäre vieles von dem unmöglich, was heute auf dem Theater an positiven Werten hervorgebracht wird. Gerade die Disziplinierung und Beherrschung des Körperlichen, die uns der kürzlich verstorbene russische Regisseur Alexander Tairoff in seiner unvergeßlichen „Girofle-Girofla'-Inszehierung so beispielhaft vorexerziert hat, die Beherrschung des Raums, die choreographische Aufteilung des Raums durch die Menschen auf der Bühne, das sind Ergebnisse, die das Theater nach der Befreiung aus den Niederungen des Naturalismus sich wieder auf seine höchst eigene Gesetzlichkeit besinnen ließ. Nachdem der Expressionismus als Kunstform abgeklungen war, haben sich formal keine entscheidend neuen Entdeckungen mehr gezeigt ,und so ist es nicht verwunderlich, wenn unser Theater heute meist vom Ausverkauf der Stile lebt. Die Aufgabe unserer Zeit liegt auch nicht in formalen Entdeckungen, sondern in einer geistigen Sichtung aller bestehenden Werte. Vor allem muß einmal betont werden, daß Natürlichkeit und Stil sich gegenseitig nicht ausschließen. Natürlichkeit ist die Voraussetzung jeder Menschendarstellung, Stil ist das, was diese Darstellung zur Kunst werden läßt. Gerade das musikalische Theater, das den Menschen nicht erregen will, sondern den Betrachter in ihm herausfordert, hätte, wenn es nichts als natürlich wäre, 6eine Geltung längst verloren. Die Fabel, die Geschichte ist das A und O jedes theatralischen Werks. Die Oper, die durch die Musik ja das- Theater der Uber-höhung geworden ist, erzählt diese Fabel als Gleichnis, und nichts anderes hat der Regisseur zu tun, als dieses Gleichnis zum bewegten Bild werden zu lassen. Als ich mit dem Bühnenbildner Caspar Neher vor Jahren zum ersten Male zwei Werke von Mozart .Figaros Hochzeit“ und „Cosi fan tutte“ auf den Redouten saal der Hofburg übertrug, da konnte in diesem herrlichen Raum die Dekoration fast völlig ausgeschaltet werden, weil die Magie des Bühnengeschehens sich aus der Kunst der Darstellung, des Kostüms und der Maske völlig unzweideutig ergab und die Dekoration nicht mehr zu sein brauchte, als Abgrenzung der Wege für die Darstellung. Als ich vor zwei Jahren, vielen Widerständen zum Trotz, das Wagnis unternahm, ein ausschließlich für die Guckkastenbühne geschriebenes Werk, wie die „Zauberflöte“, in der Felsenreitschule in Salzburg zu inszenieren, da hat sich gezeigt, daß auf diesem einzigartigen Festspielschauplatz das Werk ohne dekorative Schnörkel ein geistigeres und menschlicheres Gesicht zeigte, als auf vielen Aufführungen im herkömmlichen Rahmen. Alle Angriffe, die im ersten Jahr gegen diesen gewagten Versuch unternommen wurden, konn-nicht verhindern, daß diese Inszenierung mit steigendem Erfolg nun schon zum dritten Male in das Festspielprogramm aufgenommen wird.
Kennzeichnend für den Stil meiner Inszenierungen dürfte die Betonung des Essentiellen und die Eliminierung von allem, was nur Konzession an Auge und Oh bedeutet, sein. Die handelnden Menschen werden nicht in ihren Zufälligkeiten, sondern in Gängen und Bewegung sinnbildhaft, wie es dem konzentrierenden Bild eines musikalischen Werks entspricht, also in dem, was für sie charakteristisch ist, gezeigt. Je einfacher, je unhektischer, je leichter dies geschehen kann, um so besser. Die Farbe
auf der Bühne ist für mich nicht, wie es in unserer manieristischen Effekten so zugeneigten Zeit üblich sein mag, ein Reizwert, sondern wie in den großen Werken der bildenden Kunst ein Symbolwert. Wenn ich vor Jahren dem „Maskenball“ einen rotgoldenen Rahmen von übertriebenen barocken Ausmaßen gab, so schuf ich gleichzeitig den Stil für den breit ausladenden Bewegungsstil der Sänger, der dieser Musik adäquat ist. Wenn in „Cosi fan tutte“ Bild und Kostüm etwas von der Gleichnishaftigkeit eines Schachspiels hatten, so ging die leicht und fließend bewegte Symmetrie der Darstellung aus diesem Raum hervor. Ein italienischer Kritiker schrieb über diese Inszenierung: „Der Regisseur Schuh hat begriffen, daß man im Reich der Musik nur in musikalischen Vokabeln sprechen kann und hat daraus die Konsequenz gezogen. Sein Ziel war, die Personen einzig als “ „Zeichen“ zu charakterisieren, sozusagen als geometrische Orte musikalischer Figurationen, die sie nur von Mal zu Mal zum Leben zu erwecken hatten. (Teodore Celli in „L'uma-niti“, 17. IV. 1947.)
Und wenn ich in meiner Berliner „Gianni-Schichi'-Inszenierung (Komische Oper 1950) die Karikaturen italienischer Witzblätter, die selbst wieder eine Fortsetzung der altitalienischen Maskentradition sind, in strenger Stilisierung lebendig werden ließ, so habe ich das, was Gordon Craig, der große theoretische Theaterreformator, einmal sehr bezeichnend die Ubermarionette genannt hat, auf die Bühne gebracht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!