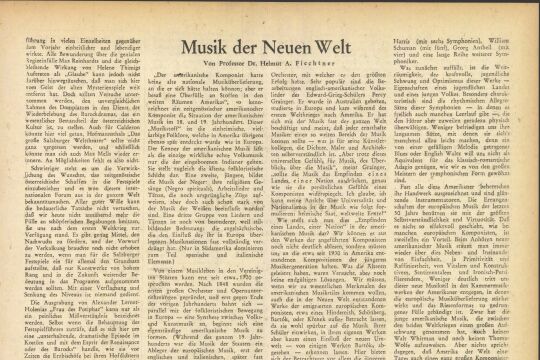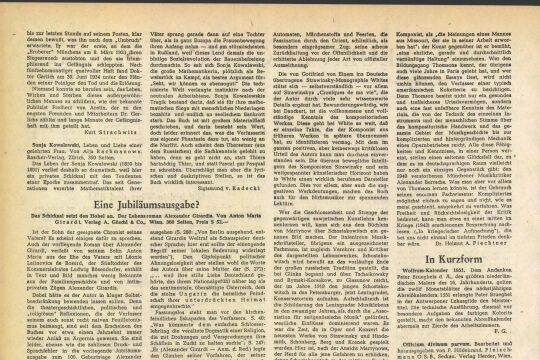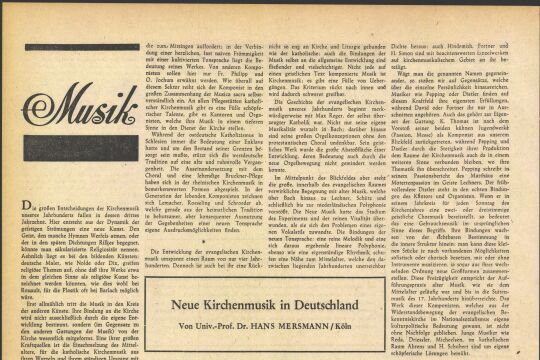Obwohl es gewiß falsch wäre, sich dem Glauben hinzugeben, man höre alljährlich in Darmstadt den Pulsschlag der zeitgenössischen Musik, obwohl dort seit nun bereits achtzehn Jahren Dada und seine letzten Ausläufer beziehungsweise Auswüchse Orgien feiern, war es doch in Darmstadt, bei den 1946 von Wolfgang Steinecke ins Leben gerufenen Ferienkursen, daß die junge Generation zum ersten Male zu Worte kam, daß Musiker und Fachleute wie Messiaen und Leibowitz, Adorno und Krenek die Jugend entscheidend orientierten, dort auch, daß die Begegnung mit Cage und der übrigen amerikanischen Avantgarde stattfand. Immer wieder gab es Unkenrufe und Warnungen, immer wieder stand man am Scheideweg, und das Ende der Musik schien nahe, falls es so weiterginge — in Donaueschingen stellte sogar H. H. Strobel die Frage: „Wie soll es weitergehen?”, und dieselbe Frage stellte man sich auch wieder dieses Jahr mit Kopfschütteln und Befremden, und doch kann kein Zweifel darüber bestehen, daß hier ein einzigartiges Forum für tatsächliche und oft ernst zu nehmende neue Bestrebungen besteht, die auch Ernst Thomas, der neue Leiter der Ferienkurse, in umsichtiger Wahl zu Worte kommen läßt.
Dieses Jahr stammten die Komponisten der zwei Dutzend Ur- und Erstaufführungen aus fünfzehn verschiedenen Ländern, und wenn sich trotzdem gewisse gemeinsame Tendenzen ganz deutlich erkennen ließen, so kann man das gewiß nicht dem Zufall zuschreiben, wie groß die Rolle des Zufalls in der neuen Musik auch sein mag. Nur neun dieser Komponisten gehörten dem tatsächlichen „Nachwuchs” an — sie waren unter dreißig Jahre alt. Fünfzehn von ihnen waren zwischen 1925 und 1934 geboren, und fast genau so zahlreich waren jene, die bereits die Vierzigergrenze überschritten haben, aber „Alter schützt vor Torheit nicht”, und wenn wir an die Kühnheit der neueren Kompositionen eines Varėse oder eines Strawinsky denken, so wird es auch nicht weiter überraschen, daß die dreizehn Vierziger zu den Fortschrittlichsten, Experimentellsten und Verwegensten der ganzen Gruppe zählen.
Unter ihnen nimmt Milton Babbitt, Senior der diesjährigen Veranstaltungen, aus mehr als einem Grunde eine Sonderstellung ein. Zum erstenmal war er Gast der Darmstädter Veranstaltungen, und er entwarf von dem Musikleben — oder vielmehr von den Untersuchungen in musikalischer Elektronik und den Studien und Anwendungen serieller Musik in Amerika — ein Bild, das sich grundlegend von demjenigen unterscheidet, das uns von Cage bekannt war, dessen Schule dieses Jahr durch Earle Brown vertreten wurde. Milton Babbitt ist einer der klarsten Denker, der genauesten Mathematiker und der phantasiebegabtesten Visionäre der Musikwissenschaft in Amerika. Was er hier, im Laufe seiner Vorlesungen über die Struktur musikalischer Systeme, unternahm, das begann ganz einfach und harmlos mit den elementarsten Gleichnissen, wie man sie von der Schule her kennt, und ehe man sich dessen versah, befand man sich plötzlich mitten in der Mathematik. Vor uns breiteten sich die geheimsten Beziehungssysteme aus, wie sie dem Reihensystem und vor allem der All-Intervall- Reihe innewohnen, all das hergestellt an Hand von genauen und einleuchtenden Untersuchungen einiger Beispiele von Schönberg, Webern und Strawinsky. Ausgehend von der Zusammensetzung des Klanges, seiner Analyse und seiner Synthese, gelangte man zu dem RCA Synthesizer, mit welchem die Töne elektrisch durch Generatoren erzeugt werden, nachdem vorher alle ihre Eigenschaften genau festgelegt wurden, was allerdings nicht ausschließt, daß man ständig eine Kontrolle durch das Ohr ausüben kann, eine Kontrolle, die eines Tages, wenn wir mit Elektronen- gehimen, mit sogenannten „Computers” arbeiten werden, wegfallen wird. Hiervor warnt Babbitt mit ernsten Worten, denn für ihn ist das Ohr letztes Maß aller akustischen Vorgänge und alles musikalischen Geschehens. An Hand einiger Tests berührt er endlich das Problem des Hörens, welches den Schlüssel zu vielem liefern wird, aber zur Zeit noch seiner endgültigen Erforschung harrt.
Wer hinter alledem den kalt berechnenden Mathematiker, den zerebralen Rechner vermutete, wurde überrascht, als am vorletzten Abend seine Komposition „Vision and Prayer” für Gesang und Tonband, nach einem Text von Dylan Thomas, zur Aufführung gelangte. Für den Hörer mag es nebensächlich sein, daß es sich hier um „totale” Zwölftonmusik handelt oder daß die Gestalt des Werkes „weniger durch die klanglichen als durch die rhythmischen Möglichkeiten des elektronischen Mediums” bestimmt wird. Wesentlich ist für ihn vor allem, daß es sich hier um eine Musik intensivsten Ausdruckes handelt, und dieser Aspekt wird noch unterstrichen durch die fast ins Extreme gesteigerte Expressivität der Sängerin Bethany Beardslee. Mag es auch manche Hörer befremdend anmuten, daß für derart gefühlsmäßige Inhalte „synthetische” Klänge hinzugezogen wurden, mag diese Diskrepanz auch manchen schockiert haben, keine’: der Zuhörer blieb im Zweifel darüber, daß es sich hier gewiß nicht um „Errechnetes” im abfälligen Sinne des Wortes, sondern um Erlebtes, Ersonnenes und Empfundenes handelte.
Wenn Babbitt mit seinem Synthesizer die eine extreme Gruppe der amerikanischen Schule vertrat, so Earle Brown mit seinen Graphiken die andere. Bereits beim Durchblättern des diesjährigen Programmheftes, welches statt mit den Porträts der Komponisten mit deren Partituren illustriert war, fiel ganz besonders das eine Bild auf: vertikale und horizontale Linien, anscheinend in wülkür- licher Anordnung, in verschiedener Breite und Länge — worum mochte es sich hier handeln? Der von Brown verfaßte Kommentar belehrt uns über seine Absichten. Er bekennt sich zu Cage, er läßt sich inspirieren durch Calder und dessen Mobile, und es geht ihm hauptsächlich darum, eine Notation zu finden, die sich besser als die herkömmliche für seine besonderen Kompositionsabsichten eignet. Wir hören „December 52”, und dieses Stück, dessen Partitur oben beschrieben ist und das Brown als ein Experiment mit graphischer Notation und Aufführungsprozessen bezeichnet, wird hier unter Anleitung des Komponisten in freier Improvisation von dem Internationalen Kammerensemble Darmstadt ausgeführt. Da es sich bei diesem Ensemble um außergewöhnliche Musiker handelt, deren Phantasie ihre Anregung dem täglichen Umgang mit musikalischer Avantgarde verdankt, hören wir eine Version, welche durch ihre spontane Lebendigkeit und ihren Abwechslungsreichtum an Texturen, Dichteverhältnissen und Tempi besticht — aber es könnte gewiß auch anders klingen.
Wenn wir nun den Klang selbst untersuchen, so ließen sich einige ganz besonders charakteristische Kennzeichen herausarbeiten, nämlich einerseits eine Vorliebe für „Clusters” und anderseits für glissandi, beide in neuen Abwandlungen, die Glissandi vielstimmig, auf ungewohnten Instrumenten, als neuartige Effekte, die Tontrauben teils schwer herabhängend, sich wuchtig auf dem Klavier (Lidholm, Bussotti) oder im Orchester (Serocki) austobend oder aber in sich selbst strukturiert, bewegt, aus kleinen Zellen zusammengestellt, die sich fortwährend ändern und verschieben, Celestaclusters bei Peixinho und endlich ganz schmale, zarte, enge „clusters”, wie sie aus einem einzelnen Ton hervorgehen, dem sich eng benachbarte Töne in ständig wechselnder Klangfarbe und dynamischen Schattierungen zugesellen, wie man das in besonders geglückter und klangschöner Art in dem Streichquartett von Günther Beckers hören konnte. Nicht nur der Tonkomplex sondern auch der Einzelton wird verwandelt, um sich in einer Art Klangfarbenmelodie zu entfalten, und Christou endlich beruft sich bei seinen klanglichen Transformationen auf alchimistische Traktate.
Mehr und mehr befreien sich die Komponisten von der Elektronik und von dem Zwang ihrer strengen Disziplin, und dabei wird ihre Phantasie ständig angeregt durch ehemals unbekannte und daher unvorstellbare Klänge, welche inzwischen in elektrischen Studios entdeckt, erprobt und verarbeitet wurden. Man versucht, diese neuartigen Klänge auf traditionellen Instrumenten hervorzuzaubern, und man schreckt nicht davor zurück, ein ganzes Schlagzeugarsenal dafür in Bewegung zu setzen,” altbekanntem, Instrumenten durch ausgefallene Spielarten neue Effekte abzugewinnen und sogar die menschliche Stimme zu yen- fremden, die Sprache als rein phonetisches Material zu behandeln (Ligeti) und unter dem Deckmantel des Dada Wortfetzen gegeneinander auszuspielen und das Lallen, Grölen, Stammeln, Kreischen und Flüstern zu gestalten.
Manche Anregung verdanken die Komponisten auch den Mitgliedern des Internationalen Kammerensembles Darmstadt. Zahlreiche Stücke für Flöte, Oboe, Cello, Schlagzeug und Klavier werden von Severino Gazzelloni, Lothar Faber, Siegfried Palm, Christoph Caskel und den Kontarsky- Brüdern oft unter Anwendung halsbrecherischer Akrobatik, stets mit derselben brillanten Virtuosität, vor allem aber mit souveräner Überlegenheit und grenzenlosem Einfühlungsvermögen interpretiert, und die Komponisten wissen genau, daß die Mitglieder dieses Ensembles und ihr Chef, Bruno Maderna, keine Mühe scheuen, vor keiner Schwierigkeit erschrecken und möglich machen, was noch vor wenigen Jahren der musikalischen Utopie angehörte.
Gleichzeitig sind sie bereit zu jedem Scherz, jedem Ulk und jedem Experiment. Sie werden zu Schauspielern, und Aktionstheater scheint ihnen ganz selbstverständlich. Spielanweisungen werden in dem Stück von Mauricio Kagel vielsprachig von den Interpreten vorgelesen, einige Akkorde am Klavier werden in dem Stück von Silvano Bussotti von dem Dirigenten angeschlagen, und wenn Gazzelloni in schwarzem Hemd durch den Saal schreitet, einigen „auserwählten” Zuhörern aus dem Publikum zuspielt und zu zögern scheint, welche seiner drei Flöten er nun aussuchen soll, dann kennt der Jubel keine Grenzen, aber man darf sich darüber nicht täuschen, daß er dem Interpreten und nicht dem Komponisten, Domenico Guaccero, gilt. Variiert werden die verschiedenen Aktionsarten bei Norbert Linke (Varim I) und recht aktionsreich ist auch der „Golem” von Hans G. Helms, in welchem mit neun schluchzenden, zischenden, Texte herunterschnurrenden, meckernden und sich gegenseitig Wortfetzen zuwerfenden Gesangssolisten auf recht fragwürdige Art Polemik gegen die Fundamentalontologie von Heidegger geführt wird, während der radikale Dieter Schnebel im wahrsten Sinne des Wortes dem „theatre de l’absurde” huldigt, indem er die Sprache selbst, als Kommunikationsmittel, als Träger sinnvoller Inhalte, ad absurdum führt und das Reden mit tausend Zungen als einen dadaistischen Scherz gestaltet. Meistens gehen hier Aktion und Wortverfremdung parallel, die Handlung erläutert das, was das zerrissene Wort nicht erhellen kann, und Ligeti, dessen Text ebenfalls nicht semantischer Natur ist, sondern einer „imaginären” Sprache angehört, zieht hieraus die letzten Folgerungen, indem er ganz systematisch eine phonetische Komposition verfaßt, nicht ohne gelegentlich zu dem Hilfsmittel der „Collage” zu greifen. Unwillkürlich denkt man an die letzten Produkte jener zur Zeit so beliebten „pop art” aus Amerika, von der man die Musik so gern verschont wüßte.
Es ist leicht zu sehen, vor welchen Problemen sich der Komponist heute befindet, ist es ihm doch unmöglich, mit den herkömmlichen Zeichen seine Intentionen eindeutig — sofern das gewollt ist — dem Interpreten zu vermitteln. Jener müßte nicht nur selbständig handeln, sondern manchmal auch raten und dann wieder Hieroglyphen entziffern können, aber es fehlt der berühmte Stein von Rosette, es fehlt der Champollion, um ihn zu entziffern. Im Rahmen eines Kongresses der Musiknotation wurde von namhaften Komponisten (Haubenstock-Ramati, Pousseur, Brown, Ligeti und Kagel) „und Praktikern (Palm, Kontarsky und Caskel)(,die Schwierigkeit von den verschiedensten Seiten aus beleuchtet, und abschließend erklärte Carl Dahlbaus in überaus klarer Art uiid Weise, wie heute nicht mehr Tonhöhe und Zeitablauf, sondern vielmehr Klangfarbe und Artikulation im Zentrum des Klanggeschehens stehen. Beide sind jedoch nicht skalenbildend, und wo der Zusammenhang durch den Reiz ersetzt wird, wo Improvisation und selbst Zufall bestimmend in den Verlauf eingreifen, da haben wir es oft mit einer Schrumpfung der Form zu tun, und hier liegt, laut Dahlhaus, der Kern des ganzen Problems.
Gewiß gelangte man nicht zu einer einheitlichen, neuen Notenschrift und gewiß wurden auch keine konkreten Resultate erzielt, aber es wurde Klarheit geschaffen über so manches, das einmal zur Sprache kommen mußte. Während der kommenden Monate können nun die zahlreichen Anregungen verarbeitet werden, und nächstes Jahr wird sich zeigen, „wie es weiterging”.