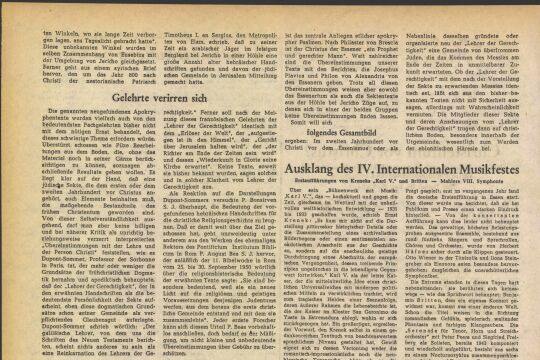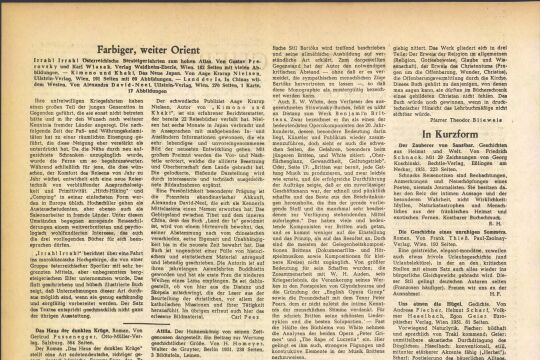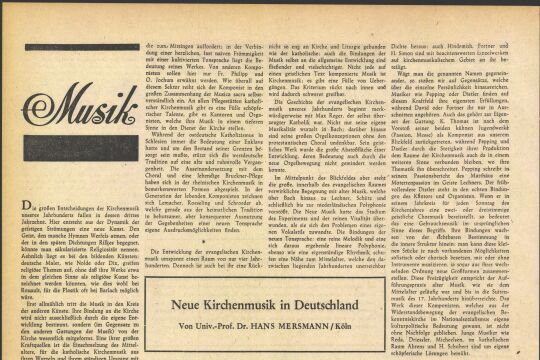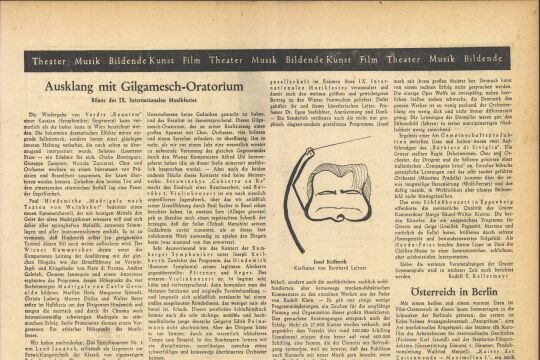Es kann nicht geleugnet werden, daß Österreichs Musikleben — der natürlichen Wellenbewegung zufolge, die jeder Kunstentwicklung innewohnt — heute nicht auf der gleichen schöpferischen Leistungshöhe hält, von der die ersten zwei Jahrzehnte dieses Jahrhunderts gekennzeichnet waren. Dieses Phänomen ist aber keineswegs auf Österreich beschränkt: Vielmehr fließt in einer Zeit völliger Neuformierung der ästhetischen Ordnungen die künstlerische Produktion an sich und allerorten nur sparsam. Freilich entkräftet diese Tatsache den Vorwurf nicht, den Ernst Krenek vor einiger Zeit erhoben hat: daß nämlich das Vorhandensein einer jungen österreichischen Komponistengarde praktisch unbekannt ist.
Zweifellos sind dafür auch jene Gründe maßgeblich, die Krenek anführt: die unzulängliche organisatorische Vorbereitung, die mangelnde publizistische Auswertung sowie der eingeborene Skeptizismus, „der das Besondere... zunächst als eine kuriose Schrulle von bestenfalls lokaler Bedeutung behandelt“. Aber noch entscheidender für die Isoliertheit der jungen österreichischen Komponisten ist ein Erbteil der „Wiener Schule“, das sie zu tragen haben. Nicht nur die Verpflichtung, jede einzelne Note ihrer Werke im technischen wie im ethischen Sinn zu verantworten, ist ihnen auferlegt, sondern auch das Odium des Esoterischen, das dem Schönberg-Kreis seit seinem Bruch mit den Bequemlichkeiten und Unverbindlichkeiten der Tradition anhaftete. Für die „Wiener Schule“ waren die Tragik des Ausgesondertseins und die Glorie des Auserwähltseins stets nur die komplementären, einander bedingenden Gefühlskomponenten ihrer historischen Situation; die Jungen von heute tragen an dem Gewicht des einen, ohne — auf Grund einer ganz anderen Einstellung zur Funktion ihrer Kunst — den Nimbus des zweiten überhaupt in Anspruch nehmen zu wollen.
Das Los, mit ihrem Schaffen ohne weltweite Resonanz zu bleiben, trifft dabei auch jene österreichischen Komponisten, die sich in der Technik wie im Stil von einer Nachfolge der Schönberg-Schule ferngehalten haben. Freilich ist dies der kleinere Teil der ernstzunehmenden Musiker des Landes; und selbst in der Abwehr wird noch die unerhörte Prägekraft der „Wiener Schule“ spürbar. Wenn auch unsere kleine Studie der Komponistengeneration gewidmet ist, die in der Schönberg-Nachfolge steht, so soll doch, der Vollständigkeit halber, auch ein Blick auf diese ihr entgegengesetzte Musikergruppe geworfen werden, die den Bannkreis der österreichischen Romantik (wie sie zuletzt verbindlich von Franz Schmidt vertreten worden ist) niemals ganz verlassen hat. Der Doyen der traditionsgebundenen Komponisten, die im „Österreichischen Komponistenbund“ und in der „Österreichischen Gesellschaft für Zeitgenössische Musik“ organisatorisch zusammengefaßt sind, ist Joseph Marx, der in diesen Tagen seinen 80. Geburtstag feiert. Marx, einst Schreker-Schüler, ist besonders als Liederkomponist bekannt geworden; aber seine Orchesterwerke erweisen vielleicht noch deutlicher, daß sie „Stimmungsmusik reinster Prägung“ sind: eine Synthese aus Hugo Wolfs Spätromantik, straussischer Klangsinnlichkeit und impressionistischer Farbenfreudigkeit. In Marxens Schülerschar finden sich so gegensätzliche Charaktere wie Johann Nepomuk David und Alois Melichar, Rudolf Kattnig und Armin Kaufmann. Einem ähnlichen Musikideal sind auch — ohne bei Marx in die Schule gegangen zu sein — Komponisten wie Franz Salmhofer und Ernst Ludwig Uray, Otto Siegl und Jenö von Takäcs, Alfred Uhl und Leopold Matthias Walzel sowie die beiden „komponierenden Priester“ Raimund Weißensteiner und Joseph Messner verhaftet. Ganz eigene, persönlichkeitsgebundene Wege gehen schließlich Komponisten wie Gottfried von Einem, Theodor Berger und Erich MarckhI.
Um jedoch die Verschiedenartigkeit der Lösungen zu verstehen, die allein aus dem Stilkomplex der „Wiener Schule“ entwickelt worden sind, muß man bedenken, daß es auch in der Kunst ein Generationenproblem gibt. Künstlerische Erfahrungen werden nicht nur vom einzelnen gemacht und überliefert, sie werden auch vom Kollektiv weitergetragen. Die Materiallage der Künste ist in jeder Generation komplexer, angereichert durch den Niederschlag der Gesamterfahrung der vorangegangenen Generation. Auf die Situation der österreichischen Gegenwartsmusik bezogen, heißt das: Komponisten, die in die Lehre Schönbergs, Bergs oder Weberns gingen und noch persönlich mit ihnen Kontakt hatten, stehen wie diese auf dem festen Grund eines noch traditionellen Formdenkens, einer kompakt-thematischen Arbeit, wie sie ihre Meister übten. Egon Wellesz, Hans Erich Apostel und Hanns Jelinek wären hierher zu zählen, während sich eine Persönlichkeit wie Ernst Krenek, der in seiner Entwicklung einstmals an derselben Stelle hielt, dann aber in schöpferischer Rastlosigkeit bis zum Spitzenfeld der heutigen Avantgarde vorgestoßen ist, nirgends einordnen läßt.
Die Jungen aber, deren künstlerische Bewußtwerdung mit dem totalen Neubeginn der Jahre nach 1945 zusammenfiel, standen vom ersten Augenblick an auf der Seite Anton Weberns; sie haben Weberns Strukturdenken, das Schönbergs Zwölftonprinzip schon weit hinter sich ließ, noch weiter gedacht und an die Stelle des hierarchisch-linearen Komponierens die restlose Determinierung aller musikalischen Elemente gesetzt, „wodurch Komplexität zur Wahrnehmungs- und Erlebnisqualität wurde“ (Cerha). Dieses sogenannte „serielle“ Kompositionsverfahren wurde (und wird noch heute) mit dem Vorwurf der Hirnlichkeit, des Errechnet-Konstruierten bedacht; den jungen Österreichern, die sich der seriellen Musik verschrieben haben, wird von der Generation der „Wiener Schule“ überdies noch vorgeworfen, sie hätten Weberns Schöpfung mißverstanden und die inspirierte „Natur“ an den kalkulierten „Geist“ verraten. So stehen sich im musikalischen Kräftespiel Wiens zwei Fronten unvereinbar gegenüber, die sich zwar beide auf die Abkunft vom Schönberg-Kreis berufen können, darin aber von mehr als nur dem tiefen Schnitt mitten durch ihre Jahresringe getrennt werden.
Zwischen den „Jüngern“ und den „Jüngsten“ existiert aber noch eine weitere Komponistengeneration: die zwischen 1915 und 1925 Geborenen. Das ist die eigentlich problematische, ja tragische Künstlerschar unter Österreichs Musikern. Als sie in die musikalische Reife eintrat, war Berg tot und Schönberg emigriert, reglementierte ein vulgäres System die Kunst ins Volk, war Österreich von der Landkarte gestrichen und galt Musik, die nicht im Viervierteltakt die Massen zum Marschieren antrieb, als schlecht und böse. Diesen Bruch — empfangen von einer Zeit, die alles in Brüche schlug — haben Komponisten wie Friedrich Wildgans (Jahrgang 1913) und Karl Schiske (1916), Robert Schollum (1913), Helmut Eder (1916) und Augustin Kubicek (1918) in ihrem Schaffen auszutragen: Spielmusikgesinnung in rudimentären Resten, unmittelbar daneben ein Widerhall aus jenen Untergründen, die der Expressionismus freigelegt hat, der Wunsch, ins krönende C-Dur zu finden, und zugleich der Wille zur Strenge serieller Ordnungen, den Jüngeren abgeschaut. Das alles soll amalgamiert und künstlerisch bewältigt werden.
Aber auch bei den um wenige Jahre jüngeren Komponisten herrscht keinerlei Uniformität im Stilistischen. Vielmehr läßt sich die Schar der nach 1920 Geborenen überhaupt nicht zu einer Gemeinschaft zusammenfassen, sondern kann nur als Summe von Individualitäten verstanden werden. „Jahrgangsältester“ ist Paul Kont. Er wurde 1920 in Wien geboren, absolvierte seine Musikstudien bei dem Schönberg-Schüler Josef Polnauer und an der Wiener Musikakademie (unter anderem Komposition bei Josef Lechthaler) und kann heute als der — neben Gottfried von Einem — einzige dieser Gruppe gelten, der von den Innovationen Schönbergs und Weberns unbeeinflußt ist. Die Alternative Tonalität — Atonalität stellte sich aber für Kont gar nicht, da er das temperierte System als eine künstliche Schöpfung ansieht und seinem Komponieren die „naturgegebene“ Obertonreihe zugrunde legt. Die Schwierigkeit, eine rein diatonische Musik zu vermeiden und zugleich den Gravitationsgesetzen der funktionellen Harmonik zu entrinnen, hat Kont in mehreren Ansätzen überwunden: Nach eher experimentellen, didaktischen Studien („Etüden zur Metamorphose von Intervallen“) stieß Kont über eine Periode Orff-naher Grundtonmusik („Variationen über Elementarschritte der Musik“) zu einer Vereinigung von Homophonie und Polyphonie vor, die auf der kaleidoskopartigen Umdeutbarkeit harmonischer Zentren sowie auf metrischer A-Periodizität beruht und von Kont selbst als „komplexe Technik“ bezeichnet wird. Solcherart entsteht beim Anhören seiner Werke — die wichtigsten sind: „Drei Tanzskizzen“ und „Komplex E“ für Orchester, die Ballette „Amores Pastorales“ und „Die traurigen Jäger“, die Opern „Lysistrate“ und „Peter und Susanne“ sowie zahlreiche Kammermusik, unter anderem zwei Eichendorff-Liederzyklen — jener seltsame Misch-eindruck aus raffiniert „modernem“ Zuschnitt (der auch Modelle Strarwinskys und Schönbergs, aber auch des Jazz heranzieht) und zeitfremder Simplizität. In Konts Musikerseele liegen eben zwei Kräfte im Widerstreit: eine puristische, die an die meditierende Haltung der Ostasiaten nicht weniger erinnert als an das entwicklungslose Glasperlenspiel Joseph Matthias Hauers, und eine universalistisch-synthetische, die auch vor der Hinwendung zum Unterhaltungsgeschäft (unter anderem mit dem Musical „Traumleben“ nach Grillparzer) nicht zurückschreckt.
Expressiv-Ungebärdiges schreibt der in Salzburg beheimatete Gerhard Wimberger (Jahrgang 1923). Seine Musik, wiewohl immer von streng kalkulierten Ordnungen geformt, reicht von schreiend dissonanten Ausbrüchen bis zur frostig-gläsernen Klangkombination. Am bekanntesten ist sein „Concertino für Klavier und 15 Streicher“ geworden, obwohl dieses Werk in der technischen Souveränität hinter den beiden (jüngeren) Orchesterwerken „Figuren und Phantasien“ und „Loga-Rhythmen“ zurücksteht. Wimberger ist auch als Bühnenkomponist hervorgetreten: Nach der bezaubernden, vor acht Jahren gestarteten „Schaubudengeschichte“ gab es 1960 mit „La Battaglia oder Der rote Federbusch“ bei den Schwetzinger Festspielen einen ziemlich eindeutigen Mißerfolg.
Zu den wenigen lebenden Sakralkomponisten von internationaler Bedeutung zählt Anton Heiller, der 1923 in Wien zur Welt kam. Heillers berühmtestes — und stärkstes — Werk entstand schon 1949: die Choralmotette „Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig“, in der mit dem Mittel der Polyphonie bald hartdissonante Reibungen, bald zarte Lyrismen erzielt werden. Heillers stilistischer Weg führte aus einem Stadium Hindemith-naher Kontrapunktik über einen Abschnitt impressionistischer Verweichlichung (etwa in der großangelegten „Psalmenkantate“) zur unorthodoxen Einbeziehung zwölftöniger Prinzipien, wie sie etwa zuletzt in der „Missa duodecimales“ verwirklicht wurden. Auch der Großteil der übrigen Werke Heillers ist den beiden kirchlichen „Instrumenten“ — dem Chor und der Orgel — gewidmet. Zu den wenigen Komponisten, welche die zeitgenössische Chormusik bereichert haben, gehört auch Lothar Knessl (Jahrgang 1927). Er hat mit einer Weihnachts- und einer Oster-motette ungewöhnliche Begabung und erstaunliche Kühnheit (etwa in der Ausnützung der Klangfarbenmöglichkeiten des A-cappella-Gesanges) bewiesen; es ist sehr zu bedauern, daß
Knessl das Komponieren ganz aufgegeben hat, um sich der verantwortungsvollen Tätigkeit eines Musikkritikers bei der Wiener Tageszeitung „Neues Österreich“ zu widmen. Ähnliches gilt für Franz Krieg.
Paul Angerer, der heute Fünfunddreißigjährige, ist ein universelles Talent: Lange Zeit Solobratschist der Wiener Symphoniker, hat er vor einigen Jahren sein Instrument mit dem Taktstock vertauscht und leitete bisher das Kammerorchester der Wiener Konzerhausgesellschaft; zugleich aber greift er noch immer gern zur Blockflöte, um unbekannte Renaissance- und Barockmusik stilgerecht zu interpretieren. Als Komponist ist Angerer in seinen zahlreichen Werken dem Geiste Hindemiths und Johann Nepomuk Davids verpflichtet. Polyphone Kunstfertigkeit verbindet sich in ihnen mit einer vitalen Musizierlust, neobarocker Formensinn zeichnet sie aus. Angerer liebt es,, seinen Kompositionen rebushaft-verschlüsselte oder ironischverspielte Titel zu geben — man denke nur an die „Gloriatio“ für Kontrabaß und Kammerorchester, an die „Sonnerie“ für Cembalo, Schlagwerk und Streicher oder an die „Musica fera“ („Wilde Musik“), Angerers bisher erfolgreichstes Orchesterwerk.
Im Banne Anton Weberns stehen die drei Komponisten Karlheinz Füssl (Jahrgang 1924), Michael Gielen (1927) und Gerhard Lampersberg (1928). So verschieden auch ihre Handhabung der Webernschen Technik und ihr persönlicher Ausdruckswille sind, so nahe rücken die klanglichen Ergebnisse aneinander. Die Starrheit motivisch verzahnter und gespiegelter Strukturen kennzeichnet ihre Werke, von denen hier nur Füssls „Epitaph auf Webern“, Gielens „Variationen für 40 Instrumente“ und Lampersbergs „Concertino“ genannt seien. Diese Starrheit war der seriellen Musik in den ersten Jahren ihrer Existenz ganz allgemein eigen; inzwischen ist sie jedoch längst gelockert und von einzelnen jungen Komponisten ganz überwunden worden, wobei der Gegenschlag sogar bis zur völlig improvisierten, „aleatorischen“ Musikgestaltung (bei der Komposition und Aufführung zusammenfallen) geführt hat.
Zu den profiliertesten Komponisten, die diese jüngste Wegstrecke der Musik mitverfolgt und selbst gebahnt haben, gehört der Wiener Friedrich Cerha. Sein relativ reichhaltiges Schaffen entwickelte sich von seriellen Werken strengstei Observanz (etwa den Violine-Klavier-Stücken „Deux eclats en reflexion“ und „Formation et Solution“) zu einer Werkreihe, die den vom (ebenso glänzenden) Theoretiker Cerha selbst aufgestellten Kriterien der „Spontaneität“ und „sensitiven Kontrolle“ Genüge leistet. Hierher zählen die in Berlin uraufgeführten „Espressioni fondamentali“, die „Enjambements“ für sechs Instrumentalisten, vor allem aber die „Relazioni fragili“ für Cembalo und Kammerorchester, in denen kompositorisches Niveau und aparte Klangwirkung eine beglückende Verbindung eingegangen sind. So wird Cerha auch zum Anführer und Vorbild der jüngsten österreichischen Komponisten, deren Schaffen — wiewohl durchaus ernstzunehmen — noch den stilbildenden Einflüssen von allen Seiten offensteht und zunächst unter dem Gesichtspunkt des Experiments, des Sich-selbst-Findens zu betrachten ist. Dennoch haben sich schon heute vielfältige und eigenständige Begabungen dokumentiert: der konstruktiv gesinnte Kurt Schwertsik etwa (Jahrgang 1935), der schwerblütige Tiroler Erich Urbanner (1936), der als Pianist wie als Komponist gleich wendige und virtuose Otto J. M. Zykan (1935) und die beiden der Musikbühne verschriebenen Gösta Neuwirth (1937) und Ingomar Grünauer (1938).
Einen Sonderfall stellt der von griechischen Eltern stammende, seit 1942 in Wien lebende Anestis Logothetis dar, der sich mit besonderer Experimentierlust der „graphischen“, nicht eindeutig in Noten fixierten Musik verschrieben hat. Er gehört, ebenso wie jene vier ungarischen Komponisten, die nach der Revolution im Jahre 1956 nach Österreich gekommen sind — György Ligeti, Josef Maria Horvath, Ivan Eröd und Istvan Zelenka —, zu jenen Musikern, denen Österreich nicht nur zur persönlichen Heimat, sondern auch zur künstlerischen Welt geworden ist. So groß die Schwierigkeiten dieses Assimilationsprozesses waren, so erstaunlich sind seine künstlerischen Resultate; sie im einzelnen darzustellen, bedürfte es einer ausführlichen Studie.