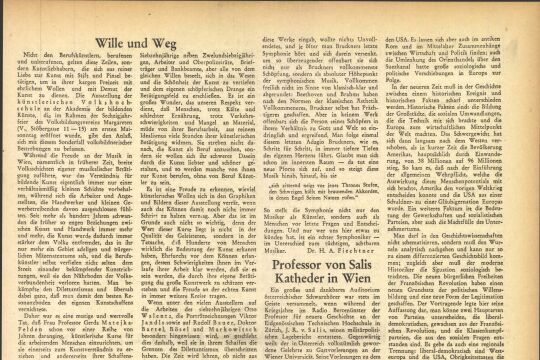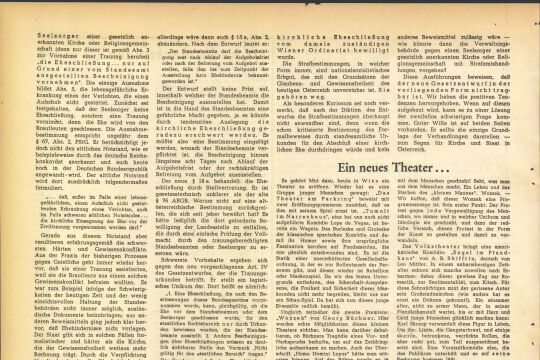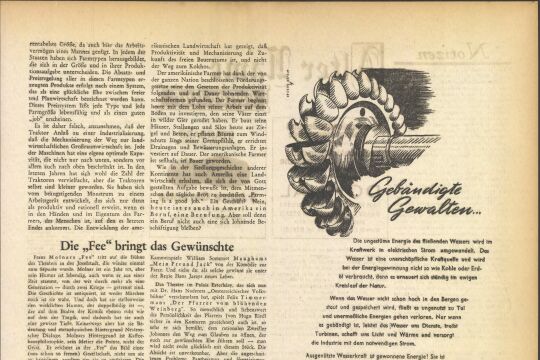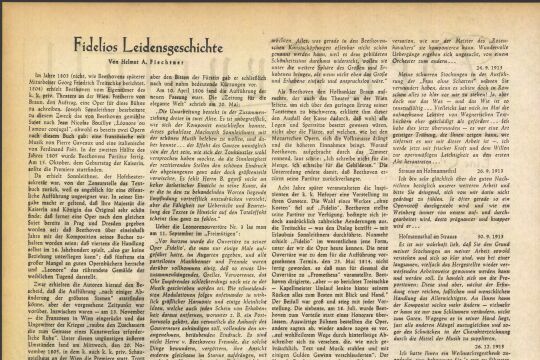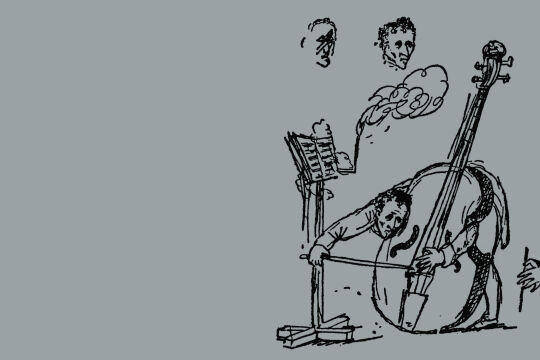In seinem letzten Lebensjahr, nach zwei mißglückten Staroperationen fast völlig erblindet, schuf Johann Sebastian Bach sein kontrapunktisches Opus magnum „Die Kunst der Fuge“. Vierzehn fugierte und vier kanonische Stücke werden auf einem einfachen, fast unpersönlichen Thema aufgebaut und in immer freierem Fluß entwickelt: wahre Wunderwerke kompositorischer Kunst und zugleich ergreifende persönliche Aussage. Noch in Bachs Todesjahr (1750) wird „Die Kunst der Fuge“ von seinen Söhnen Philipp Emanuel und Wilhelm Friedemann herausgegeben. Nur die Anordnung der ersten elf Stücke stammt von Bach. Außerdem fehlt in Bachs Partitur jeder Hinweis in bezug auf die Besetzung — und damit auf die originale klangliche Realisierung. In Bachs Nachlaß fand sich auch noch eine große unvollendete, nach dem 239. Takt abbrechende Tripelfuge, von der die Söhne annahmen, daß sie das Schlußstück bilden sollte. Ihr erstes Thema ist liturgisch-religiös, mit gregorianischem Einschlag; das zweite hat orgelmäßigen Charakter; das dritte, mit der Notenfolge B-A-C-H ist gewissermaßen die persönliche Unterschrift. Auf diesem Blatt mit den letzten Noten von Bachs Hand, das man nicht ohne Rührung und Ehrfurcht betrachtet, hat Philipp Emanuel vermerkt: „Über dieser Fuge, wo der Nähme BACH im Contrasubjekt vorgebracht worden, ist der Verfasser gestorben.“ Das stimmt nicht ganz wörtlich, denn Bach hat noch darnach seinem Schwiegersohn Altnikol einige Choralvorspiele diktiert. Das letzte, „Vor Deinen Thron tret’ ich hiemit“, fügten die Söhne der „Kunst der Fuge“ hinzu.
Bachs letztes Werk hat der Nachwelt viele Rätsel aufgegeben: Handelt es sich bei der „Kunst der Fuge“ um ein reines Lehrwerk, zum Lesen bestimmt? Wenn nicht: für welche Instrumente ist es gedacht? Wie ist die richtige, vom Autor vorgesehene Reihenfolge der einzelnen Stücke? 1924 nahm der junge, frühverstorbene Auslandschweizer Ernst Wolfgang Graeser eine Neuordnung der einzelnen Stücke vor und machte in einer kühnen Instrumentierung für Streicher und Bläser die „Kunst der Fuge“ aufführungsfähig. Aber seither gab es noch einige andere Bearbeitungen: für Streichquartett und Streichorchester, für zwei Klaviere und, zuletzt durch Wolfgang von Karajan, den Bruder des Dirigenten, eine Bearbeitung für vier Orgelpositive. Hier, bei diesem Werk und seinen Bearbeitungen, treten bereits die besonderen Schwierigkeiten, die die meisten musikalischen Fragmente bieten, zutage. So, wie sie die Meister hinterlassen haben, sind sie stumm — oder zumindest esoterisch. Denn nur ein sehr geringer Prozentsatz, auch unter den Musikliebhabern, vermag eine kompliziertere Partitur zu lesen. Bearbeitungen, Weiterführungen, ja selbst die Instrumentation geraten unweigerlich ins kritische Kreuzfeuer. Aber nur durch sie kann eine Partitur zum klingenden Leben im Konzertsaal oder im Opernhaus erweckt werden. Hier ist das Dilemma
Recht schwierig liegen die Dinge auch bei Mozarts letztem Werk, seinem eigenen Sterbelied, dem „Requiem“, dessen unheimliche Entstehungsgeschichte ja inzwischen geklärt ist. (Der geheimnisvolle „graue Bote“, der dem Schwerkranken wie der Tod erscheinen mußte, war von einem dilettierenden Musikfreund, dem Grafen Walsegg, geschickt worden, der sich mit fremden Federn zu schmücken gedachte ) Nicht ganz geklärt dagegen ist, was in der uns erhaltenen Partitur von Franz Xaver Süßmayer und was von Mozart stammt. Aber der Zeitstil war so gefestigt, daß wir, sollten auch ganze Passagen von Süßmayer sein, das Mozart-Requiem als durchaus einheitlich in Stil und Aussage empfinden — von einigen wenigen Stellen abgesehen, die nur den Fachmann zu interessieren brauchen. — Je entschiedener sich nämlich der Individualstil — im Lauf des 19. Jahrhunderts — ausprägt, um so schwieriger wird es, ein als Fragment hinterlassenes Werk zu ergänzen. Doch bevor wir einige solcher komplizierten Fälle beleuchten, kehren wir zu den Wiener Meistern zurück.
Bei den großen Symphonikern spielt die Neunzahl eine geheimnisvolle Rolle. Während der Arbeit an einer Symphonie, aus der dann später die berühmte „Neunte“ wurde, trug sich Beethoven mit dem Gedanken an eine „Symphonie in den alten Tonarten“, die vielleicht seine „Zehnte“ geworden wäre und die „religiösen Charakter“ haben sollte. Beethoven notierte sich 1818 für die einzelnen Sätze: „Frommer Gesang — Herr, Gott, dich loben wir — Alleluja — im Adagio Text griechischer Mythos, Cantique Ecclesiastique — im Allegro Feier des Bacchus.“ Auch die Tonfolge B—A—C—H sollte in dem Werk eine Rolle spielen. Übrigens hat auch Schubert neun Symphonien geschrieben — von denen übrigens zu Lebzeiten des Komponisten keine einzige aufgeführt wurde. Aber seine berühmte „Unvollendete“ ist nicht seine letzte. Warum er den beiden 1822 geschriebenen herrlichen Sätzen (Allegro moderato und Andante con moto) keine weiteren folgen ließ, wissen wir nicht Empfand er vielleicht, wie wir, daß diese beiden Teile, die ein vollendetes Ganzes bilden, keiner Steigerung mehr fähig, keiner Fortführung bedürftig waren? Jedenfalls hat er die Skizzen zu einem Scherzo, obwohl er dafür noch Zeit gehabt hätte, nicht ausgeführt. Anders — und doch auch wiederum ähnlich, verhält es sich mit Anton Bruckners Neunter, die „dem lieben Gott“ gewidmet ist. Zwar nahm ihm, nach Vollendung der Partitur des dritten (Adagio-) Satzes der Tod die Feder aus der Hand (und er empfahl, an Stelle des fehlendes Finales sein Te Deum zu spielen), aber beim Anhören dieses seines schönsten und tiefsten Werkes haben wir keineswegs den Eindruck des „Fragmentarischen“. Ec ist eben eine Bruckner-Symphonie in drei Sätzen
Ein echtes, typisches — und daher heftig umstrittene: Fragment ist Gustav Mahlers X. Symphonie. Er wußte, daß es sein letztes Werk sein würde, hatte er sich doch vor der Arbeit an seiner Neunten so gefürchtet, daß er bei dem vorausgegangenen „Lied von der Erde“ die Numerierung vermied. Bis zuletzt arbeitete Mahler an seiner
X. Symphonie, einem breitangelegten fünfsätzigen Werk, von dem nur die nächsten Freunde wußten. Mahler forderte, daß die Entwürfe nach seinem Tod verbrannt würden, aber seine Witwe konnte sich dazu nicht entschließen. „Es wird ruhen bleiben“, schrieb 1913, zwei Jahre nach Mahlers Tod, sein erster Biograph Richard Specht, „und manchem ein seltsames Gefühl geben, daß irgendwo, gleichsam lebendig begraben, vollkommen zum Dasein gerüstet und doch zum Nichterwachen verdammt, ein ganz ausgetragenes Werk von Mahlers Hand in der Welt sei; in Siegeln, die wohl zu entziffern, aber von keinem mehr zu sprechendem Ausdruck zu lösen sind.“ In gleichem Sinn sprach sich auch Arnold Schönberg aus, der eine Ergänzung strikt ablehnte. „Was seine Zehnte, zu der, wie auch bei Beethoven. Skizzen vorliegen, sagen sollte, das werden wir so wenig erfahren wie bei Beethoven und Bruckner. Es scheint, die Neunte ist eine Grenze. Wer darüber hinaus will, muß fort. Es sieht aus, als ob uns in der Zehnten etwas gesagt werden könnte, das wir noch nicht wissen sollen, wofür wir noch nicht reif sind. Die eine Neunte geschrieben haben, standen dem Jenseits zu nahe. Vielleicht wären die Rätsel dieser Welt gelöst, wenn einer von denen, die sie wissen, die Zehnte schriebe. Und das soll wohl nicht so sein Wir sollen noch weiter kämpfen und ringen, sehnen und wünschen Es soll noch Kampf und Lärm weiter sein “ Daran hat es, speziell in der Auseinandersetzung um Mahlers Werk im allgemeinen und speziell um seine Zehnte, nicht gefehlt. Bereits die Publikation der fragmentarischen Partitur in Faksimile wurde von Mahlers Verehrern als eine Indiskretion empfunden, vor allem wegen der sehr persönlichen Eintragungen in der Partitur. Als vollständig ausgeführt kann nur der erste Satz gelten, der seit 1924 gelegentlich aufgeführt wird. Bereits im Scherzo gibt es Lücken, und die letzten drei Sätze sind — Fragmente. Die Internationale Gustav-Mahler-Gesellschaft, mit ihrem Zentrum in Wien, deren Vorstand Professor Erwin Ratz bereits mehrere, kritisch revidierte Bände herausgegeben hat, plant als Band XI der Gesamtausgabe eine Publikation der X. Symphonie in zwei Teilbänden. Nur vom ersten, das Adagio enthaltend, soll Orchestermaterial hergestellt werden, die übrigen Teile werden nur ohne (genauer: gegen!) den Willen der Gustav- Mahler-Gesellschaft exekutiert. Übrigens ist das bereits geschehen, und zwar in einem Konzert der BBC London am 19. Dezember 1960, wo alle fünf Sätze, nach der Rekonstruktion eines gewissen Herrn Deryck Cooke, aufgeführt wurden. Diese Ergänzung ist deshalb, argumentiert die Mahler-Gesellschaft, so problematisch, weil u. a. die Harmonien, die Mahler sich in Zusammenhang mit diesen Skizzen vorgestellt hat, angesichts des weit fortgeschrittenen Stils kaum ergänzt werden können.
Um wieviel mehr trifft dies für drei spätere Werke zu, die von den Meistern der „neuen Wiener Schule“ stammen: von Arnold Schönberg und Alban Berg. Des ersteren Bekenntnisdichtung „Moses und Aron“ stammt aus früher Zeit, die Komposition erfolgte in den Jahren 1930—1932 — und wurde aus uns unbekannten Gründen abgebrochen. Man half sich bei den bisherigen Aufführungen — um die Lösung in zwei Worten anzudeuten — so, daß man den nicht komponierten letzten Akt snrechen ließ und Tonbänder mit Musik aus den vollendeten Teilen unterlegte. Eine weit schwierigere Arbeit hat, im Auftrag von Schönbergs Witwe, der Komponist und Schönberg-Schüler Winfried Zillig geleistet, als er es unternahm, das Fragment von Schönbergs „Jakobsleiter“ auszuführen und zu ergänzen. Auch hier war nur der Text vollständig vorhanden: ein vom Komponisten verfaßtes theosophisches Erlösungsepos, das bereits 1917 bei der Wiener Universal-Edition erschienen war. Aber von der Musik ist nur der erste Teil und die Hälfte eines symphonischen Zwischenspiels vorhanden, und zwar beides lediglich im Particell, zum Teil in flüchtigen Skizzen. Zillig hat zwei Jahre lang an der Ausarbeitung dieses Fragments gewerkt, und was dabei herauskam, klingt wirklich — wie man sich bei der Welturaufführung während der Wiener Festwochen 1961 überzeugen konnte — wie von Schönberg. Aber hätte dieser seine Entwürfe wirklich so — oder vielleicht ganz anders — ausgeführt? Die Frage muß zumindest gestellt werden. Ferner auch die nach der Berechtigung solcher Unternehmungen. Unsere Zeit ist fragmentfeindlich. Man möchte am liebsten alles „Unvollendete“ — tant bien que mal — fertig machen, und zwar nicht nur aus Kunstbegeisterung, sondern auch um des Geschäftes willen. Es ist ein öffentliches Geheimnis, daß die Erben an den nachgelassenen Werken Unsummen verdienen. Und für den Bearbeiter, den Exekutor, fällt ein Blatt aus dem Ruhmes- kranz des Autors ab
Solchem Treiben hat zum Beispiel die Witwe Alban Bergs einen Riegel vorgeschoben. Auch die Oper „Lulu“ ist, wie man weiß, ein Fragment. Berg unterbrach die etwa 1928 begonnene Komposition des Wedekindschen Textes zweimal, zugunsten der „Weinarie“ nach Baudelaire und des berühmten Violinkonzerts „Auf den Tod eines Engels“. Die Komposition im Particell konnte Berg, der am 24. Dezember 1935 starb, noch beenden, aber der letzte Akt blieb, bis auf einige Bruchstücke, uninstrumentiert. Für ambitionierte und fähige Regisseure bietet sich hier eine reizvolle Aufgabe, die, so oft Bergs „Lulu“ aufgeführt wurde, zwar jedesmal in anderer Weise, aber stets zufriedenstellend gelöst wurde. Alban Bergs in Wien lebende Witwe hat nämlich eine Komplettierung des unvollständigen 3. Aktes durch eine fremde Hand untersagt — und die Praxis gibt ihr recht.
Ein anderes berühmtes Fragment (um auf der Opernbühne ' zu verweilen) ist Puccinis „Turandot“. Bis in seine letzten Tage rang der schwerkranke Komponist mit der grausamen Prinzessin, aber er konnte den von Adami und Simoni verfaßten Text nur bis etwa zur Mitte des letzten Aktes komponieren: genau bis zum Opfertod der Liu. In dieser Form, als Fragment, führte Toscanini anderthalb Jahre nach Puccinis Tod die Oper „Turandot“ am 24. April 1926 an der Mailänder Scala auf. Als die letzte Arie der Liu verklungen war, wandte er sich zum Publikum und sagte — wie es Puccini gewünscht hatte: „An dieser Stelle ist der Meister gestorben.“ Nach 36 nachgelassenen Skizzenblättern vollendete Puccinis Schüler Franco Alfano den letzten Akt, und man kann sägen, daß diese Rekonstruktion gut gelungen ist, auch wenn an einigen Stellen das Orchester mehr nach Richard Strauss als nach Puccini klingt.
Seit dem Tode des größten spanischen Komponisten des 20, Jahrhundertes, Manuel de Falla, im Jahre 1946 in Cordoba, das in der argentinischen Provinz Neuandalusien liegt, raunte und schrieb man viel von einem nachgelassenen Opernwerk „La Atlantida“ nach einem epischen Gedicht von Jacinto Verdaguer. Das versiegelte Fragment wurde, zusammen mit de Fallas Leichnam, von Cordoba nach Spanien übergeführt, die letzte Strecke auf einem spanischen Kriegsschiff, das in Cadiz landete. Man hörte mehr als 25 Jahre nichts von dem geheimnisvollen Fragment, nur so viel, daß es einem spanischen Komponisten zur Fertigstellung übergeben worden sei. Vor etwa zwei Jahren fand dann an der Scala die Premiere und während der Berliner Festwochen im Herbst 1962 die deutsche Erstaufführung statt. Nur zwei Szenen sind von de Falla fertiggestellt, das übrige hat der spanische Komponist und Schüler de Fallas, Ernesto Halffter, nach nur andeutenden Entwürfen ergänzt und dazukomponiert. Das Resultat ist ein nicht uninteressantes, stellenweise auch eindrucksvolles Werk. Darf man es jedoch unter de Fallas Namen auf führen?
Aber das gehört zum Wesen und zur Problematik des musikalischen Fragments. Entweder man läßt es unangetastet. Dann erschließt es sich nur dem kuhdigen Leser (im Konzertsaal oder im Opernhaus würde die Musik plötzlich oder allmählich verstummen ). Oder es wird komplettiert und rekonstruiert. Was man dabei in Kauf nehmen muß, haben wir anzudeuten versucht.