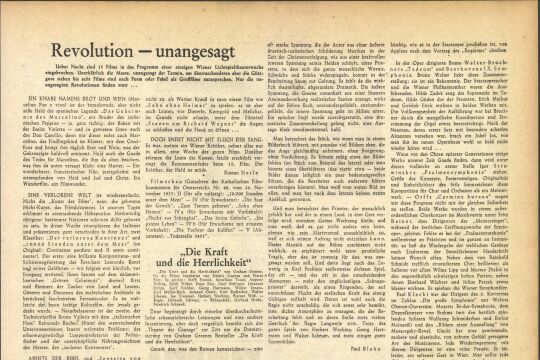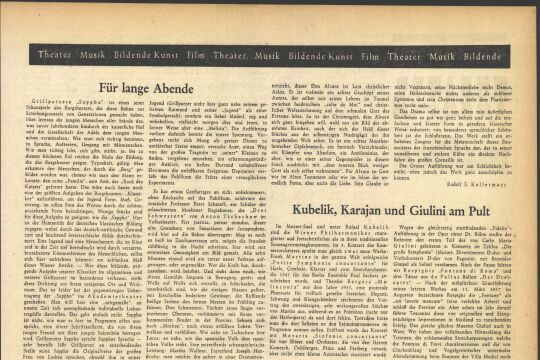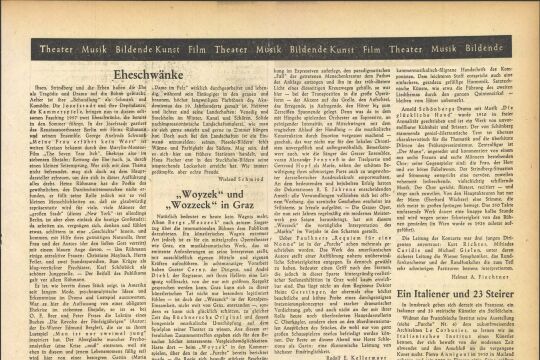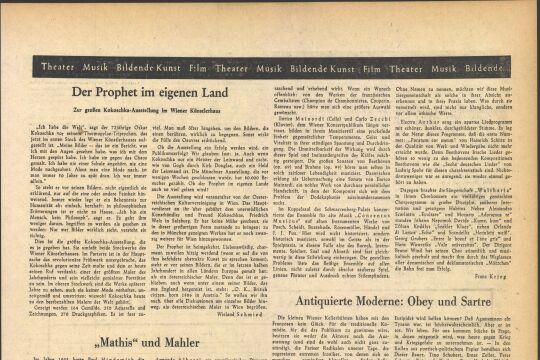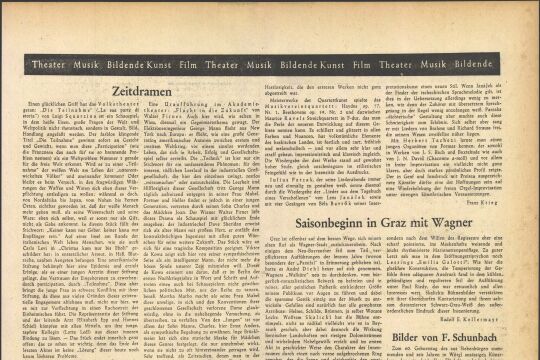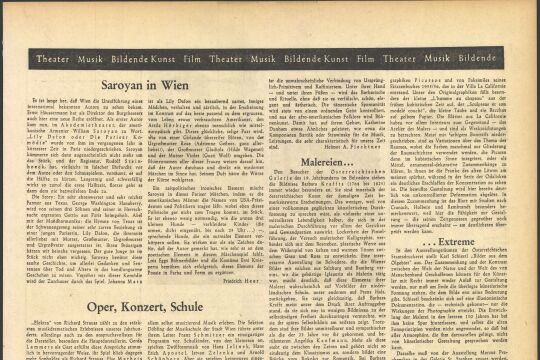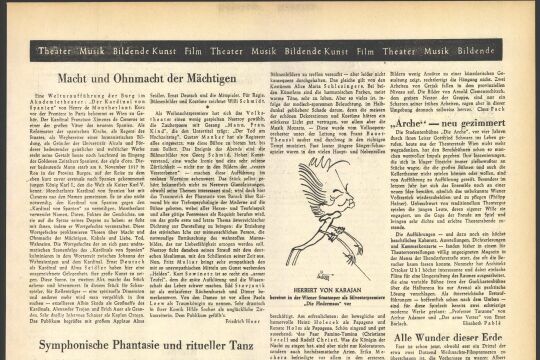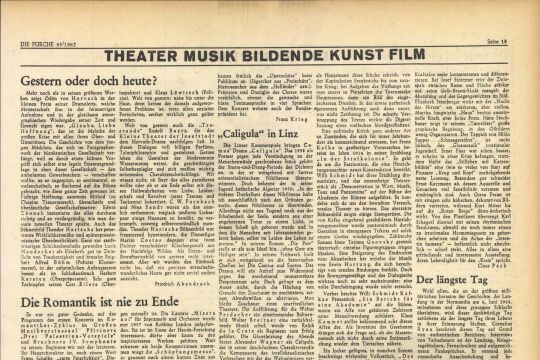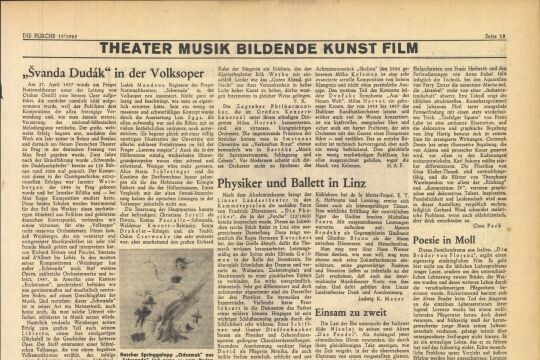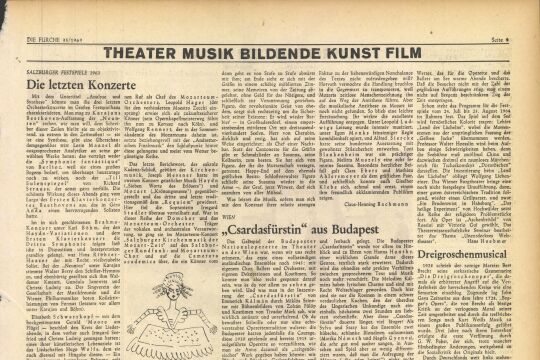Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Neue Salome und Bartök-Konzert
Nach der Premierenpleite gab ei in der Staatsoper zur Abwechslung einen höchst eindrucksvollen Repertoireabend, im Abonnement VIII. Gruppe. Die „Salome“-Inszenierung, die man am besten mit „ohne besondere Kennzeichen“ charakterisiert, empfing Glanz, Spannung und ein fast sensationelles Gepräge durch die schlimmverspielte Titelheldin, jene merkwürdige junge Dame, deren ausgefallene Neigung Interpreten und Kommentatoren immer wieder reizt und über deren Psychologie schon soviel Druckerschwärze geflossen ist. Sie hieß an diesem Abend Margaret T y n e s, kommt aus Amerika und soll gebürtige Indonesierin sein. So sah sie jedenfalls aus mit ihrer dunkelbraunen Hautfarbe und dem katzenhaft-gesohmeidigen Körper, den sie übrigens schon — nur mit einem Bikini bekleidet — in der ersten Szene an der Zisterne dem abweisenden und nur mit seinen Verfluchungen beschäftigten Jochanaan (und natürlich auch dem Publikum) darbietet. So — aber nicht so allein — vermochte die neue Salome zwar von den ersten Minuten an zu fesseln, nahm aber die Pointe, den Effekt des Schleiertanzes, vorweg. Ob sie sich das alles selbst ausgedacht hat oder einen Sonderregisseur hatte — oder ob sie das gar an einer anderen Bühne gelernt hat, was sie während der eineinhalb Stunden alles machte? Von der Wiener Regie hat sie es jedenfalls nicht, denn es war ganz ausgezeichnet, überlegt und logisch in jeder Geste, musikalisch — und. wirkungsvoll. Die Stimme der farbigen Mrs. Tynes ist von mittlerem Umfang und verliert in der Tiefe spürbar an Resonanz. Das Timbre ist angenehm, die Artikulation deutlich, ihre Aussprache des Deutschen erstaunlich. Secundo loco muß Herr Gerhard Stolze als Herodes genannt werden, ohne Tadel und intellligent singend, jeder Zoll ein Hysteriker. Neben ihm behaupteten sich vor allem stimmlich Regina Reznik als Herodias, weniger — mit einem etwas flachen Baßbariton — Robert Bruce Anderson in den unrettbar konventionellpathetischen Monologen des Jochanaan (für diese Sphäre hatte Strauss nichts auf seiner reichen Palette), und der makellos schön singende Anton Dermota als Narra-both. Berislav K1 u b u c a r gelang eine recht präzise und sensible Interpretation dieser differenzierten und komplizierten Partitur mit ihrem charakteristischen Nervenkontrapunkt.
Der Star des 4. Konzerts im Romantiker-Zyklus der Symphoniker unter Wolfgang S a w a 11 i s c h war die polnische Geigerin Wanda W i 1 k o m i r-s k a, die den anspruchsvollen und schwierigen Solopart von Bartöks 1938 in Budapest beendeten 2. Violinkonzert spielte. Frau Wilkomirska ist heute wahrscheinlich die beste Geigerin und eine der hervorragendsten Intetpretinnen neuer Musik. Ihre Präzision, ihr Ausdruck, ihre Intelligenz und ihre hohe Musikalität verbinden sich mit einem Temperament, das auch aus den sprödesten Stellen (deren es in diesem Konzert mehrere gibt) Feuer schlägt. Auch der Dirigent S a w a i 1 i s c h zeigte sich bei der Interpretation dieses Werkes, in dem ursprüngliche Kraft (eine aus den Wurzeln der Volksmusik kommende Kraft), kompositorische« Können und intellektuelle Ausgepichtheit eine einzigartige Synthese eingegangen sind, von einer neuen Seite. — Gleich der Beginn des Konzertes mit der symphonischen Dichtung „Don Juan“ von Richard Strauss, wenn die ersten Takte wie
Sektpropfen gegen die Decke geschleudert werden, ließ aufhorchen, und so brauste dies kraftgenialische Stück (aus dem Jahr 1889() vorüber: spannend, mit Elan und Temperament, wenn auch etwas lärmend gespielt. Webers Jugendsymphonie in C, in letzter Zeit vielfach als Ballettmusik verwendet, war eine Atempause, dann folgte, als Hauptwerk und Krönung des Konzerts, Bartöks Violinkonzert, bei dem sich auch das Orchester sehr hervortat.
Im Theater ander Wien gastierte (übrigens zum erstenmal in Wien) das Mozarteum-Orchester Salzburg mit einem reinen Mozart-Programm. Statt des plötzlich erkrankten Höfrats Prof. Paumgartirer leitete der Salzburger Opernehef Mladen Basic das Konzert, in dessen Mittelpunkt zwei Solistennummern standen, die von zwei Symphonien, der „Haffner“ und der „Linzer“, flankiert wurden. Die lebendige Mozart-Tradition ist unverkennbar, da ist alles richtig und authentisch, wenn auch nicht immer sehr beseelt und animiert. Graziella Sciu 11i sang drei Konzertarien : sehr korrekt, sehr anmutig und sehr hübsch im Ton. Was man ihrer Stimme wünschte, wäre ein Mehr an Leichtigkeit. Alfred Brendel spielte den Solopart des C-Dur-Klavierkonzertes (KV 503) ausdrucksvoll und intelligent, in bestem Mozart-Stil. Der offiziöse Charakter dieses Gastspiels wurde durch die Anwesenheit des ehemaligen Landeshauptmanns von Salzburg und des Vizebürgermeisters von Wien unterstrichen. Die Salzburger Gäste können mit ihrem Wiener Debüt zufrieden sein.
Das zur Feier seines 70. Geburtstages aufgeführte Oratorium „Die letzten Dinge“ von Joseph M e s s n e r nach der Dichtung von Angelus Silesius entstand in den Jahren 1928 bis 1931. Manche Kühnheiten der Harmonik und der Orchesterbehandlung sind inzwischen so allgemein in Gebrauch gekommen, ja, weit übertroffen worden, daß wir sie nicht mehr als solche empfinden. Immerhin gibt es noch Uberraschendes genug, beispielsweise die ganz unkonventionelle Auffassung der Verdammnis, die nicht in dramatischer Ausmalung der Höllenqualen, sondern in ewiger Vereinsamung und Verlassenheit gedeutet wird. Auch die Klarheit und Übersichtlichkeit des musikalischen Aufbaus ist einet VeTalterung nicht ausgesetzt, ebensowenig der mit einer großen Fuge einsetzende Aufschwung des letzten Teiles. Die Aufführung unter Hans Gilles-berger mit dem Wiener Kammerchor und dem Orchester des österreichischen Rundfunks, Radio Wien, war exakt und sehr gekonnt, litt allerdings durch die Piano-und schon gar Pianissimoferne des gewaltigen Orchesters. Besondere Leistungen boten die Solisten Antonia Fahberg, Claudia Hellmann, Lorenz Fehenberger (trotz spürbarer Indisposition) und Max Proebstl. Der Erfolg des Werkes war unbestritten, der Komponist bedankte sich gerührt.
An Stelle des erkrankten Knapperts-busch dirigierte Georges P r 4 t r e das Nicolai-Konzert der Wiener Philharmoniker mit Beethovens Coriolan-Ouverture, dem Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5, Fs-Dur, und der 5. Symphonie. Solist war Paul Badura-Skoda. Daß Pretre zum erstenmal ein philharmonisches Konzert dirigierte und dies als „Einspringet“, ohne die Voraussetzung der Probenvertrautheit, war nicht zu überhören, doch verstanden es beide Partner, au« der Not eine Tugend zu machen, und so entstand ein höchst ordentliches, wenn auch kein außerordentliches Konzert. Badura-Skoda wird (trotz seiner zarten Erscheinung) dem kraftvollen Vorwärtsstürmen Beethovens ebenso gerecht, ab seine Zartheit (Adagio) ausgesprochen männlichen Charakter hat.
In einem Konzert des Tonkunst-lerorchester« hörten wir nach Schuberts Rosamunden-Ouverture „Fünf Lieder aus letzter Zeit“ von Gustav M a h 1 e r und die 7. Symphonie von Anton Bruckner. Dirigent war Robert Heger. Die Mahler-Lieder, von denen besonders „Um Mitternacht“ (nur mit Bläserbegleitung) den nachhaltigen Eindruck tiefster Traurigkeit erweckt, sang Hilde K o n e t z n i mit großer, dennoch die gebrochenen Linien Mahlerscher Melodik sorgsam nachzeichnender Stimme. In der Bruckner-Symphonie zeigte sich das Orchester rhythmisch und dynamisch von exakter Disziplin und mit den Intentionen des Dirigenten vertraut, obwohl auch hier der überspringende Funke fehlte.
F. K.
Eine noch härtere Probe bestand das Niederösterreichische Tonkünstle r-Orchester einige Tage später im Großen Musikvereinssaal. Hier dirigierte Christoph von D o h n ä n y i
— nach der 6. Pariser Symphonie von H a y d n und dem d-Moll-Konzert von Mozart mit Alexander J e n n e r als Solisten
— de Fallas „Nächte in spanischen Gärten“ mit einem erstaunlichen, fast brillant zu nennenden Nuancenreichtum der orchestralen Farben, und als Schlußstück Bela Bartöks kühnstes, an grellen Dissonanzen reichstes, mit seinen barbarischen Rhythmen schok-kierendstes Werk, die Ballettmusik „D e r wunderbare Mandarin“. Die von Bartök selbst angefertigte Konzertsuite daraus hatte 1928 Ernö von Dohänyi, der Vater des Dirigenten, in Budapest uraufgeführt. Dieses Stück ist also gewissermaßen Familientradition, und Christoph von Dohnänyi mit den Tonkünstlern blieben der schwierigen Partitur nichts schuldig. Die sichere Schlagtechnik war ebenso zu bewundern, wie die Intensität und Vehemenz des Vortrags. Man sollte sich in der Staatsoper des jungen, vom Musikverein gewissermaßen entdeckten und mit immer schwierigeren Aufgaben betrauten Dirigenten erinnern, wenn das BartAk-Ballett wieder einmal auf den Spielplan kommt. H. A. F.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!