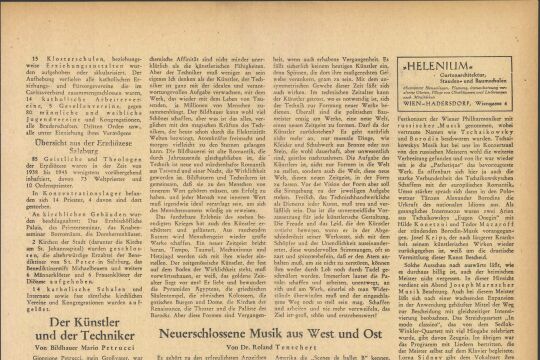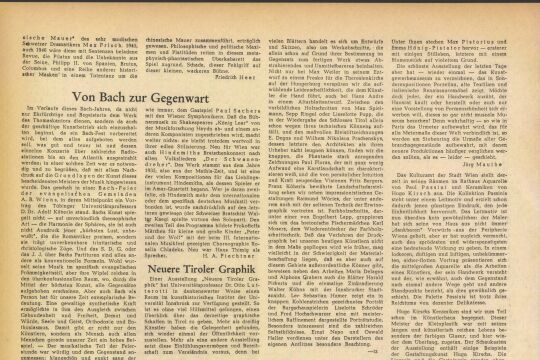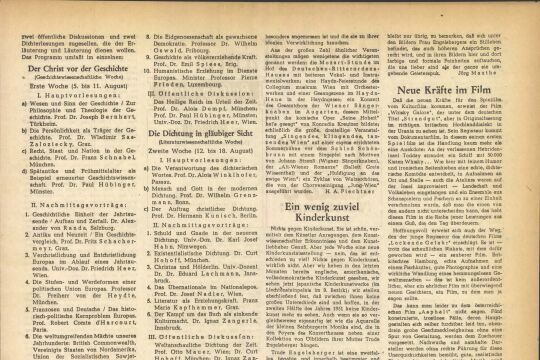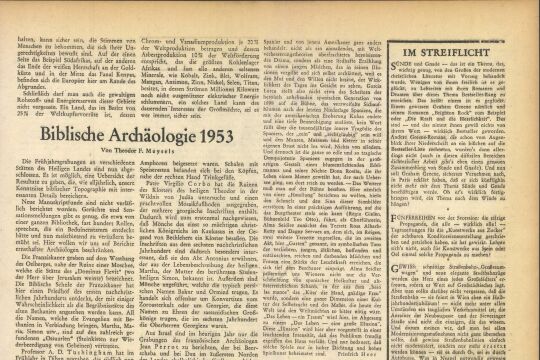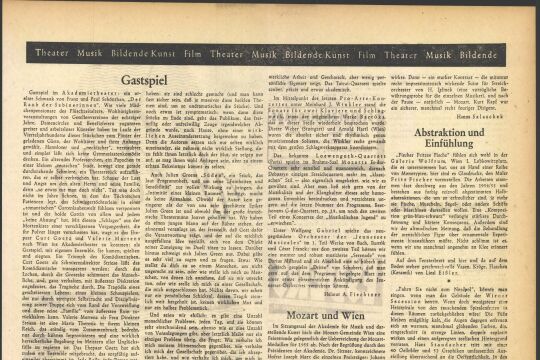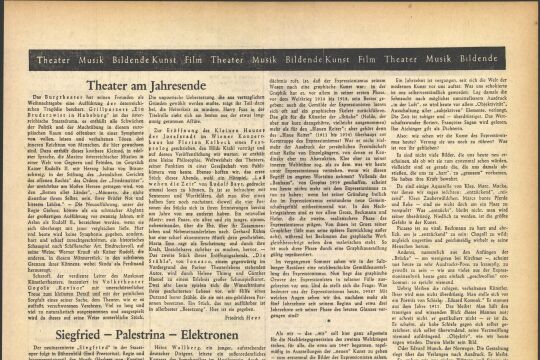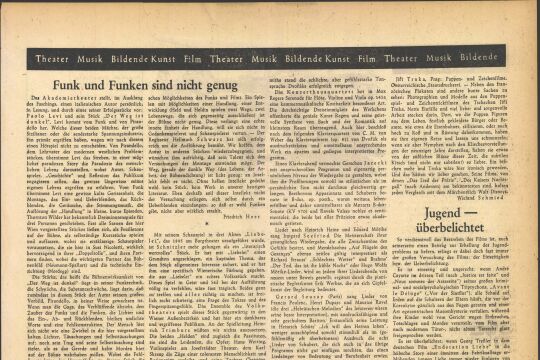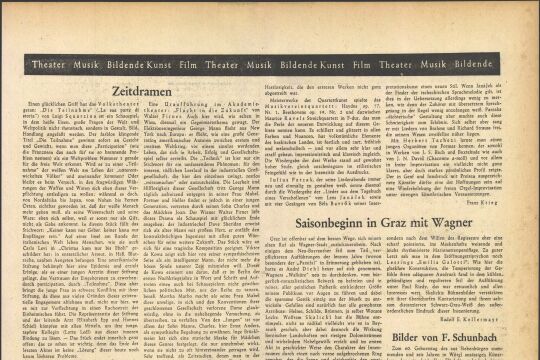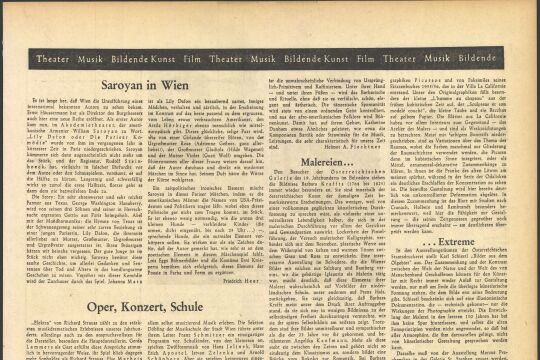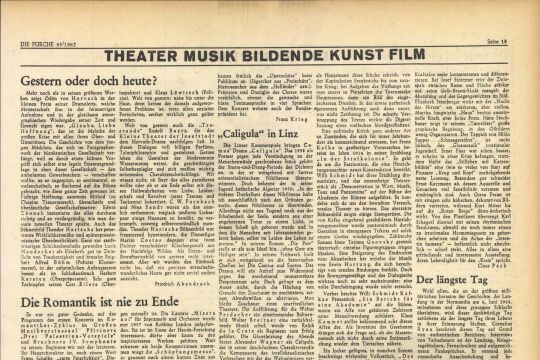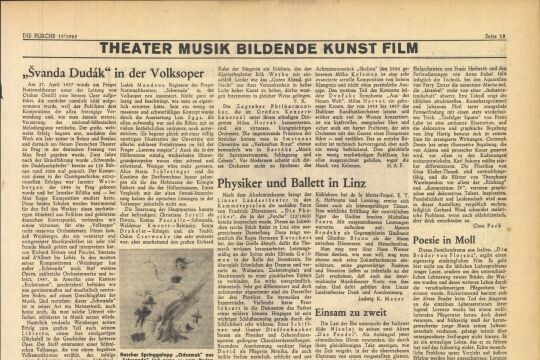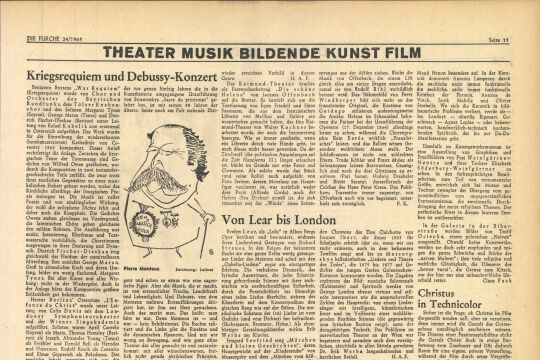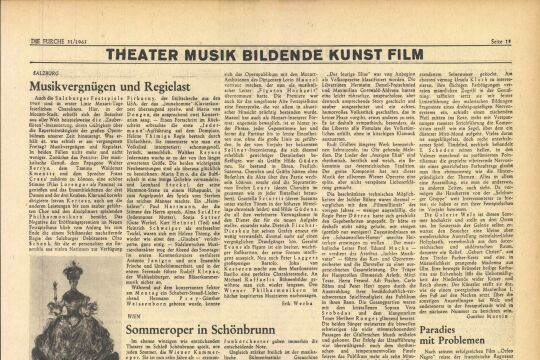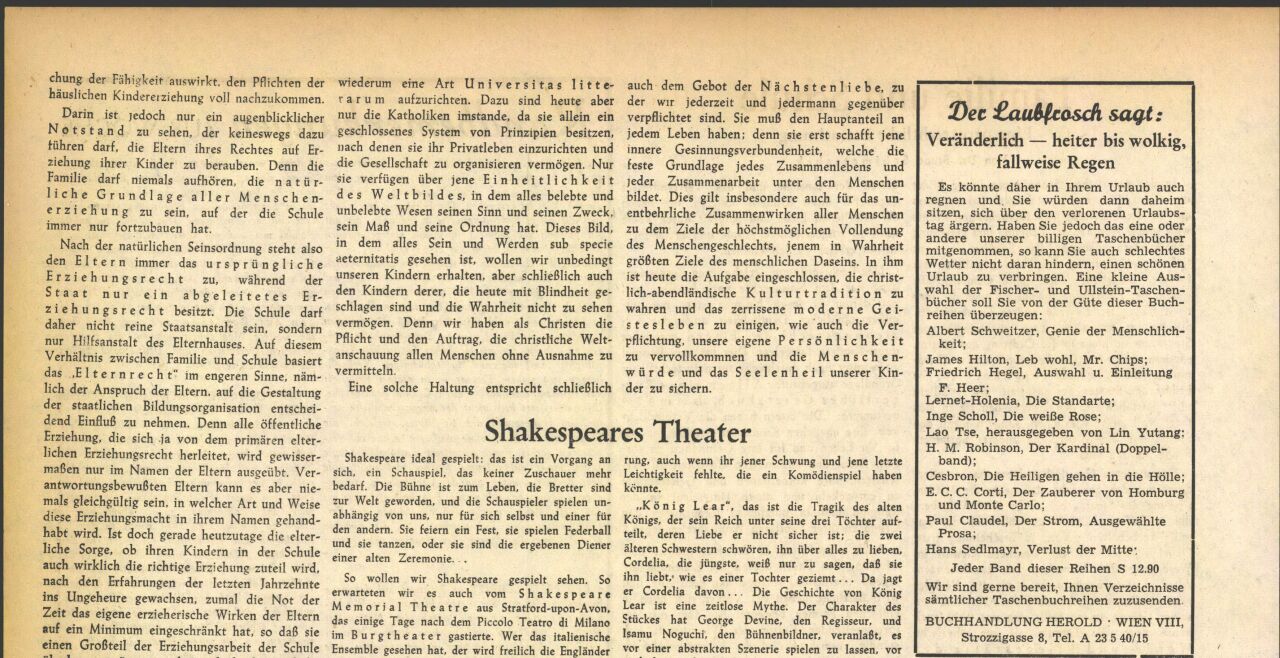
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Berliner Ballet und Solistenkonzerte
Knapp eine Woche, bevor das Ballett der Städtischen Oper Berlin sein Gastspiel in der Volksoper begann, absolvierten ebenda die Jugoslawen ihr drittes Programm, und erst an diesem Abend hatten wir an den Darbietungen unserer südöstlichen Nachbarn eine reine, ungeteilte Freude. Das Stück hieß „Das L e b z e 11 h e r z“, Musik und Libretto von K. Baranovic, Choreographie und Regie von D. Parlic. — Jahrmarkt in einem kroatischen Dorf (erstes und drittes Bild) und im Reich der Lebzeltfiguren: das ergab für Tänzer und Choreographen das rechte Sujet, den richtigen reizvoll-bunt ausgestatteten Schauplatz und Gelegenheit, sich in Volkstänzen und parodistischen Szenen auszuleben. Von den gleichen Autoren stammt auch die „Chinesische Erzählung“, deren Musik und Inszenierung freilich eher nah- als fernöstlich geraten waren. Aber auch bei diesem Ballett unterhielt man sich gut und hatte seine Freude an den talentierten, schönen und temperamentvollen Tänzern sowie an der musikalischen Leitung Oscar Danons.
Die Berliner zeigten dreimal das gleiche, aus drei Balletten bestehende, ein wenig überdimensionierte Programm. „L'I ndifferent“ oder „Der B i 1 d-r a u b“, eine heiter-phantastische Geschichte um das berühmte Gemälde von Watteau, war nicht nur im Sujet pariserisch. In der Art des neuen französischen Balletts hatten hier der Autor Otto Maag, der Regisseur und Choreograph H-inz Rosen sowie der Bühnenbildner und Kostümzeichner Max Bignens ein Stück mit einer reizenden Idee und vielen netten Details geschaffen Die Musik von Hans Haug ist freilich recht handfest, stilistisch fragwürdig und sehr wenig originell. In einem einleitenden Pas de d e u x nach Musik von Liszt zeigte die Meister-choreographin Tatjana Gsovsky, was auch heute noch aus den Elementen des klassischen Tanzes herauszuholen ist. Hier — und im Hauptwerk des Abends — brillierten die beiden jungen Tänzer Gisela D e e g e und Gert R e i n h o 1 m, die ihresgleichen an deutschen Bühnen heute wohl nicht haben, und zwar sowohl hinsichtlich ihrer Technik als auch in bezug auf Ausdruck, Beseelung und Wohlgeschaffenheit. „H a m I e t“ heißt das Meisterwerk, und Boris Blacher schrieb dazu eine faszinierende, theaterwirksame Musik, die neben dem Orchester auch einen Chor verwendet In Ensemble und Soloszenen, die einander abwechseln, hat Tatjana Gsovsky die Essenz der Shakespearschen Tragödie verdichtet und genial ins Tänzerische übertragen. Trotz sparsamster Dekorationen und weitgehend stilisierter“ Kostüme wirkt das Ganze nie abstrakt und erreicht in den großen Soloszenen Höhepunkte, wie man sie auf dem modernen Tanztheater selten erlebt. Neben den beiden Hauptrollenträgern seien wenigstens noch Michael Egner als König, Lilo Herberth als Königin und Rainer Köchermann als Laertes genannt. Reinhard Peters hieß der junge tüchtige Dirigent, der die Partitur Blachers zu eindringlicher Wirkung brachte.
Aus Hugo Wolfs zweiteiligem „Italien!-chen Liederbuch“ haben bisher Sängerinnen md Sänger die ihnen am besten liegenden Stücke aus-Tesucht. Dadurch ging seine innere Einheit verloren. Es ist zudem aus den Dichtungen ersichtlich, daß hier eine Frau und ein Mann sprechen, zweierlei Empfindungen, die sich fortschreitend entwickeln. Dr Erik W e r b a hat es mit Erfolg versucht, das Liederbuch nach Erlebnisinhalten zu gruppieren und einen Zwiegesang großen Stils daraus zu machen. Auf dem Podium stand Irmgard S e e f r i e d (von Werba in seiner unauffälligen, den kleinsten Regungen der Wolfschen Klaviersprache nachspürenden Art begleitet) — eine Sängerin, deren Stärke die stimmliche Charakteristik und das Denken in der Dichtung ist. Eine Sängerin, die aus Trotz, Spott und Schalkhaftigkeit die beseligende Wärme einer Liebe erwachsen ließ, die sich erfüllt sieht. Dieser Interpretin gegenüber: Dietrich Fischer-Dieskau (von Günther Weißenborn am zweiten Flügel begleitet) — ein Sänger, dessen Vorzüge trotz imponierenden Stimmvolumens und blendend eingesetzter Dynamik doch im rein Lyrischen, im Verhaltenen liegen. — Ein großer Abend im Mozart-Saal des Konzerthauses und ebensolche Begeisterung.
Eine aparte Auswahl neuer Orgelmusik bot Alois F o r e r im Saal des Funkhauses. Zwischen Hindemiths 1. Sonate und J. N. Davids Toccata und Choral („In dich hab ich gehoffet, Herr“) standen Ur- und Erstaufführungen von Kompositionen, deren Schöpfer sich auf anderen Gebieten bereits legitimiert haben. Erich M a r c k h 1 s Sonata über „Der grimmige Tod“ profiliert die ruhige, im Grunde bedächtige, aber feingliedrige Hand des Autors in durchaus eigenwilligen Zügen, die in ihrer Linearität weniger Breitenwirkung als subtile Geistigkeit erstreben und erreichen. Karl S c h i s k e s Variationen über ein eigenes Thema, op. 10, sind ähnlich, wenn auch blutvoller gestaltet. Zunehmende Prägnanz der Form und Vertiefung der Aussage, Schiskes große Ziellinie, ist hier durch die Eigenart des Instruments besonders begünstigt. Der großangelegten „Hymne d'Actions de graces“ (Te Dcum laudamus) von Jean L a n g I a i s, eigentlich Variationen über den gregorianischen Cantus, würde beides, Verknappung und Vertiefung, nach dem Muster des Chorals, zum größeren Vorteil gereichen
vor der vielfach rein klanglichen Ausdeutung. Frank Martins „Passacaille“ erweist sich in der Orgelfassung ungleich stärker als in der für Streichinstrumente und ist zweifellos die genialste Komposition dieses Programms, darin als zeitlich ältestes Werk die vier Choralvorspicle von Franz Schmidt figurierten. Forers Spiel ließ die Werke an sich, gleichsam ohne subjektive Stellungnahme des Interpreten, wirken. Was man ebenso bedauerte wie das Fehlen einer Orgelkomposition Anton Heillers im Programm, die es im entwicklungitnäßigen Sinne abgerundet hätte.
Claudio Arrau bewies die mit seinem Namen verbundene Vorstellung pianistischer Meisterschaft in einem Programm, dessen erste Hälfte (Mozart, Brahins und Beethoven) in der Tat zum Erlebnis wurde. Dies allerdings nicht im Sinne von Backhaus oder Gieseking. Wenn aber die Tiefenwirkung nicht immer ausgeschöpft war, gab es anderseits kristallklare Phrasur, Variabilität des Anschlags und Transparenz des architektonischen Aufbaus von staunenswerter Exaktheit, die sich im zweiten Teil an weniger interessante Kompositionen zerfließenderer Struktur verschwendete.
Der Geiger Zino Francescati spielte mit den Symphonikern unter Felix Prohaska die Violinkonzerte von J. S. Bach (a-moll), Paganini (D-dur, op. 6) und Brahms (D-dur, op. 77). Die zweifellos respektablen Eindrücke, die man bei seiner Auseinandersetzung mit Bach und Brahms gewann, wurden bei der schwächsten der Kompositionen, dem Paganini-Konzert, zum unbestrittensten Triumph des Interpreten. Hier konnte er sich ungehemmt von thematischen und gedanklichen Beziehungen ganz auf Klang und Ton allein beschränken und überschüttete die Zuhörer mit wahren Kaskaden von Läufen, Sprüngen und Trillern in absoluter Sauberkeit und ohne aller Nebengeräusche. Diese restlose Verklanglichung war das eigentliche Erlebnis des Abends.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!