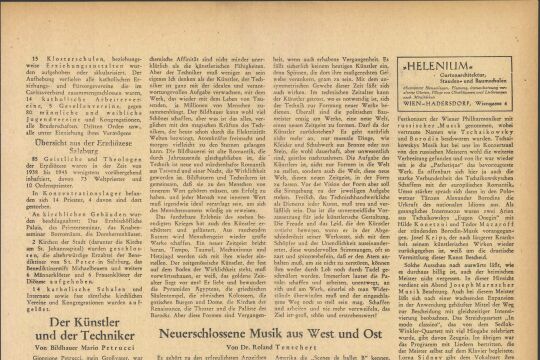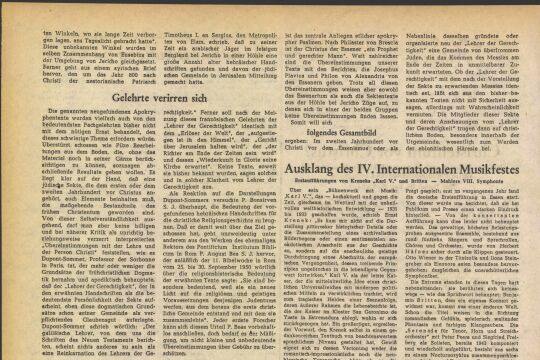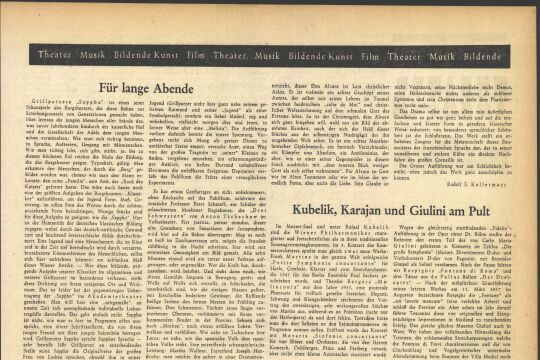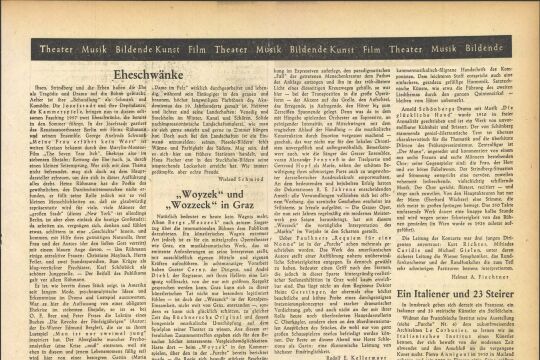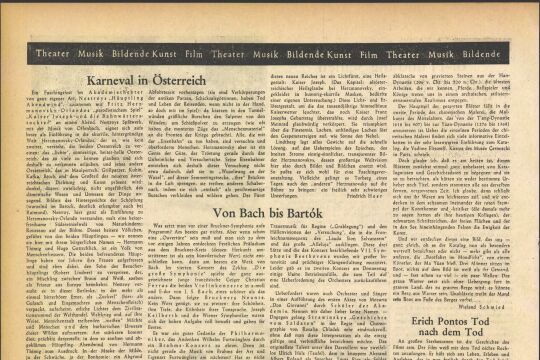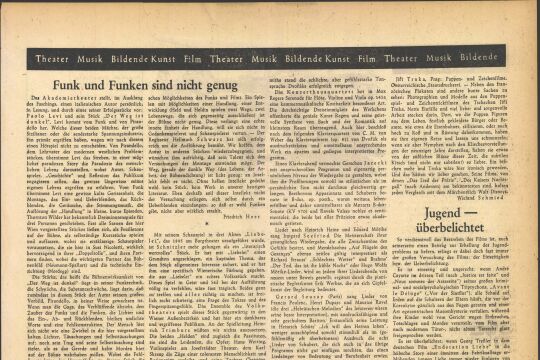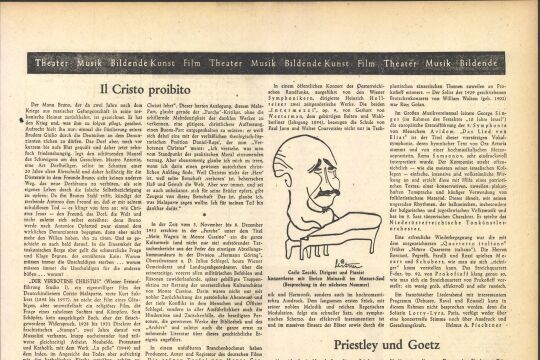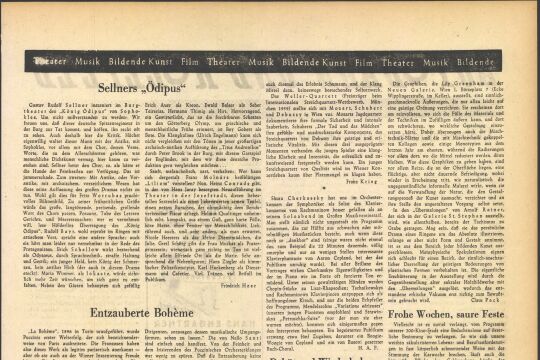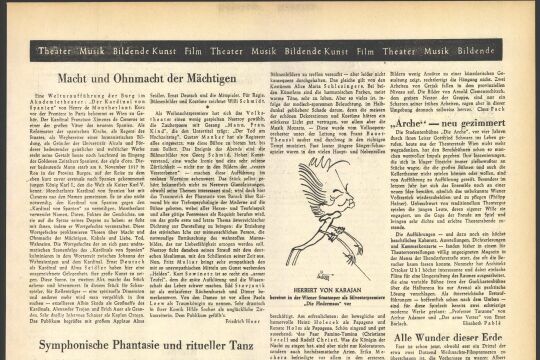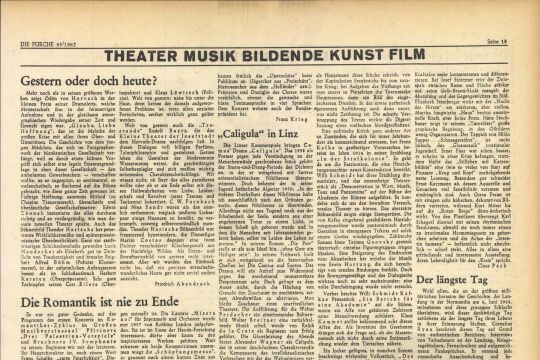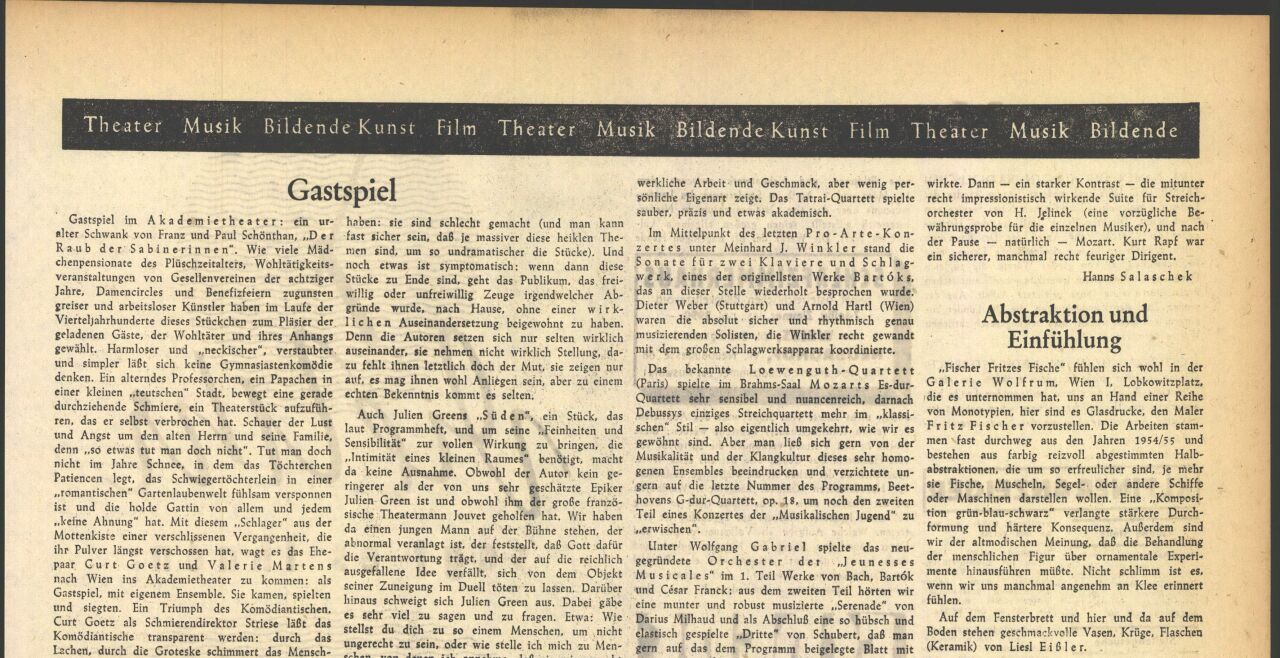
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Altslawische Messe von Leos Janacek
„Ich will den, Leuten zeigen, wie man mit dem lieben Gott zu reden hat“ und: „Ich wollte hier den Glauben an die Sicherheit der Nation auffangen, nicht auf religiöser Grundlage, sondern auf Grundlage des Sittlichen, Starken, das sich Gott zum Zeugen nimmt“ soll Janacek während der Arbeit an seiner Messe gesagt haben. Also ein sehr persönliches, nichtliturgisches Werk mit nationaler Tendenz. Leos Janacek, der schwermütig-eigenbrötlerische mährische Meister, hatte erst in seinen letzten Lebensjahren Erfolg. Dieser feuerte ihn zu einigen seiner bedeutendsten Werke an, zu denen auch die „M i s s,a Glagolskaja“ gehört, die Janacek im Jahr vor seinem Tode (1928) vollendete. Der Musiker Mährens wählte den alten kirchenslawischen Text, jene auch den Slawen kaum mehr verständliche Sprache, in der Cyrillus und Methodius, aus Bulgarien kommend, ihren Stammesbrüdern das Evangelium gepredigt hatten. Wie in seinem dramatischen Hauptwerk „Jenufa“ folgt auch hier die Komposition genau der Wortdeklamation. Um diese Messe auch für den Westen zugänglich zu machen, hat man den altslawischen Text ins Lateinische zurückübersetzt. Das mag für den Nordwestdeutschen Rundfunk notwendig sein, in Wien hätte man es vielleicht doch mit der Originalfassung versuchen können, zumal die vier hervorragenden Solisten von der Prager Oper gekommen waren, um bei der Aufführung durch den S i n g v e r e i n, die Symphoniker und Franz Schütz an der Orgel, unter der Leitung Joseph Keilberths, mitzuwirken. Eine kurze Orchestereinleitung ist charakteristisch für den ganzen Stil: keine symphonische Anlage, sondern Wiederholung oder Aneinanderreihung knapper, einprägsamer Motive; kräftige, gegeneinandergestellte Klangregister; folkloristisch gefärbte Melodik und festlich-freudige Grundhaltung. Den weltlichen Charakter betönt auch der letzte Satz (nach dem Agnus Dei), der merkwürdigerweise „Intrada“ überschrieben ist und mit Pauken und schmetternden Trompeten von der kirchlichen Feier' zu einem großen Volksfest überzuleiten scheint. — Die Musik Janäfeks ist erregend, interessant und originell in jedem Takt (da und dort erinnern einige Begleitfiguren an Bruckner); nur zwei Orgelund Orchestersoli wollen sich nicht recht in die Gesamtarchitektur einfügen. Veranstalter, Dirigent und alle Ausführenden sind für ihre Bemühung, dieses Werk der Vergessenheit zu entreißen, sehr zu loben. — Ebenso dankenswert war die Aufführung der (ebenfalls fast unbekannten) Vesperae solennes de confessore von Mozart, in deren zweitem und viertem Satz (Confitebor und Laudate) der Komponist dem strengen liturgischen Stil näher ist als in irgendeinem anderen seiner Werke.
Auch Raimund Weißensteiner spricht eine eigene Sprache. Sie wird aber leider, von Werk zu Werk, nicht nur immer härter, sondern auch monotoner. Das zeigt sich besonders in den Chaconne-und Variationensätzen, wo die Strenge zu Erstarrung und Dürre führt (im letzten Satz der IV. Symphonie und in den Phantastischen Choralvariationen über das „Dies Irae“ von 1955). — Wegen der häufiger wechselnden „Stimmungen“ und Ausdrucksbewegungen ist das „Te Deum“ leichter zu hören. Von den drei beim letzten Kompositionskonzert unter der Leitung Weißensteiners aufgeführten Werken geben wir den drei ersten Sätzen der IV. Symphonie von 1941, die an dieser Stelle bereits besprochen wurde, den Vorzug. Es sang der Staatsopernchor, es spielten die Wiener Symphoniker.
Am 25. März dieses Jahres wäre Bela B a r 16 k 75 Jahre geworden. Aus diesem Anlaß gab das Budapester Tatrai-Quartett ein Konzert im Brahms-Saal, in welchem nach dem kühnen und eigenwilligen II. Streichquartett des Gefeierten drei Werke anderer ungarischer Komponisten gespielt wurden. Rezsö S u g a r und Päl J ä r d ä n y i, der eine 1919, der andere 1920 geboren, haben beide bei Kodäly Komposition studiert, sind erst nach 1945 hervorgetreten, haben beide den Erkel- und den Kossuth-Preis erhalten und bekennen sich zur folkloristischen Richtung. Aber ihr Folklorismus ist gefälliger, unverbindlicher als der des großen Bart6k. Zwischen den beiden Generationen steht Laszlö Lajtha (geboren 1892), dessen Streichquartett, wie die der beiden jüngeren, gute handwerkliche Arbeit und Geschmack, aber wenig persönliche Eigenart zeigt. Das Tatrai-Quartett spielte sauber, präzis und etwas akademisch.
Im Mittelpunkt des letzten Pro-Arte-Kon“ zerles unter Meinhard J. Winkler stand die Sonate für zwei Klaviere und Schlagwerk, eines der originellsten Werke B a r t ö k s, das an dieser Stelle wiederholt besprochen wurde. Dieter Weber (Stuttgart) und Arnold Hartl (Wien) waren die absolut sicher und rhythmisch genau musizierenden Solisten, die Winkler recht gewandt mit dem großen Schlagwerksapparat koordinierte.
. Das bekannte Loewenguth-Quartett (Paris) spielte im Brahms-Saal Mozarts Es-dur-Quartett sehr sensibel und nuancenreich, darnach Debussys einziges Streichquartett mehr im „klassischen“ Stil — also eigentlich umgekehrt, wie wir es gewöhnt sind. Aber man ließ sich gern von der Musikalität und der Klangkultur dieses sehr homogenen Ensembles beeindrucken und verzichtete ungern auf die letzte Nummer des Programms, Beethovens G-dur-Quartett, op. 18, um noch den zweiten Teil eines Konzertes der „Musikalischen Jugend“ zu erwischen“.
Unter Wolfgang Gabriel spielte das neugegründete Orchester det „Jeunesses Musical es“ im 1. Teil Werke von Bach, Bartök und Cesar Franck; aus dem zweiten Teil hörten wir eine munter und robust musizierte „Serenade“ von Darius Milhaud und als Abschluß eine so hübsch und elastisch gespielte „Dritte“ von Schubert, daß man gern auf das dem Programm beigelegte Blatt mit einer etwas phrasenreichen Ankündigung des Jeu-nfsses-Orcheiiers verzichten könnte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!