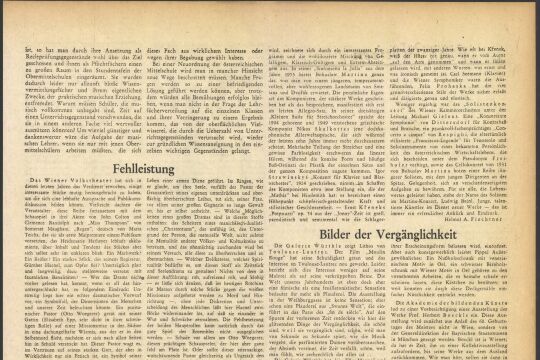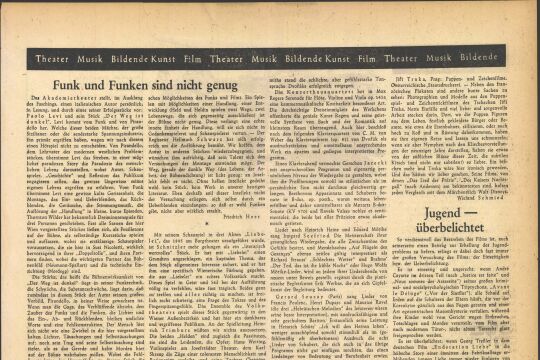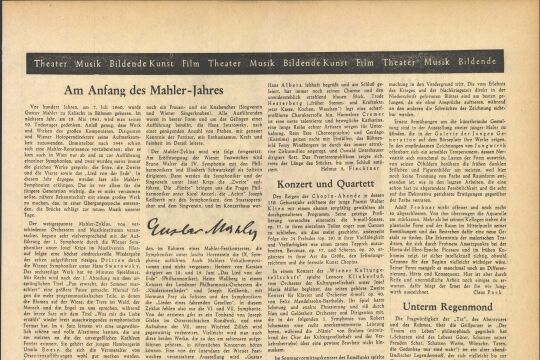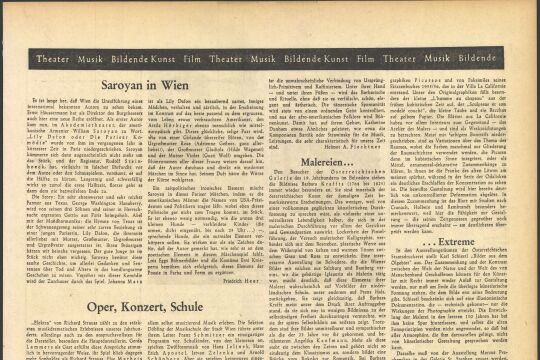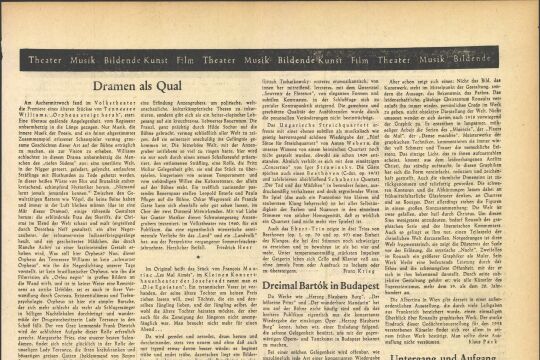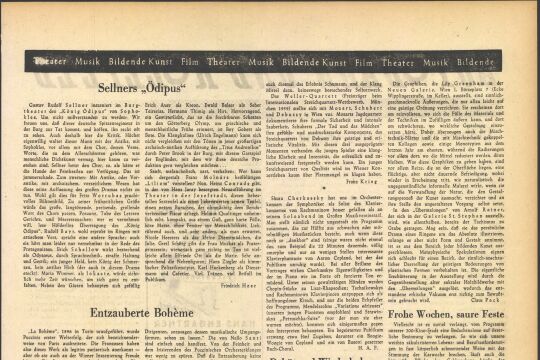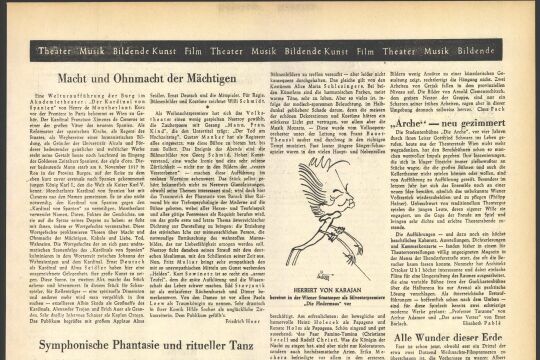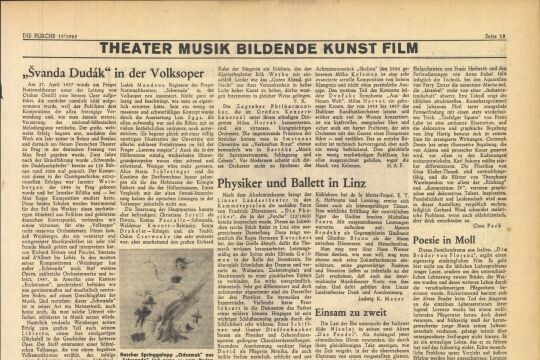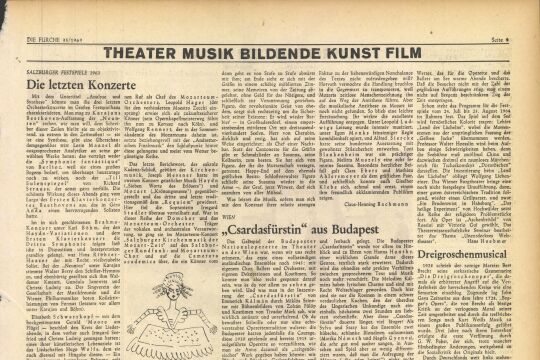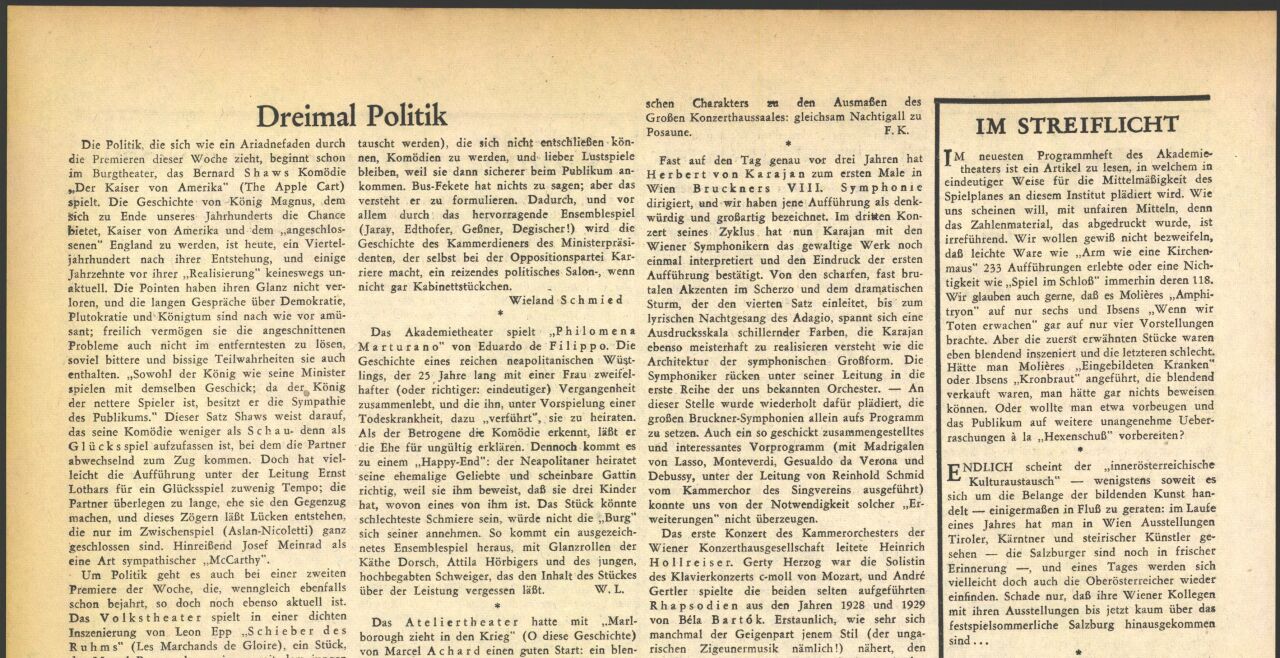
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Meisterleistungen und Gesellenstücke
„Zwischen Beethoven und der Sonatenform bestand eine prästabilierte Harmonie“, schrieb Romain Rolland in seinem Beethoven-Buch. Wenn jemand ein besonderes Gefühl für diese prästabilierte Harmonie mitbringt und Beethoven einmal objektiv aus dem strengen Geist der Form zum Klingen bringen kann, dann ist es Friedrich Gulda, der an seinem zweiten Beethoven-Abend im Großen Musikvereinssaal die Sonate op. 7 Es-dur sowie die drei Sonaten aus op. 10 — die c-moll-, F-dur- und die herrliche D-dur-Sonate mit dem berühmten „Largo e mesto“ — spielte und damit den einen Weg beschritt, der zur und in die Welt Beethovens führen kann. (Es gibt auch den anderen der kongenialen Einfühlung!)
Die strenge Werktreue, die über alle technischen Schwierigkeiten siegende Meisterschaft seiner Hände, die oft herbe Enthaltsamkeit im Ausdruck, die immer wieder in der Gestaltung der langsamen Sätze auffällt, ließen vor den Ohren der Hörer den jungen Beethoven erstehen, der auf dem Weg zur „Appassionata“ und mit diesen Meisterwerken und seinem Schicksal noch nicht zufrieden ist, während wir uns vor seiner Größe neigen.
Daß diese Art der Interpretation auch zu einer mißverständlichen — um nicht zu sagen verfälschenden — Auffassung des Komponisten führen kann, bewies seine Interpretation der „Pathe-tique“ (Sonate op. 13 c-moll), deren erster, von Beethoven bewußt mit „theatralischem Pathos“ be-ladener Satz, nicht so völlig ohne Pathos gespielt werden darf. Die Leere des zweiten Satzes und die virtuose, durch das überschnelle Tempo bewirkte Mechanik des Rondosatzes konnten ebenfalls nicht befriedigen. Hingegen erwies sich die Werktreue Gestaltung der übrigen Stücke des dritten Abends, an dem Gulda die beiden Sonaten aus op. 14 r(E-dur und G-dur), die g-moll-Sonate op. 49 und die prachtvolle B-dur-Sonate op. 22 spielte, als durchaus berechtigt und wurde entsprechend bedankt. Dr. Viktor S u c h y
Der Klavierabend Wilhelm Backhaus'. Werken Franz Schuberts gewidmet (unter Mitwirkung des Wiener Konzerthausquartetts und Josef Hermanns), rundete sich in der großartigen Wiedergabe der „Wanderer-Fantasie“ zu einer Meisterleistung, die in ihrer stilistischen und dynamischen Ausgewogenheit ohne Beispiel dastehen dürfte. Das übrige Programm, einschließlich des Forellen-Quintetts, litt trotz aller Vorzüge der Interpretation an dem akustischen (und stilistischen) Mißverhältnis des kammermusikalischen Charakters zw den Ausmaßen des Großen Konzerthaussaales: gleichsam Nachtigall zu Posaune.
Fast auf den Tag genau vor drei Jahren hat Herbert von Karajan zum ersten Male in Wien Bruckners VIII. Symphonie dirigiert, und wir haben jene Aufführung als denkwürdig und großartig bezeichnet. Im dritten Konzert seines Zyklus hat nun Karajan mit den Wiener Symphonikern das gewaltige Werk noch einmal interpretiert und den Eindruck der ersten Aufführung bestätigt. Von den scharfen, fast brutalen Akzenten im Scherzo und dem dramatischen Sturm, der den vierten Satz einleitet, bis zum lyrischen Nachtgesang des Adagio, spannt sich eine Ausdrucksskala schillernder Farben, die Karajan ebenso meisterhaft zu realisieren versteht wie die Architektur der symphonischen Großform. Die Symphoniker rücken unter seiner Leitung in die erste Reihe der uns bekannten Orchester. — An dieser Stelle wurde wiederholt dafür plädiert, die großen Bruckner-Symphonien allein aufs Programm zu setzen. Auch ein so geschickt zusammengestelltes und interessantes Vorprogramm (mit Madrigalen von Lasso, Monteverdi, Gesualdo da Verona und Debussy, unter der Leitung von Reinhold Schmid vom Kammerchor des Singvereins ausgeführt) konnte uns von der Notwendigkeit solcher „Erweiterungen“ nicht überzeugen.
Das erste Konzert des Kammerorchesters der Wiener Konzerthausgesellschaft leitete Heinrich H o 11 r e i s e r. Gerty Herzog war die Solistin des Klavierkonzerts c-moll von Mozart, und Andre Gertler spielte die beiden selten aufgeführten Rhapsodien aus den Jahren 1928 und 1929 von Bela B a r 16 k. Erstaunlich, wie sehr sich manchmal der Geigenpart jenem Stil (der ungarischen Zigeunermusik nämlich!) nähert, den Bartok so sehr perhorreszicrte und als unecht bekämpfte. Der Orchesterpart freilich spricht einen anderen, härteren Dialekt. So ergeben sich höchst reizvolle, aber nicht immer ganz homogene Mischungen. Hier wie in der P u 1 c i n e 11 a -Suite Strawinskys zeigte sich Heinrich Hollreiser mit seiner sicheren, suggestiven Schlagtechnik als worbildlicher Interpret neuer Musik.
Sechs Orchesterwerke von sechs jüngeren österreichischen Komponisten wurden im großen Sendesaal der R a v a g unter der Leitung von Karl E 11 i durch das große Rundfunkorchester uraufgeführt. Kein Wort gegen solche wohlgemeinte Förderung, auch wenn man die präsentierten Kompositionen nur als Gesellenstücke gelten lassen kann. So vor allem Walther Nußgrubers „Opus 2 für großes Orchester“, die „Variationen über ein Schubert-Thema“ von Horst E b e n h ö h und eine Passa-caglia von Rudolf P o 1 z e r. Ihre Harmonik ist von vorgestern und den Themen fehlt das persönliche Profil. — Als Gattung und im Klanglichen interessanter ist Robert Kühbachers „Orchesterstudie Nr. 6“. Anton Püringers melodische und instrumentale Einfälle sind einfach, aber plastisch, nur der Solopart seines Kammerkonzerts für Cembalo, Streicher und kleines Orchester wirkt dürftig. Karl M. Brandstetter schoß mit einem Ballettstück „Alla Turca“ den Vogel ab. Er musiziert mit einem großen Orchester robust, lautstark und unbekümmert drauflos, holt seine Effekte von Strawinsky, Gershwin, Chatschaturian, und schafft zumindest etwas Lebendiges, wenn auch noch kein Meisterwerk. — Allen diesen jungen Komponisten aber, die sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen haben, tut nichts mehr not, als ein tüchtiger, womöglich selbst schöpferischer und strenger Lehrer.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!