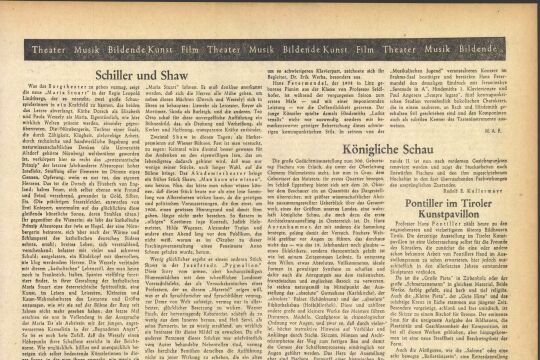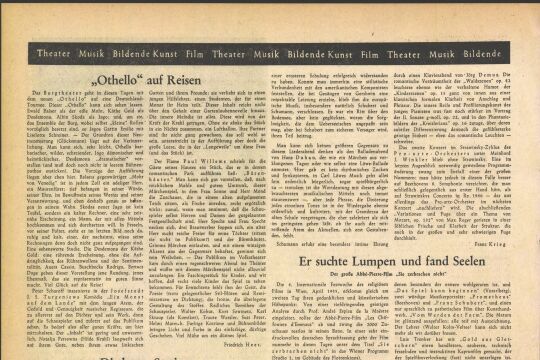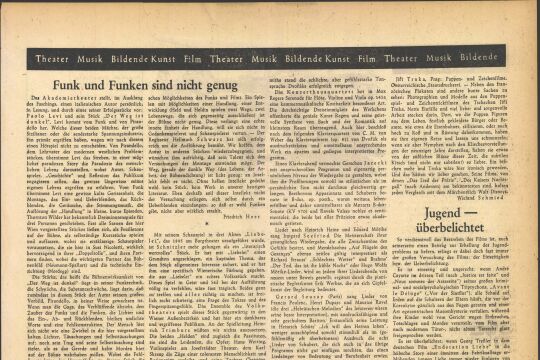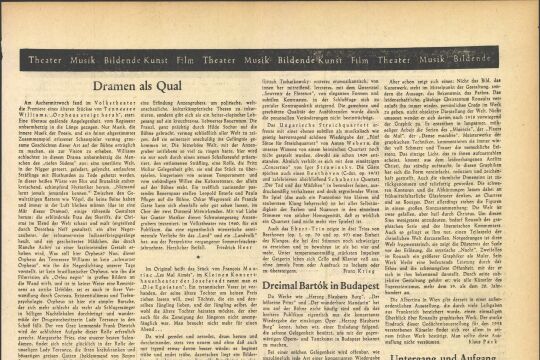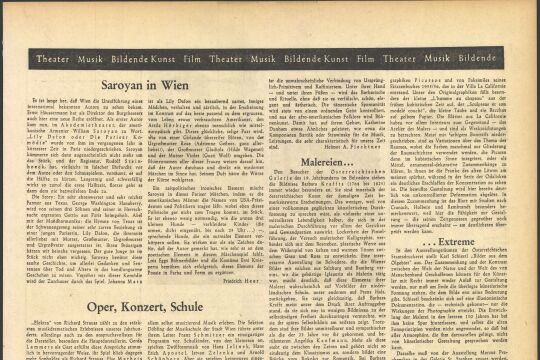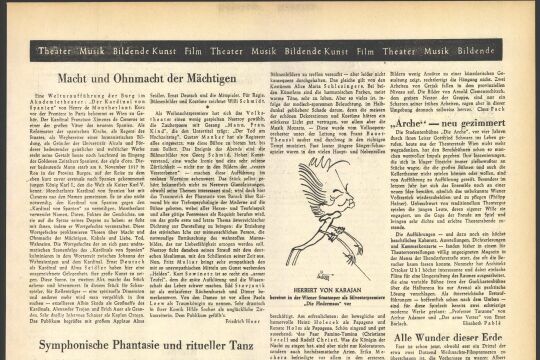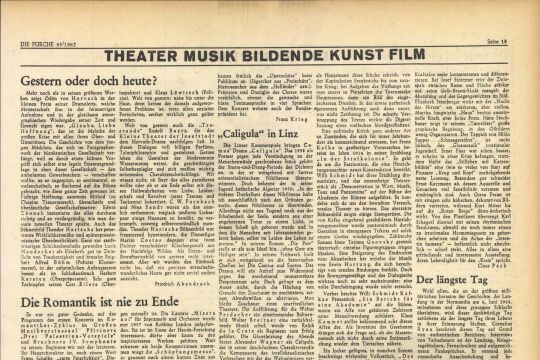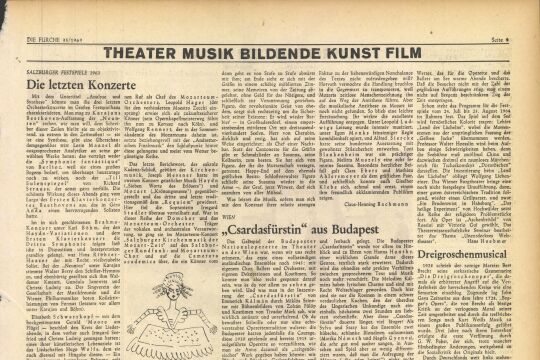Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Opernball“ und Hindemith-Konzert
Die Wiederaufnahme der Operette „D e r Opernball“ von Richard Heuberger in der Wiener Volksoper stützte sich auf die vor rund zehn Jahren durch O. F. Schuh vorgenommene Inszenierung; Karlheinz Haberland hat sie, mit noch mehr Bedacht auf die Atmosphäre des Stücks, recht geschickt erneuert. Dem entsprach auch die musikalische Leitung durch Anton P a u 1 i k. Das ganze Stück steht jetzt noch mehr als früher einer Kammeroper nahe, die Heiterkeit wirkt recht gedämpft, selbst dort, wo die Akteure den Versuch machten, auszubrechen und Glanzlichter aufzusetzen, und wo die hübsche Balletteinlage von Dia Luca Schwung und Laune in die Szene brachte. Es ließ sich aber doch der leichte Staub, der über dem Stück liegt, das dem Lebensgefühl einer vergangenen Zeit näherstand als dem der Gegenwart, nicht ganz wegblasen, trotzdem mit dem traditionellen Herzensbrecher Fred Liewehr, mit der köstlichen Type, die Karl Dönch zeichnete, mit der attraktiv wirkenden Esther Rethy und der flotten Guggi Löwinger als Marinekadett, dem eleganten Bonvivant Peter Minich gute Darsteller am Werke waren.
Der Bruck n e r - Z y k 1 u sim M u sik verein wurde mit der „Achten“, dirigiert von Wolfgang S a w a 11 i s c h, eröffnet. Diesem großen Werk; das im gleichen Saal einstens in der Urfassung Furt-wängler zum ersten Male vorstellte, ging die Tiefendimension wegen der zuweilen effektbetonten Akzente durch den Dirigenten ab: man merkte die Absicht. Dieser Gesamteindruck wurde nur durch die ausgezeichnete Leistung der Wiener Symphoniker, die an diesem Sonntag ihr 60jähriges Jubiläum feierten, der Sphäre des Nacherlebens nahegerückt.
An zwei Abenden spielte Isolde A h 1 g r i m m im Mozart-Saal des Konzerthauses das „Wohltemperierte Klavier“ von J. S. Bach auf dem Cembalo. Sieht man davon ab, daß der Cembaloklang nur in einem entsprechend dimensionierten Barockraum ordentlich zur Geltung kommen kann, so wurde hinsichtlich der Werktreue ein Maximum an Beständigkeit durch beide Abende erzielt, die Proportionen der Präludien und Fugen überzeugten überall, auch dort, wo hart an die Grenze der unpersönlichen Objektivität gegangen wurde. H. S.
Im Großen Sendesaal des österreichischen Rundfunks leitete Paul Hindemith, gewissermaßen zur Vorfeier seines 65. Geburtstages, ein Chor-Orchesterkonzert, das auch im II. Programm übertragen wurde. Die Vortragsfolge war ein Bekenntnis zum Altmeisterlichen und zur religiösen Thematik: im 1. Teil Händeis „Concerto grosso“ F-dur und die Kantate „Herzlich lieb hab' ich Dich, o Herr“ von Buxtehude; im 2. Teil ein eigenes Werk und Anton Heillers „Te Deum“ von 1953 in der Fassung für Bläser, Pauken, Orgel und Chor. — Knüpft Heiller an den Gregorianischen Choral und die modale Harmonik, so basiert H i n d e m i t h s Kantate „Apparebit repentina dies“ für gemischten Chor und zehn Blechbläser deutlich auf der Polyphonie (Fugato und 15strophige Passacaglia) und der tonälen Harmonik der Barockmeister. Den Text, eine holzschnittartige Schilderung des Weltgerichts am Jüngsten Tag, fand der Komponist im Oxford-Buch, einer lateinischen Gedichtsammlung aus dem 7. Jahrhundert. Die Tonsprache, herb und stilisiert, ist dem Text angemessen und bleibt im Ohr. (Die Wiener Erstaufführung fand vor zehn Jahren unter der Leitung des Komponisten im Konzerthaus während des Internationalen Bach-Festes statt.)
Hauptwerk des 2. Konzerts im Zyklus „D i e große Symphonie“ war Franz Schmidts „Vierte“, zweifellos das bedeutendste Werk des Wiener Meisters, von echtem symphonischem Atem erfüllt und getragen, einheitlich in der Stimmung (wenn auch nicht in der thematischen Erfindung) und unter der Leitung von Heinz W a 11 b e r g prachtvoll klingend. — Beim virtuosen und tonschönen Spiel des Orchesters erinnerte man sich auch daran, daß die Wiener Symphoniker seinerzeit, vor 25 Jahren, unter Oswald Kabastas Leitung das bedeutende Werk erstaufgeführt haben. — Im Mittelpunkt des Programms stand B a r t 6 k s (zweites) Konzert für Violine und Orchester, dessen umfangreichen, mit enormen Schwierigkeiten gespickten Solopart die junge deutsche Geigerin Edith Peine mann hervorragend meisterte. Was ihr — und auch dem Dirigenten — ein wenig fehlt, ist jene Oberflächensensibilität, die auf den kaleidoskopischen Wechsel der Stimmungen und Farben in dieser differenzierten Partitur blitzschnell reagiert. — Eingeleitet wurde das Konzert mit einer der schönsten Haydn-Sym-phonien, der sechsten „Londoner“ in B-dur, deren Interpretation man als „ohne besondere Kennzeichen“ werten muß. — Langanhaltender, verdienter Beifall für die tüchtige Geigerin, für Orchester und Dirigent nach der Schmidt-Symphonie. H. A. F.
Das Klassische Gulda-Orchester, dirigiert von Paul Anger er, spielte Schuberts B-dur-Symphonie (Nr., 5) und Mozarts Adagio und Fuge für Streicher c-moll (KV 546) und — mit Friedrich G u 1 d a als Solisten — die beiden Klavierkonzerte von Mozart (G-dur, KV 453) und Beethoven (B-dur, Nr. 2, op. 19). Programm und Ausführung waren dem Geist der frühen Klassik gewidmet, die vollkommene Beherrschung der Form und Eleganz des Spieles mit — besonders in den langsamen Sätzen — durchbrechendem menschlichem Ausdruckswillen verbindet. Das edle Gleichmaß der Form fand in der Wiedergabe beste Spiegelung, insbesondere im Solospiel Guldas, das selber in immer stärkerem Maße inneres Gleichgewicht und formale Ausgewogenheit gewinnt.
Ähnliches ist vom Zusammenspiel des Genser-Winkler-Trios (Violine, Cello, Klavier) zu sagen, das im Trio von Schuberts Es-dur, op. 100, eine vorbildliche Leistung bot und in den kurzen, sehr kontrastierenden, musikantisch vollsaftigen 5 Pieces breves von Martinu auch der zeitgenössischen Musik den schuldigen Tribut zollte. (In Mozarts Trio B-dur, KV 502, war die Ausgeglichenheit nicht ganz gelungen, die Streicher zu sehr im Schatten des Klavierparts und dieser selbst nicht von der späteren Gelöstheit.) Das leider nicht sehr gepflegte Gebiet dreistimmiger Kammermusik aber hat im Genser-Winkler-Trio eines seiner besten Instrumente.
Friedrich W ü h r e r spielte vier der bekanntesten Beethoven-Sonaten (Waldsteinsonate, Les Adieux, Appassionata und op. 111) in seiner gewohnten kraftvollen und weitgespannten Kunst der Wiedergabe, die auch eine große Zuhörerschaft sogleich in Bann hält. Die versonnene Tiefe, überhaupt der lyrische Zug Beethovens gelingt ihm weniger, und manchmal wird der Eindruck der Härte vorherrschend, das Singende tritt gegen das Gestaltende zu sehr zurück, wodurch trotz vollkommenen Spieles im Schlußsatz der Sonate op. 111 manches offen blieb.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!