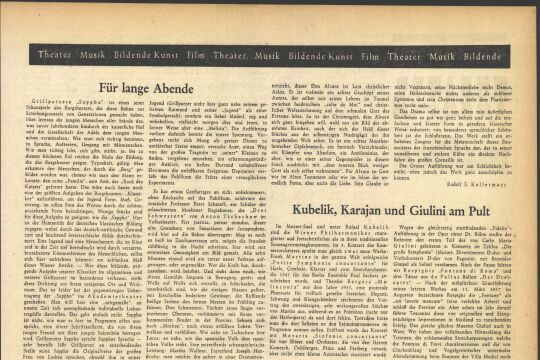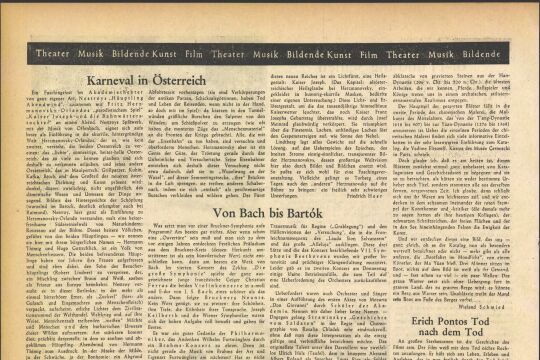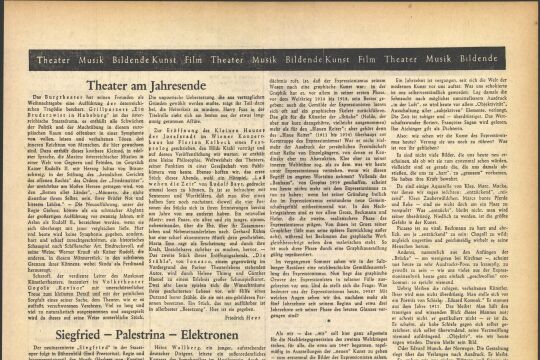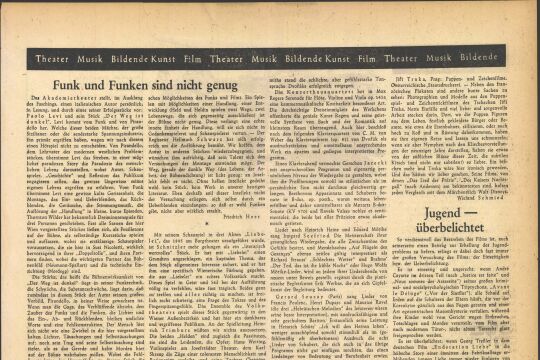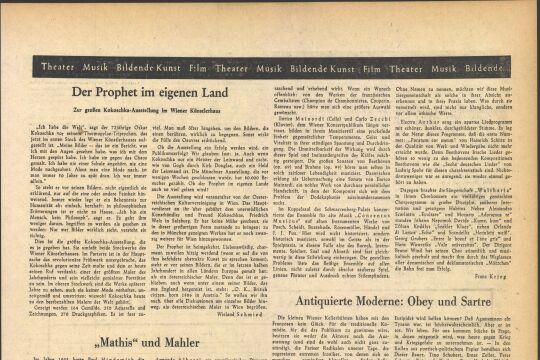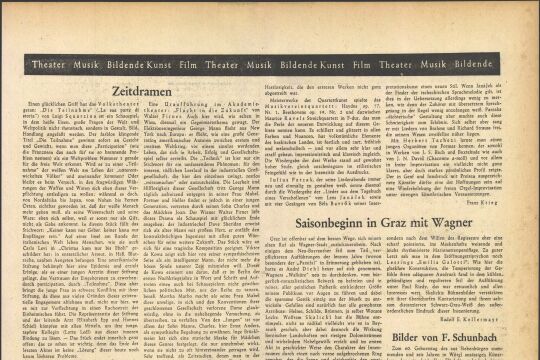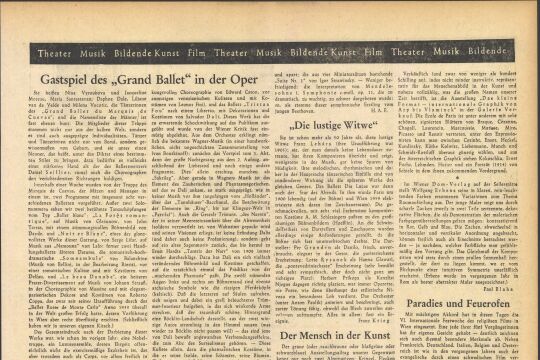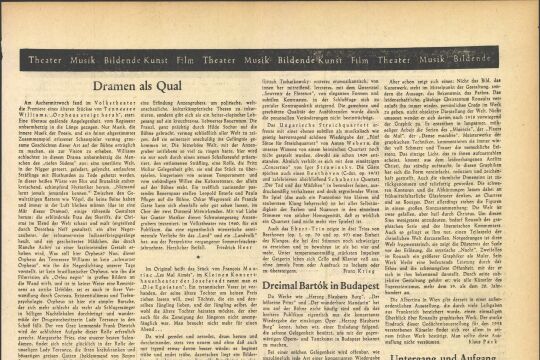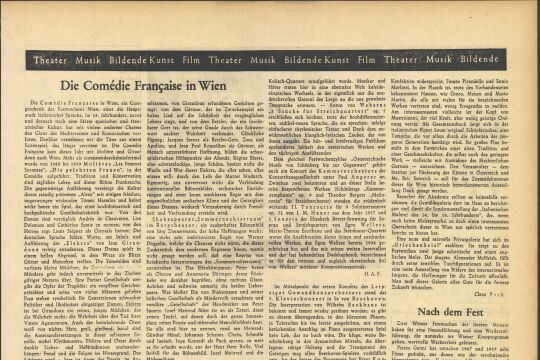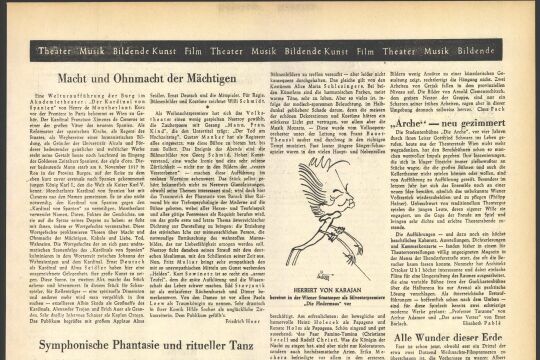Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Eröffnung der Spielzeit im Musikverein
Im ersten Konzert des Zyklus „Die große Symphonie“ dirigierte Joseph Krips Bruckners Siebente und schuf damit zweifellos gleich zu Beginn einen der Höhepunkte dieses ZyHus. Aufbau im Klanglichen wie im' GedanF liehen;“Wir'dem ersctetehder? Toförrg&BR in VkV heimgegangenen Richard Wagner, waren in aller Klarheit der ungeheuren Steigerungen nachgezeichnet, die Ausgewogenheit der Tonmassen wurde nie wankend, und gewiß hat Krips mit dieser Interpretation eine seiner reifsten Leistungen vorgestellt, die sein seltenes Erscheinen in Wien noch bedauerlicher macht. Der Bruckner-Symphonie voran ging das Konzert für Violine und Orchester op. 77 von B r a h m s mit Igor O i s t r a c h als Solisten. Dieses seinerzeit als „unspielbar“ bezeichnete Konzert erlebte hier eine Wiedergabe, die im schönsten Sinne aller Schwierigkeiten „enthoben“ war. Krips war ein idealer Begleiter, und das Orchester der Symphoniker allen Lobes wert. Oistrach, der sein Können auch in einem eigenen Sonatenabend legitimierte, darin er Bach, Beethoven, Brahms, Prokofieff und Ravel musizierte, ist trotz seiner Jugend kein Stürmer und Dränger, strebt vielmehr, seiner Natur folgend, nach klassischer Klarheit und Ruhe, darunter allerdings menschliche Wärme genug verströmen kann. Der Schuß romantisches Gefühl, da und dort unzweideutig durchscheinend, wird gebändigt im Sinne der künstlerischer! Geschlossenheit.
Das Kammerorchester der Wiener Konzerthausgesellschaft eröffnete seinen Matineenzyklus mit Haydn, Mozart und Schubert. H a y d n s Schulmeistersymphonie (Es-dur, Nr. 5 5) wurde brav und etwas schulmeisterlich musiziert. Besser gelang Mozarts Klavierkonzert KV 456 mit Ingrid Haebler als Solistin. Zur Bravheit kam hier eine gewisse Lebendigkeit, der freilich die Höhepunkte fehlten. Am lebendigsten gelang die Symphonie von Franz Schubert (1813), D-dur, Nr. 1, in der sich auch der Dirigent Paul A n g e r e r als Orchestererzieher und -leiter am vorteilhaftesten präsentierte. Franz Krieg
Die Wiener Philharmoniker waren die Ausführenden des ersten Karajan-Konzerts im Musikverein, auf dessen Programm ausschließlich Werke von Beethoven standen. Eine genaue Interpretationsanalyse der „C o r i o 1 a n“-Ouvertüre könnte die besonderen Qualitäten dieser Aufführung im einzelnen erweisen. Die Wucht der Akzente ging nie auf Kosten der Tonschönheit; die Vehemenz und Dramatik des Vortrags beeinträchtigten nicht die Deutlichkeit; große Steigerungen wurden geradezu raffiniert aufgebaut und vom Orchester virtuos ausgeführt usw. All das gilt auch für die mitreißende Wiedergabe der 1. und 3. Symphonie. In der „E r o i c a“ war lediglich der erste Satz im Tempo etwas überzogen (hierdurch ergab sich die Differenz von etwa zwei Minuten zur „notmalen“ Zeitdauer dieser Symphonie), das überdies auch zu starr festgelegt und eingehalten wurde. Um so mehr zu loben war das klassische Maßhalten in Dynamik und Tempo im Finale, wo so viele Interpreten über den Strang hauen. Sehr lebhafter und Ia'ngänhalterider Beifall für' Orchester und Dirigenten,'
Bald nach Beendigung des Krieges gründeten Absolventen einer bekannten New-Yorker Musikschule das Juilliard-Quartett, das in Amerika durch Schallplattenaufnahmen der Streichquartette von Haydn, Mozart und Schubert sowie durch die Wiedergabe der sechs Quartette von Bartök bekannt wurde. In den letzten Jahren hat sich dieses Ensemble besonders für die Werke von Schönberg, Berg und Webern eingesetzt, die auch auf den Programmen der beiden im Mozart-Saal gegebenen Konzerte standen. — Alban Bergs sechssätzige „Lyrische Suite“, 1926 entstanden, verleugnet nicht ihre geistige Herkunft aus der Tristan-Sphäre (Zitat im letzten Satz), von Mahlers „Lied von der Erde“, Schönbergs frühen Stücken und Zem-linskys „Lyrischer Symphonie“. Als ein Werk des Uebergangs ist es auch durch die Verwendung beider Techniken gekennzeichnet: der dodekaphonischen (im ersten und letzten Satz) sowie der „freien“, atonalen und chromatischen in den mittleren Teilen, welche Berg auch für Streichorchester gesetzt hat. Anton von Weberns bereits 1909 geschriebene „Fünf Stücke für Streicher“ op. 5 weisen noch weiter in die Zukunft: in unsere Zeit und auf die Werke der jüngsten Pioniere der seriellen und punktuellen Schreibweise. — Diese fünf Stücke, die zusammen immerhin 12 Minuten dauern, haben noch nicht jene Mikrostruktur der späteren Kompositionen Weberns und strahlen einen intensiven lyrischen Zauber aus, der — in der vorbildlichen Wiedergabe durch das Juilliard-Quartett — bewirkte, daß das Publikum eine Wiederholung des schwierigen Werkes erzwang. — Bei der Interpretation von Debussys Streichquartett g-moll zeigten sich deutlicher Qualitäten und Grenzen dieses Ensembles: die Klangschönheit tritt ein wenig hinter Fräzision, Musikalität und Intelligenz der Spieler zurück.
Die als Interpretin zeitgenössischer Vokalkompositionen bekannte Mannheimer Sopranistin Carla H e n i u s gab, von Aloys Kontarsky begleitet, einen leider sehr schlecht besuchten Liederabend im Schubert-Saal, der von der IGNM veranstaltet wurde. Im Mittelpunkt standen die 15 Stefan-George-Lieder von Schönberg, unter deren bahnbrechendem Einfluß Theodor W. Adorno seine — auch stilistisch sehr ähnlichen — „Vier Lieder nach Gedichten von St. George“ schrieb. Ein ausdrucksvoller „Geistlicher Gesang“ von Ernst K r e n e k aus dem Jahre 1952 gehört gleichfalls dieser Sphäre an, während die seriellen Klavierstücke von Aldo C 1 e m e n t i und Bernd Alois Zimmermann deutlich die konsequente Weiterentwicklung der Webernschen „punktuellen“ Technik verraten. Die intellektuelle und technische Leistung der beiden Interpreten war bewunderungswürdig und wurde von den wenigen Besuchern dieses Konzertes lebhaft gefeiert.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!