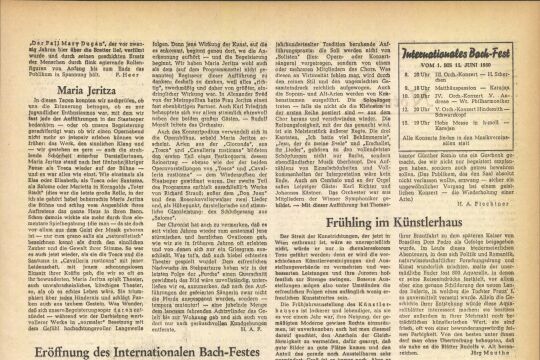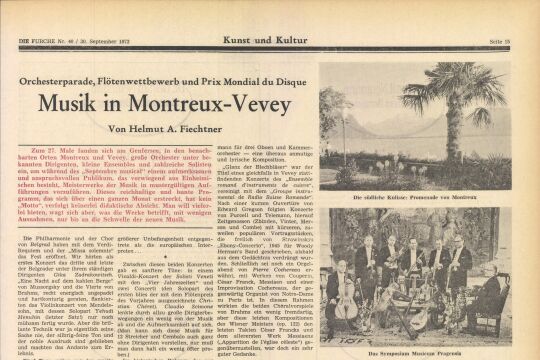Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von Schütz bis Schostakowitsch
Die Musica Antiqua, das ständige Ensemble der Internationalen Gesellschaft für alte Musik, spielte im Brahms-Saal unter seinem neuen künstlerischen Leiter Bernhard Klebei zwei Konzerte, die diurch perfekt ausgewogene Programme und stilistisch überzeugende Wiedergaben beeindruckten: Die vorweihnachtliche Aufführung von Heinrich Schütz’ berühmter „Historia, der Freuden- und Gnadenreichen Ge- burth des Sohnes Gottes und Marien Sohnes, Jesu Christi..1644 in Dresden gedruckt, zählt zu den für die Entwicklung des barocken Oratoriums wichtigsten Werken. Vor allem die Behandlung der Evangelistenpartie in Rezitativmanier macht das Opus sehr modern. Das Ensemble, zehn Sänger und elf Instrumentalisten sorgten für eine ökonomische, klarlinige Interpretation. Unter den Solisten gefiel besonders Gundi Klebel als Engel. Stücke von Scherer, Praetorim und Schütz’ deutsches Magnificat suggerierten zu Beginn weihnachtliche Atmosphäre. — Vorher hörte man von der Musica Antiqua einen Abend mit Werken der Hofkomponisten Kaiser Maximilians I., und zwar von Isaac, Hofhaimer und Senfl. Wieviel schlichte Schönheit, verbunden mit höchster satztechnischer Kunstfertigkeit viele dieser Kompositionen ausstrahlen, führten die Musici besonders an Isaacs Missa Carminum vor, einem polyphonen Meisterwerk höchster Qualität. Dieses wie auch die Motette „Optime Pastor", von Isaac für Papst Leo X. komponiert, gerieten klarlinig, durchsichtig, in sauberen, kunstvoll gebrochenen Konturen.
Kily Ameling sang im Mozart- Saal Purcells Szene „From Rosy Bowr’s“ des englischen Meisters Beitrag zu Thomas D’Urfeys „Don Quixote“ (1695), drei Stücke aus Schuberts Zyklus „Ellens Gesänge“ und seine Lieder „Liebe schwärmt auf allen Wegen“ und „Suleika“ sowie nach der Pause Menottis Canti della Lontananza. Sie ist eine Künstlerin, die ihren Sopran mit viel Kultur, Geschmack, Flair für subtile Wirkungen einzusetzen weiß. Gewiß, manche Wiedergabe wirkt etwas kühl, die Lieder Schuberts schienen uns eher zu betont naiv interpretiert.
Indes entschädigt ihre wohlausgebil- dete hübsche Stimme, vor allem in der Mittellage. Menottis Canti, banale Seufzer über Briefe und Einsamkeit, überzeugten lediglich dank der ausgefedlten intimen Wiedergabe.
Karlheinz Roschitz
Das dritte Konzert im Zyklus „Die Große Symphonie“ wurde von Hans Schmidt-Isserstedt geleitet, der Entscheidendes für die Entwicklung des Symphonieorchesters des NDR in Hamburg geleistet hat. Am besten gefiel Haydns D-Dur-Symphonie (Nr. 86), die immerhin korrekt, mit Ökonomie, in Agogik und Dynamik überzeugend gestaltet wurde. Hindemiths Konzertmusik für Streicher und Blechbläser (op. 50) geriet eher schwerfällig: Vom Werk her, das häufig nach einer „Unterweisung im Tonsatz“ klingt, wie in der Entfaltung musikalischen Humors, der besonders im zweiten Teil, der „Bosto- ner Symphonie“, versandete. Eher trocken wirkte auch die Aufführung von Brahms’ „Zweiter“ (D-Dur), für die Schmidt-Isserstedt entschieden am wenigsten Leidenschaftlichkeit erübrigte. Die Symphoniker waren nicht unbedingt in der richtigen Laune, den Wörthersee blau schimmern zu lassen und in klanglicher Wärme zu schwelgen.
George Malcolm widmete seinen Cembaloabend ausschließlich Werken von G. F. Händel. Er spielte die Suiten Nummer 3, 5, 7 und 14 „Three Lessons“ und fünf Stücke (Fuge g-Molil, Chaconne F-Dur, Capriccio ig-Möll, Fuge G-Dur, Fantasia C-Dur). 1720 bis 1733 entstanden, zeigen die Händelschen Suiten deutlich den Unterschied zu dem gleichen Genre Bachs: Die Vordringldchkeit der klanglichen Wirkung vor der strengen Folyphonie, obgleich es daran auch ihnen nicht mangelt. Die Kunst des Interpreten bestand darin, dies auf dem klanglich nicht sehr ergiebigen Cembalo überzeugend zu demonstrieren. Es gelang ihm infolge seiner absoluten Stilkenntnis und seiner nicht weniger absoluten Beherrschung des Instruments, die er in dem gewählten, nicht kurzen Programm glänzend zur Geltung brachte. Ein Abend voll Musik eines der größten Barockmeister, der nur durch gelegentliche Hinzufügung eines anderen Instruments klanglichere Vielfalt erhalten hätte.
Zu einer vorweihnachtlichen Aufführung des „Magnificat“ von Johann Sebastian Bach in der Urfas- sung mit den weihnachtlichen Einlagesätzen lud der Wiener Madrigal- chör unter Xaver Meyer, unter Mitwirkung der Wiener Goethe-Kantorei und eines Kammerorchesters der Wiener Philharmoniker sowie Hans Haselböcks an der Orgel. Durch die sichere Intonation und die Leichtigkeit seines polyphonen Sin- gens bewies der jugendliche Chor sein Können und seine innere Beteiligung, deren geistiger Habitus sichtlich vom Dirigenten ausstrahlte und über die Ausführenden hinweg auch die Zuhörerschaft spürbar mitriß. Ein besonderes Lob sei dem Solistenquartett gewidmet, dessen Stimmen in müheloser Einheitlichkeit aufeinander abgestimmt waren: Laurence Dutoit, Helga Wagner, Peter Baillie und Reid Bunger. Von den Instrumentalisten sei besonders die fulminante Leistung der Bach-Trompeter hervorgehoben. Im ersten Teil der Matinee hörte man drei geistliche Kompositionen lebender Autoren: zwei Deutsche Proprien von Anton Heiller (Dreifaltigkeitssonntag) und Heinz Kratochwil (Allerheiligen), beide für gemischten Chor a cappella, und den Psalm 103 für Alt- und Baßsolo, Chor und Orgel von Hans Haselböck. Drei Kompositionen persönlichster Eigenart, für den kirchlichen Gebrauch bestimmt und in diesem Sinne trotz aller Verschiedenheit stilistischer und duktiver Art in höherer Einheit gebunden. Auch diesen mitunter schwierigen Werken wurden die Ausführenden, wenn auch nicht mit der gleichen Gelöstheit wie bei Bach, in sauberster Intonation und geistiger Haltung gerecht und dürfen dies als besonderen Erfolg buchen.
Franz Krieg
Auf dem Programm des Symphoniker-Zyklus unter Wolfgang Sawal- lisch Ständen zwei selten aufgeführte Werke: das Doppelkonzert a-Moll, op. 102, von Brahms und Schostako- witschs X. Symphonie aus dem Jahr 1953. Entgegen seinem Ruf — als „VIII. Symphonie“ gibt dieses letzte Örchesterwerk von Brahms den beiden Solisten mehr als genug zu tun und auch reichlich Gelegenheit, zu konzertieren. Die Ausführenden waren zwei Philharmoniker, etwa gleich alt, der eine in Arad, der andere in Odessa geboren, beide in Bukarest ausgebildet: Josef Sivo — Violine und Vladimir Orloff — Violoncello. — Hörte man über kleine Unstimmigkeiten hinweg, so konnte man mit ihrer Interpretation, was Musikalität und Schwung des Vortrags betrifft, recht zufrieden sein. Schostakowitschis positive und negative Eigenschaften treten in seiner fast einstündigen „Zehnten“ mit plakativer Deutlichkeit zutage. Die ursprüngliche Begabung des Symphonikers, der heute als einer der wenigen noch große Farmen zu bauen versteht, ist gepaart mit einer Neigung zu drastischen Wirkungen und zu exzessivem Lärm. Der ganze zweite Satz ist eine solche Lärmorgie, daß man Mühe hat, sich für den 3. und 4. Satz, in denen es sehr hörenswerte Passagen gibt, zu konzentrieren. Was die Form der Themen und den orchestralen Klang sowie die Neigung zum Alfresco betrifft, steht Schostakowitsch ganz in der russischen Tradition Tschai- kovsky-Mussorgsky-Prokofieff. In der Verarbeitung des Materials, in der Kunst der Weiterentwicklung der Themen, der Kombinatorik und der Fähigkeit zu durchaus klarer und „erhörbarer“ polytonaler Stimmführung ist er ihnen entschieden überlegen. — Auf alle Fälle ist diese Zehnte ein Stück, das Dirigenten gerne interpretieren und das wahrscheinlich auch jene Orchester gerne spielen, die sidh einmal lautstark und entfesselt musizieren hören wollen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!