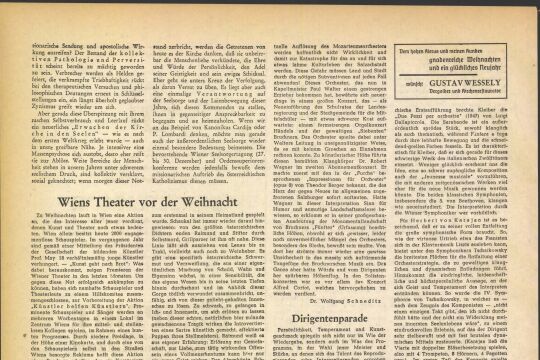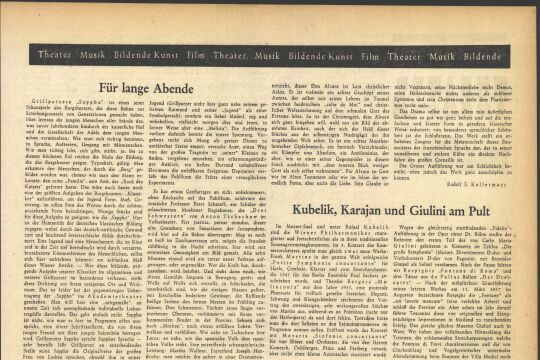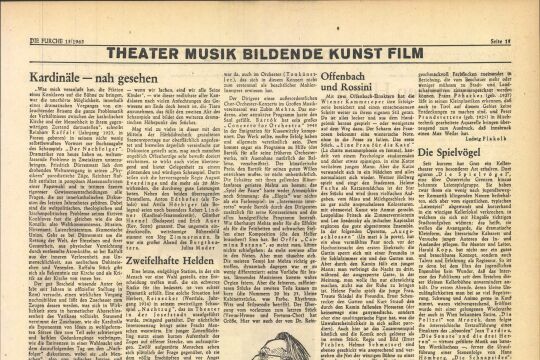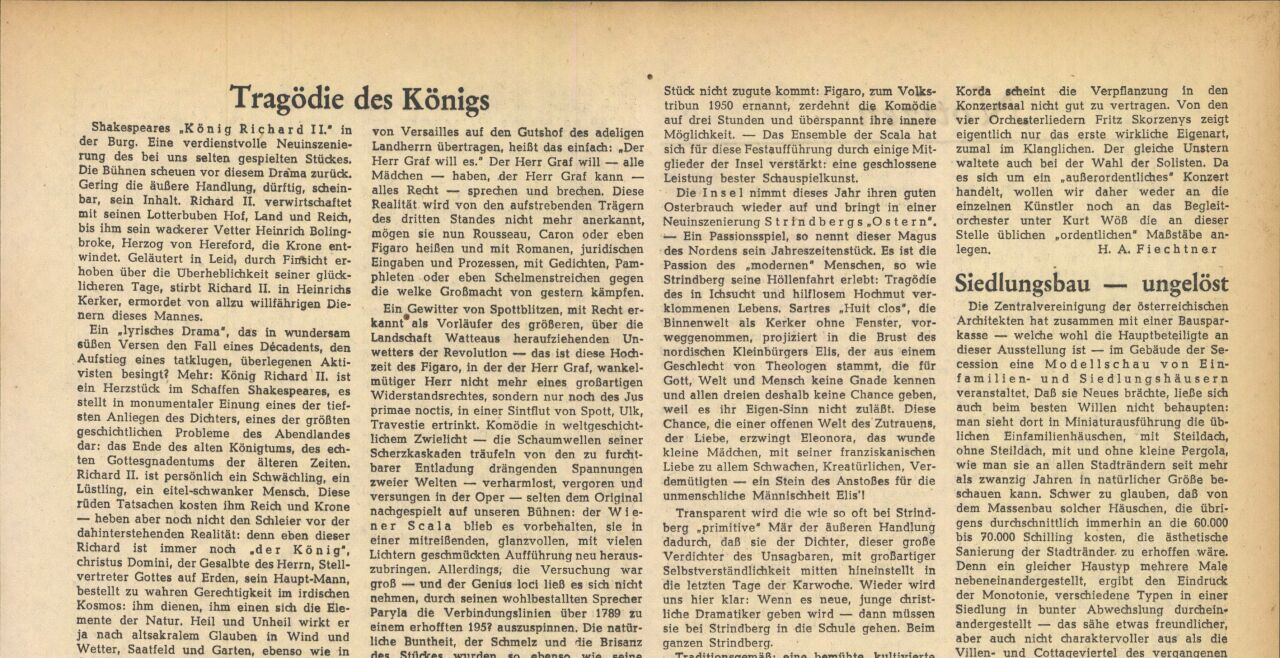
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Oratorium und Orchesterkonzerte
Bei jedem neuen Anhören des Schmidt-Oratoriums „Das Buch mit sieben Siegeln“ vertiefen sich die positiven und negativen Eindrücke. Das Werk hat sich im Wiener Musikleben einen festen Platz erobert. Außerhalb der Grenzen Österreichs wurde es nur ein einziges Mal (1938 durch die Berliner Singakademie unter Georg Schumann) dargeboten. Die Größe des Aufführungsapparats und die ungewöhnlichen Anforderungen, welche das Werk an die Ausführenden stellt, genügen nicht für die Erklärung dieses Tatbestandes. Die Problematik liegt — ähnlich wie bei Schmidts „philharmonischen“ Symphonien — in der Gesamthaltung, im Stil, der außerhalb Wiens anscheinend nicht vorbehaltlos akzeptiert wird. Die Mischung von Oratorischem, Opernhaftem, Musikdramatischem und Melodramartigem gibt es auch in anderen, allgemein anerkannten Werken der Gattung. Aber das Nebeneinander von Wagner („Götterdämmerung“ vor allem), und Regerscher Chorpolyphonie, Gregorianik und Ungarischem, Bänkelgesang, Choral und Jazz, bereitet vielen Hörern nicht nur Kopfzerbrechen, sondern wird — im Hinblick auf den zu größter Klarheit des Stils verpflichtenden biblischen Text der Apokalypse (den Schmidt selbst als eine „beispiellose Dichtung bezeichnet) — auch künstlerisch im höchsten Grade fragwürdig. Die sehr starken und eindrucksvollen Stellen des Werkes sowie die virtuose Beherrschung jedes einzelnen Teiles des Aufführungsapparats wurden auch an dieser Stelle wiederholt gewürdigt und bedürfen in Wien keines Fürsprechers. Joseph Krips leitete eine Aufführung im Großen Musikvereinssaal, für die wir vor allem deshalb dankbar sind, weil sie alle die angedeuteten Züge mit besonderer Deutlichkeit zutage treten ließ. Der große Chor des Singvereins und die Wiener Symphoniker mit Hilde Zadek, Rosette Anday, Julius Patzak, Erich Majkut, Otto Edelmann und Alois Forer an der Orgel waren die Ausführenden.
Im 5. Orchesterkonzert der Konzerthausgesellschaft dirigierte Josef Krips, etwas überhitzt und überhetzt, Mozarts „Jupitersymphonie“ (im Stil einer opera buffa per orchestra) und, klangschwelgerisch, mit besonderer Hervorhebung des Blechs, die Vierte von Schumann. Das Orchester der Symphoniker erfüllte mit Virtuosität die hohen Anforderungen, vor allem in bezuq auf das Tempo. Dazwischen spielte der ausgezeichnete, hochmusikalische belgische Geiger Arthur Grumiaux das in den Jahren 1937/38 noch in Budapest entstandene einzige Violinkonzert Bela Bart6ks. Nach einmaligem Anhören dieser überaus schwierigen und dichten Partitur, deren Klanggestalt und Rhythmik in der Interpretation nicht ganz transparent wurden, möchte sich der Chronist — auch im Hinblick auf die hohe Meisterschaft Bartoks — auf ein subjektives Urteil zurückziehen. Durch die mosaikartige Aneinanderreihung kleiner, in Tempo und Rhythmus verschiedener Teile Oleibt als Gesamteindruck eine fast quälende Unruhe. Einzelne Stellen sind von ergreifender Schönheit, doch ist zumeist die melodische Linie durch eine überreiche Ornamentik schwer zu erfassen. Wahrscheinlich ist unser Ohr noch nicht geübt, unsere Intelligenz nicht rasch genug, diesen ganzen Reichtum auf einmal zu erfassen, und wahrscheinlich wtrd dieses Werk in zehn oaer zwanzig Jahren bereits anders klingen ...
Die Musiker des Orchestervereins der Gesellschaft der Musikfreunde sind mit wenigen Ausnahmen Dilettanten, aber Dilettanten, wie es sie vermutlich nur in Wien gibt. Dieses Orchester würde in mancher Stadt des Auslandes wenn nicht an erster, so bestimmt an ehrenvoller zweiter Stelle rangieren. Hohen künstlerischen Ansprüchen genügte auch das Programm, das sich durch besondere; Originalität auszeichnete. Unter der Leitung von Fritz Sedlak spielte das Orchester die Ouvertüre im italienischen Stil von Schubert, Haydns Oxfordsymphonie und begleitete Mozarts Klavierkonzert B-dur
— Solist: Jörg Dermis —, der auch den Solopart in Beethovens Phantasie für Klavier, Chor und Orchester spielte. Bei diesem Werk und der „Nänie“ von Brahms wirkte der gut studierte und sicher geführte Chor der Wiener Lehrer mit. Programm und Ausführung rechtfertigen dieses Konzert in vollem Umfang.
Ebenso erfreulich war das Symphoniekonzert des Akademischen Orchesterverein s, bei dem sich die konsequente Arbeit eines ständigen Orchesterleiters vorteilhaft bewährte. Auch dieses Programm ist als vorbildlich zu bezeichnen. Nach Beethovens Ouvertüre zu Egmont spielte Gottfried Freiberg das romantische, merklich gealterte Homkonzert von Richard Strauß und
— als Wiener Erstaufführung — die I. Symphonie von Schostakowitsch, jenes Jugendwerk, das den Konservatoristen über Nacht in der ganzen Welt berühmt machte. Diese Erste zeigt vielversprechende Ansätze, die in den folgenden Symphonien nicht voll entwickelt erscheinen, und jene Spannung zwischen nationalem Grundelement 'und internationaler Form und Tonsprache, die bei Schostakowitsch bisher immer noch nicht befriedigend ausgeglichen ist.
Das Tonkünstlerorchester, dessen Sonntagnachmittagskonzerte sich nicht nur durch gründliche Vorbereitung, sondern auch durch gute Programme auszeichnen, war bei seinem letzten „außerordentlichen Konzert“ weniger gut beraten. Der zweite Teil war ein lehrreiches Beispiel dafür, wie man Programme mit zeitgenössischer Musik nicht machen soll. Das Cellokonzert mit Streichorchester von Franz Ippisch ist eine ausgesprochen epigonale Arbeit. Die Aria con Variazioni für Streichorchester von Viktor
Korda eheint die Verpflanzung in den Konzertsaal nicht gut zu vertragen. Von den vier Orchesterliedern Fritz Skorzenys zeigt eigentlich nur das erste wirkliche Eigenart, zumal im Klanglichen. Der gleiche Unstern waltete auch bei der Wahl der Solisten. Da es sich um ein „außerordentliches“ Konzert handelt, wollen wir daher weder an die einzelnen Künstler noch an das Begleitorchester unter Kurt Wöß die an dieser Stelle üblichen „ordentlichen“ Maßstäbe anlegen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!