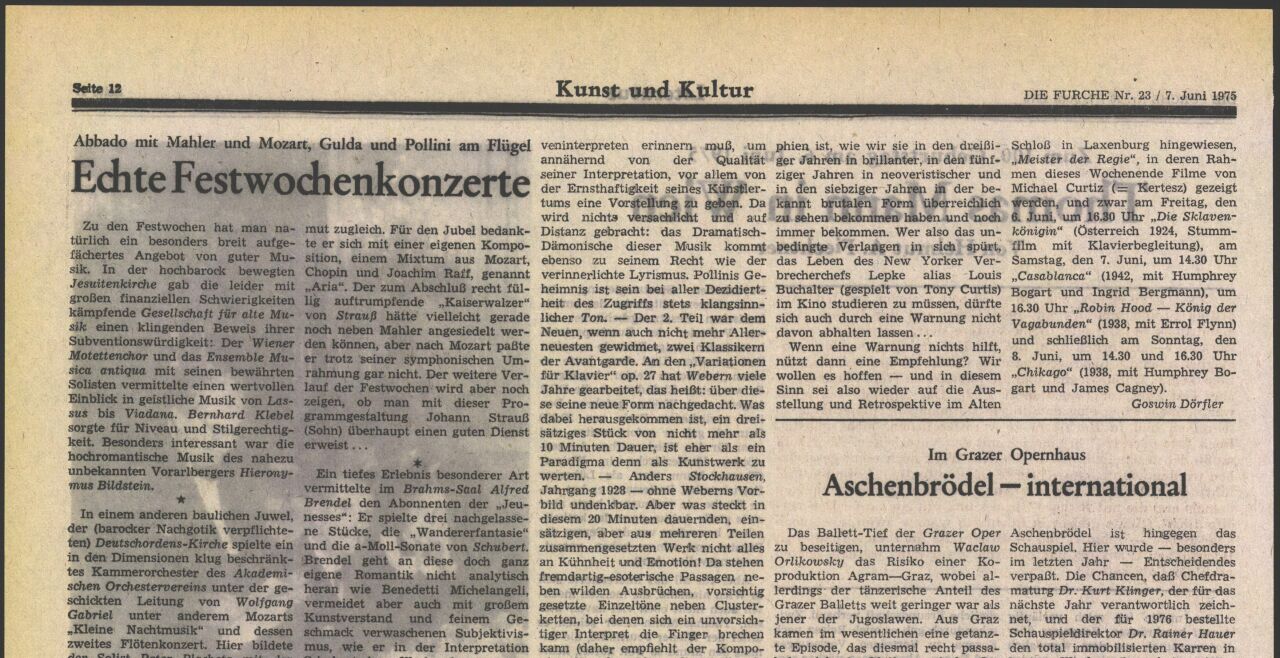
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Echte Festwochenkonzerte
Zu den Festwochen hat man natürlich ein besonders breit aufgefächertes Angebot von guter Musik. In der hochbarock bewegten Jesuitenkirche gab die leider mit großen finanziellen Schwierigkeiten kämpfende Gesellschaft für alte Musik einen klingenden Beweis ihrer Subventionswürdigkeit:. Der Wiener Motettenchor und das Ensemble Mu-sica antiqua mit seinen bewährten Solisten vermittelte einen wertvollen Einblick in geistliche Musik von Las-sus bis Viadana. Bernhard Klebel sorgte für Niveau und Stilgerechtigkeit. Besonders interessant war die hochromantische Musik des nahezu unbekannten Vorarlbergers Hieronymus Bildstein.
In einem anderen baulichen Juwel, der (barocker Nachgotik verpflichteten) Deutschordens-Kirche spielte ein in den Dimensionen klug beschränktes Kammerorchester des Akademischen Orchestervereins unter der geschickten Leitung von Wolfgang Gabriel unter anderem Mozarts „Kleine Nachtmusik“ und dessen zweites Flötenkonzert. Hier bildete der Solist Peter Placheta mit der eleganten Leichtigkeit und Virtuosität seines Spiels eine echte Überraschung.
Im Musikverein boten die Tonkünstler unter Carl Melles festlichkraftvoll und mit innerer Spannung Haydns zweites Te Deum, die G-Dur-Messe von Schubert und Koddlus „Psalmus Hungaricus“ dar. Das ungarische Schlüsselwerk war von Intensität und Leidenschaft erfüllt, der Solist Karl Walter Böhm fiel durch eine zwar noch etwas unsicher geführte, aber schöne Stimme auf. (Eigentlicher Star des Abends war die prächtig disponierte Singakademie.) Auch Schubert vermeinen wir selten so schön und innerlich geschlossen gehört zu haben; die Solisten hierbei waren Dorit Hank, Kurt Equiluz und Reid Bunger. An der Orgel wirkte der stets verläßliche Rudolf Scholz.
Wie sehr die Belebung einer Partitur der psychischen Kraft des nachschöpferischen Künstlers bedarf, demonstrierte in glücklichster Weise Carlo Maria Giulini mit den Symphonikern im Konzerthaus. Er fand zu einer überzeugenden Einheit aller vier Sätze von Mahlers „Neunter“: Die latente und die unverhüllte ironische „Ländlerseligkeit“ und ihre floskelhaften „feschen“ Abschlüsse zum Beispiel im zweiten Satz gestaltete er als gelernter Musiker und nun bereits auch als gelernter Wiener mit jener Traurigkeit, die man den Höhenzügen des Wienerwaldes nachsagt, und mit jener schneidenden Intensität, mit der Mahler seine Leiden in dieser Welt zu artikulieren wußte — innere Walpurgisnacht eines restlos Verzweifelten. — Was ein naiverer, aber bodenständiger Meister über seine Landschaft zu sagen hat, gelang Giulini ebenfalls, nämlich der Donauwalzer von Strauß, und da er Wien kennt, dürfte er sich darüber wahrscheinlich mehr gefreut haben als über seine großartige Mahler-Interpretation.
Ein „Philharmonisches“ fand diesmal — schließlich haben wir ja Festwochen mit einer ungeraden Jahreszahl — im Konzerthaus statt. Claudio Abbado ließ Mahlers „Vierte“ breit ausspielen und die Philharmoniker im teuren Klang schwelgen. Für den schwer zu realisierenden dritten Satz fand er keine persönliche Lösung; zu leicht liefert man sich hier der überkandierten Süße aus ... Und von der Solistin Elisabeth Söderström hatte man sich eigentlich mehr erwartet: Ihr Sopran sitzt verhältnismäßig weit hinten, hat eine dunkle Schärfe und ermangelt größerer Tragfähigkeit. — Mozarts Klavierkonzert in C-Dur, KV 503, mit Friedrich Gulda, Abbado und unserem Meisterorchester: Luxus, so weit das Ohr reicht, und eine Musik — unbegreiflich in ihrer Vollkommenheit. Gulda spielte mit der Einfachheit und inneren Ruhe des großen Künstlers: zuchtvoll, durchsichtig, dynamisch feinst abgestuft, mit perlenden Läufen, edel gesungener Melodik, Tiefe und An-
mut zugleich. Für den Jubel bedankte er sich mit einer eigenen Komposition, einem Mixtum aus Mozart, Chopin und Joachim Raff, genannt „Aria“. Der zum Abschluß recht füllig auftrumpfende „Kaiserwalzer“ von Strauß hätte vielleicht gerade noch neben Mahler angesiedelt werden können, aber nach Mozart paßte er trotz seiner symphonischen Umrahmung gar nicht. Der weitere Verlauf der Festwochen wird aber noch zeigen, ob man mit dieser Programmgestaltung Johann Strauß (Sohn) überhaupt einen guten Dienst erweist...
Ein tiefes Erlebnis besonderer Art vermittelte im Brahms-Saal Alfred Brendel den Abonnenten der „Jeunesses“: Er spielte drei nachgelassene Stücke, die „Wandererfantasie“ und die a-Moll-Sonate von Schubert. 'Brendel geht an diese doch ganz eigene Romantik nicht analytisch heran wie Benedetti Michelangeli, vermeidet aber auch mit großem Kunstverstand und feinem Geschmack verwaschenen Subjektivismus, wie er in der Interpretation Schubertscher Werke lange genug Geltung gehabt hat. Sein Zugang zu Schubert ist ursprünglich und bei aller Musikalität von einer inneren Ruhe und Entrücktheit, die seine Gestaltung in den Rang eines säkularen Ereignisses hebt.
Herbert Müller
Im vollen Großen Konzerthaussaal gab Maurizio Pollini einen Klavierabend. Seine Technik rühmen, hieße Eulen nach Athen tragen, denn seit 1971, nach einer „schöpferischen Pause“, die sieh der damals schon Preisgekrönte selbst auferlegt hatte, trat er fünfmal im Konzerthaus auf und legitimierte sich in allen Sparten. — Heute hat der etwa 35jährige eine Reife erlangt, die ihn befähigt, Beethovens Hammerklaviersonate op. 106 (mit einer Gesamtdauer von 42 Minuten, also Symphonieformat), so /.u spielen, daß-man ändie Namen der großen alten deutschen Beetho-
veninterpreten erinnern muß, um annähernd von der Qualität seiner Interpretation, vor allem von der Ernsthaftigkeit seines Künstler-tums eine Vorstellung zu geben. Da wird nicht» versachlicht und auf Distanz gebracht: das Dramatisch-Dämonische dieser Musik kommt ebenso zu seinem Recht wie der verinnerlichte Lyrismus. Pollinis Geheimnis ist sein bei aller Dezidiert-heit des Zugriffs stets klangsinnlicher Ton. — Der 2. Teil war dem Neuen, wenn auch nicht mehr Allerneuesten gewidmet, zwei Klassikern der Avantgarde. An den „Variationen für Klavier“ op. 27 hat Webern viele Jahre gearbeitet, das heißt: über diese seine neue Form nachgedacht. Was dabei herausgekommen ist, ein dreisätziges Stück von nicht mehr als 10 Minuten Dauer, ist eher als ein Paradigma denn als Kunstwerk zu werten. — Anders Stockhausen, Jahrgang 1928 — ohne Weberns Vorbild undenkbar. Aber was steckt in diesem 20 Minuten dauernden, einsätzigen, aber aus mehreren Teilen zusammengesetzten Werk nicht alles an Kühnheit und Emotion! Da stehen fremdartig-esoterische Passagen neben wilden Ausbrüchen, vorsichtig gesetzte Einzeltöne neben Cluster-ketten, bei denen sich ein unvorsichtiger Interpret die Finger brechen kann (daher empfiehlt der Komponist, für die Glissandi Wollhandschuhe anzuziehen deren Finger abgeschnitten sind — was Pollini auch tat; gleichzeitig ließ er, um für diese Schwerarbeit „freier“ zu sein, sein Jackett in der .Garderobe). Diese Musik könnte man spaltenlang beschreiben, weil hier mit Vergleichen nichts zu verdeutlichen ist, zumal der an klassischer und romantischer Musik geschulte Hörer den Bewegungsablauf gefühlsmäßig nicht nachvollziehen kann. — Als Zugabe spielte Pollini für das ihn stürmisch akklamierende, zum großen Teil aus jugendlichen Hörern bestehende Publikum op. 11 , und op. 19 von Schönberg, dann Bartök. — Pollinis Interpretation auf dem hiefür hervorragend geeigneten Steinway kann man nachsagen, daß er klassische Musik spielt, als sei sie von heute — und neue, als sei sie bereits klassisch.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































