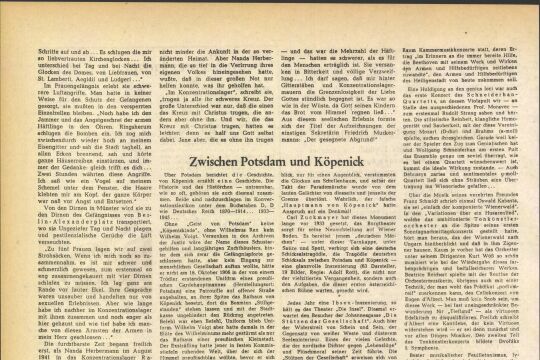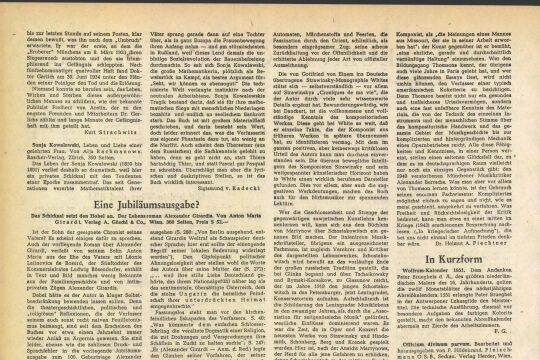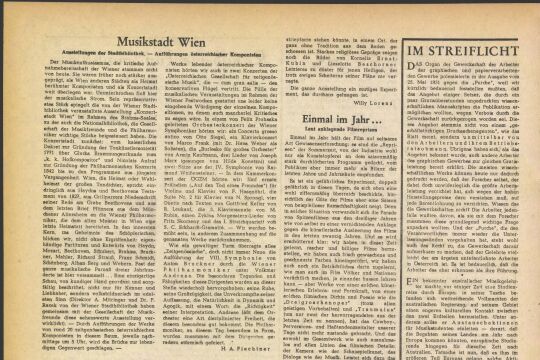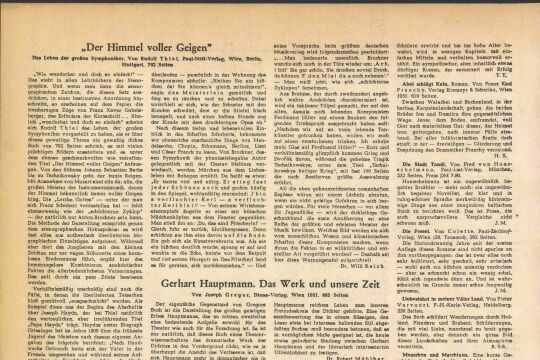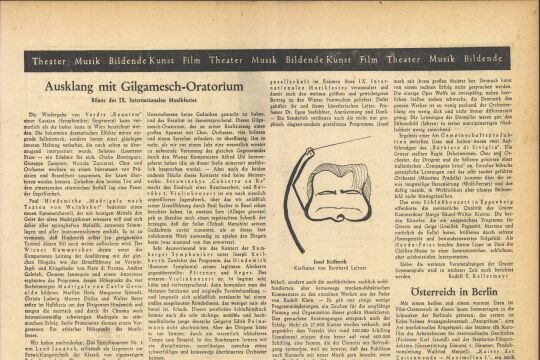Die im Auftrag der Gesellschaft der Musikfreunde von Dr. Grasberger gestaltete Ausstellung „Handschriften der Meister“ ist eine den Wiener Festwochen wahrhaft würdige visuelle Gegenüberstellung von Partitur, autobiographischer Skizze und Konzert. „Den Besucher auf den Ursprung dessen hinzuweisen, was ihn im Konzertsaal berührt und begeistert“ und „die Ehrfurcht vor dem Schöpfer des Werkes“ wiederzuerwecken, so bezeichnet Minister Piffl- Perčevič in seinem Geleitwort für den Katalog die Idee und das Ziel dieser Ausstellung. Der Perfektion der Wiedergabe soll das Handwerk vorgelegt, der Hinweis auf den Schöpfungsakt intensiviert werden. In sechs Abschnitte ist die Ausstellung gegliedert: Bach, Haydn und Mozart, Beethoven, Schubert bis Brahms, Strauss bis Bartök, 20. Jahrhundert — Österreich; jeweils nur vier Tage. Eine ungemein kurze Zeit also, wobei man aber des großen Risikos (welch ungeheure Versicherungssummen wurden ausgegeben!) Rechnung tragen muß. Aus ganz Europa werden die Ausstellungsobjekte, von Kurieren begleitet, von Kriminalbeamten schwer bewacht, nach Wien geschafft.
Der relativ kleine, aber sachlich-schön gestaltete Ausstellungsraum des Archivs im Musikvereinsgebäude bildet den Rahmen für das große Projekt. In den raffiniert entworfenen Vitrinen schimmern die Werke großer Meister gleichsam gestaltlos im Raum. Das indirekte Licht bewirkt dieses kleine technische Wunder, das Illusion und Phantasie beflügelt.
Doch nicht nur die großen Werke, nicht streng biographische Zeugnisse werden demonstriert, es ist vor allem die Persönlichkeit, im Zusammenhang mit dem Schöpfungsakt, die beleuchtet werden soll. Was man unten im Saal hört, soll man oben sehen lernen. Nicht allein die Partitur, die im Konzertsaal gespielt wird, die Musik „gibt“, soll verstanden, sondern das Notenbild, vom Komponisten im Zustand schöpferischer Erregung geschrieben, soll erfühlt werden. Diese „Gefühlsdokumente“ sind außerdem, sehr konzentriert, sehr sparsam, durch Zeitbilder, Briefe und Dokumente anderer Zeitgenossen umgeben, die wiederum alle zur Schöpfung weisen. Es ist ein sehr eng begrenzter Bereich, und vielleicht gerade deshalb so instruktiv. Man könnte beinahe eine Graphologie der Notenschrift betreiben
Mit Bach beginnt der Reigen. In der 27. Vitrine liegt eine Eintragung über Bachs Ableben am 28. Juli 1750. Die ausführliche Lebensbeschreibung endet mit den Worten: „ alle, die diesen Namen geführt haben, sollen soviel man weiß, der Music zugethan gewesen seyn, welches vielleicht daher komen, daß auch sogar die Buchstaben b a c h in ihrer Ordnung melodisch sind.“ Dieses „Melodische“ spiegelt sich wie nirgends sonst in seinem Notenbild: Es ist bewegt und zugleich ruhig. Man könnte von erhabener Schönheit reden, von Geschlossenheit, die durch bewegten Formenreichtum ihr Ebenmaß bezieht. Es ist gebändigte, überreiche Leidenschaft, verbunden mit Vergeistigung, mit tiefem Glauben. Es ist seine Musik Weil den Briefen kaum ein seelisches oder auch nur privates Erleben abzulesen ist (wahrscheinlich sind die Familienbriefe verlorengegangen), liegt nur ein einziger an den Ratsherrn Johann Friedrich Klemm in der Ausstellung vor. Für ihn spricht allein sein Werk: „Gott ist unsere Zuversicht“, Kantate Nr. 197, h-Moll-Messe, die „Johannespassion“ seien unter vielen genannt. Das Zeitkolorit um ihn vermitteln Händel, Telemann, Fux und die Familie Bach selbst.
Ende Mai folgten Haydn und Mozart. Ineinander verwoben, wie ihr Leben war, sind Werke und Zeugnisse dieser beiden Künstler in den Vitrinen arrangiert. Von Haydns einfachem, bäuerlichen Geburtshaus und Mozarts ersten Tanzmenuetten beginnen sie und reichen zu Mozarts Requiem und Haydns Visitkarte, die dieser in den letzten Lebensjahren mit den Anfangstakten seines Chores „Der Greis“ bedrucken ließ! Dazwischen liegt der Chor aus „Le Feste d’Apollon“ von Gluck, der von Haydn hoch geschätzt wurde, sein eigenes Volkslied „Gott, erhalte Franz, den Kaiser!“ und seine „Nelson-Messe“, um nur einen kleinen Ausschnitt zu demonstrieren. Mozart ist zum Beispiel mit dem „Veilchen“, der Klaviersonate B-Dur, die dem Tod der Mutter Ausdruck gibt (ein wunderschönes Autograph!), der Partitur der „Entführung“ und der „Hochzeit des Figaro“ vertreten.
Haydns letztes Ausdrucksziel ist das freundlich Gelöste, Geläuterte, hervorgegangen aus der Tiefe eines Gemütes, das sich in Gottes Hand befohlen hat, die er stets in der Welt gesucht und auch gefunden hat. „In Nomine Domini“ steht fast über jeder Partitur! Das soll aber nicht heißen, daß sein Notenbild allein Ruhe verheißt; eine fast nervöse Hand eilt da von reger Geistigkeit getrieben über das Papier, klein und zierlich sind die Zeichen gesetzt, ein kräftiger Zug fehlt zwar, aber der zielbewußte Wille ist zu erkennen. Dem Hauch von Anmut und Fröhlichkeit, der über dem Ganzen liegt, kann man sich nicht entziehen.
Auch Mozarts Notenschrift ist voll Bewegung, ein großer innerer Schwung bestimmt das Blatt, und mit Temperament sind auch die Einzelzeichen geschrieben. Es ist stets eine Reinschrift, weil vorher schon zu Ende gedacht, aber ohne Formelhaftigkeit: Immer ist die „erhitzte Seele“ spürbar. Beider Briefhandschrift liegt auch in recht ausgeprägten Dokumenten vor: Ein Brief Haydns an die geistvolle Frau von Genzinger — rund, flüssig, ausgewogen; Mozarts Brief aus Prag an Konstanze — unruhiger, nervöser, nicht in so gleichmäßigem Schwung, aber vielleicht zärtlicher, wärmer.
„Durch ununterbrochenen Fleiß erhalten Sie: Mozarts Geist aus Haydns Händen“, schrieb Graf Waldstein im Oktober 1792 in Beethovens Stammbuch, als dieser sich anschickte, die Reise nach Wien anzutreten. Beethoven ist die Ausstellung vom 1. bis 5. Juni gewidmet, die zum Großteil aus dem Bestand der Gesellschaft der Musikfreunde bestritten werden kann. Es ist die ergreifende Dokumentation eines Künstlers, der wie kein anderer an der Fragwürdigkeit der Welt gelitten und um ihre Geheimnisse gerungen hat. Briefe, Skizzenbücher (ohne die er nie auf der Straße angetroffen wurde), Notenskizzen (aggressiv, kraftvoll, kaum leserlich, Gedankenfetzen Raum gebend), finden sich neben der „Weihe des Hauses“, der „Hammerklaviersonate“, der „Mondscheinsonate“ — der Gräfin Guicciardi (der „Unsterblichen Geliebten“?) gewidmet, der „Zärtlichen Liebe“ — vom stets um Notenpapier verlegenem Schubert in der Hast des Komponierens benützt, dem „Fidelio“, der VIII. Symphonie F-Dur. Auch das berühmte Exemplar, der, von Beethoven überprüften, Abschrift der „Eroica“ liegt in der 23. Vitrine, von der er die Widmung an Napoleon so energisch ausradierte, daß das Blatt durchlöchert wurde. Dazwischen liegen die erschütternden Zeichen eines persönlichen Schicksals: das Hörrohr, das Heiligenstädter Testament, ein Konversationsheft, das das Gespräch mit den Besuchern ersetzen mußte
Eine weite, eine reiche Zeitspanne umfaßt der nächste Teil bis zum 10. Juni: Schubert bis Brahms. Von Schuberts Symphonien, Messen und Liedern, in deren Notenschrift niemals der „dämonische Aufruhr, das Schwelgen süßer Melancholie oder naturnaher Gelöstheit“ hervorbricht, der die Problematik, die Zwiespältigkeit der Persönlichkeit in ihrer
Glätte und Sicherheit nicht anzumerken ist, führt die Auswahl zu Bruckner. Vier Symphonien und das „Tedeum“ liegen hier, mit weitausholendem dynamischen Grundcharakter und dann fast ängstlich gesetzten Zeichen. Weiter zu Liszt — hackig, oft mit Rotstift verbessernd, Wagner (Konzertschluß von „Tristan und Isolde“), Dvorak, Smetana, Chopin, Verdi, Mendelssohn-Bartholdy, Weber, Robert Schumann, darunter Clara Schumann (auf goldumrandetem, mit Schnörkeln versehenem Papier komponierend) und schließlich zu Brahms: spannungsgeladen, kraftvoll, ernst — bitter erkämpfte Ruhe.
Das „Arbeiten“ ist bei Strauss ein ganz merkwürdiger Prozeß. Nichts von Dämonischem, nichts von jenen Depressionen und Desperationen, wie man sie aus Beet-
hovens, aus Wagners Lebensbeschreibungen kennt. Strauss arbeitet sachlich und kühl, er komponiert „ruhig und regelmäßig“, schrieb Stefan Zweig in seiner „Welt von gestern“. Sauber und kontrolliert, wie seine Briefschriften, sind seine Kompositionen. 300 bis 400 Seiten ziehen sich seine winzigen, überaus deutliche Noten dahin. Mahler, Pfitzner oder Hugo Wolf kennen diese Souveränität nicht. Explosiv drängt sich das Genie hervor, kämpft mit Überlieferungen, Zeittendenzen und dem eigenen Ich. Wolfs Briefe an Melanie Köchert veranschaulichen sehr deutlich solche Qual um dieses innere Drängen. Von Strauss bis Bela Bartök reicht der Bogen der 5. Abteilung dieser groß angelegten Ausstellung. Über Franz Schmidt, Wilhelm Kienzl, Franz Schreker, Max Reger, Komgold, Bittner, die sich alle nicht vom Bann Wagners lösen können. Das vermögen erst Debussy, dieser Künstler der Distanzierung, und Ravel. „La Mer“ und „Vaisęs nobles et sentimentales“ sind von ihren Werken vertreten. Paul Hindemith, Igor Strawinsky und Bėla Bartök endlich dokumentieren die Moderne, die außerhalb der Grenzen Österreichs wirkt.
Österreichs Komponisten des 20 Jahrhunderts allein ist der letzte Abschnitt (15. bis 20. Juni) gewidmet. Die Partituren werden immer klarer, durchgeistigter, intellektueller. „Der Rhythmus befreit sich vom Metrum und mündet vielfach in reine Motorik, die ebensowenig einen Überblick gestattet wie der Verzicht auf die Symmetrie in der Form“ (Grasberger). Jedes Element der Musik sucht einen neuen Ausdruck, die Harmonik baut einen neuen Zusammenhang. In der Zwölftontechnik, primär und gewichtig vertreten durch die „Wiener Schule“ — Schönberg, Berg und Webern — und in der Polyphonie haben sie einen neuen Weg gefunden. Es geht um Grundsätzliches im musikalischen Schaffen überhaupt, und dieses Suchen und Streben nach neuen Formmitteln ist am Beispiel einiger zeitgenössischer Komponisten gegeben: Hans Erich Apostel, Weill („Dreigroschen“- Musik), Jelinek, Krenek („Karl V.“, „Jonny spielt auf!“), Egon Wellesz, Häbä, Gäl, Joseph Marx, Hauer (dessen „Schwarze Spinne“ in diesen Festwochen uraufgeführt wurde), Salmhofer, Schiske, Berger, Gottfried von Einem („Dantons Tod“).
Im Grunde können diese letzten Autographen nichts Abgeschlossenes zeigen, sie sollen wohl nur einen Aufriß geben, Möglichkeiten offenbaren und sie dem Hörer und Beschauer näherbringen. Stefan Zweigs Worte, die als Motto über den „Handschriften der Meister“ stehen, können dieses Ziel am besten vermitteln:
„So kann ein einziges Blatt mit ein paar Schriftzügen gleichsam den höchsten Ausdruck menschlichen Glücks in sich zusammenpressen und das andere den Ausdruck tiefster menschlicher Trauer, und wer Augen hat, solche Blätter richtig anzuschauen, Augen nicht nur des Kopfes, sondern auch der Seele, wird nicht minderen Eindruck von diesen unscheinbaren Zeichen empfangen als von der offenkundigen Schönheit der Bilder und Bücher. Auf solch geheimnisvolle Weise haben die Autographen die Macht, uns die Gegenwart längst entschwundener Gestalten zurückzubeschwören und wie entlang einer Galerie von Bildern kann man an diesen Blättern vorübergehen, von jedem anders ergriffen und berührt.“