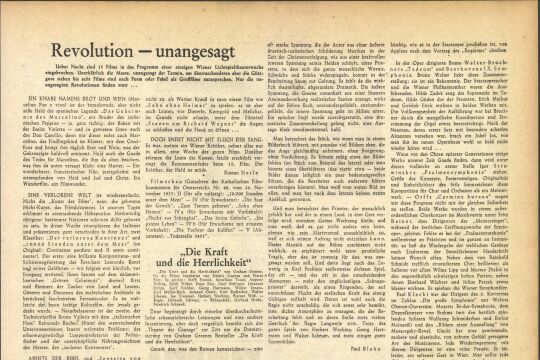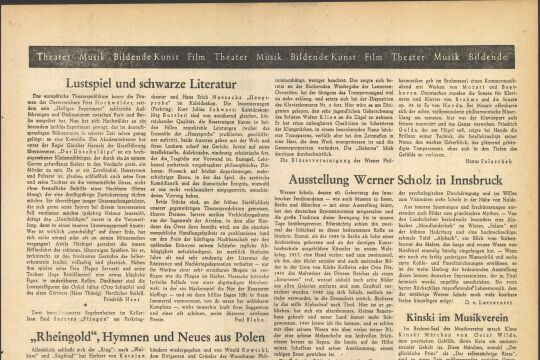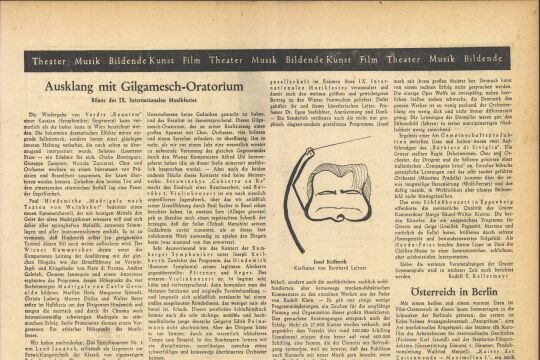Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Geistliches und weltliches Oratorium
Während die Oper weltlidien Ursprungs ist, war ihre Zwillingsschwester, das Oratorium, schon in seinen Ursprüngen geistlichem Dienst vorausbestimmt und hat auch später in weltlichem Gewand immer nur Gastrollen gegeben. Diese Entwicklung bildet nur die eine Komponente, liefert nur einen Baustein für H ä n d e 1 s „M e s s i a s“. Der zweite war die italienische Barockoper, der dritte die lebendige englische Chortradition, die Händel so meisterhaft aufgriff, daß die Engländer in ihm den berufenen Erben Purcells zu erkennen glaubten. Handels- schlichte, einfache Sprache, die jeder versteht, ist das Resultat reifer Meisterschaft. Daß dieses Monumentalwerk in dem unvorstellbar kurzen Zeitraum von drei Wodien niedergeschrieben wurde, ist Zeichen eines ans Wunderbare grenzenden inneren Reichtums und erstaunlichen schöpferischen Vermögens.
Domkapellmeister Anton Lippe leitete die von W. Großmann vorbereitete Aufführung mit dem nötigen Können und Verantwortungsgefühl. Für jene Stellen des Werkes, auf deren rhythmische Präzision es ankommt, wünschte man ihm eine etwas energischere Hand. Dank und Anerkennung für den Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde können kaum hoch und herzlich genug sein. Ein fanfarenartiges Geschmetter im Forte gelingt bald einem großen Chor, aber jene zarte Beweglichkeit der Frauen- und auch der Männerstimmen im Piano bei fast vollkommener Deutlichkeit der Aussprache waren Zeugnis eingehender Probenarbeit und hoher Gesangskultur. Unter den ausgezeichneten Solisten (E. Höngen, A. Dermota, P. Schöffler)» tat sidi Elisabeth Schwarzkopf in der weitaus dankbarsten Partie des Soprans besonders hervor. A. Forer an der Orgel und Isolde Ahlgrimm am Cembalo wirkten wenig auffällig an verantwortungsvoller Stelle mit absoluter Zuverlässigkeit.
Die große Tradition des Bachschen und des Händeischen Oratoriums führt Mozart in seinem „R e q u i e m“ weiter. Auch in Mozarts eigenem Schaffen bereitet sich der sakrale Ton vor. Im „Don Giovanni“ greift die überirdische Macht selbstherrlich, drohend und rächend ein, und in der „Zauberflöte“ offenbart sie sich als die „höhere Ordnung“, an welcher das irdische Streben des Menschen gemessen wird; Spuren eines ausgesprochen sakralen Stils finden sich im Choral der Geharnischten und in der großen Fuge. Die Tonart d-moll bestimmt den Charakter des „Requiems“ und den des Vorspiels zu „Don Giovanni“ ebenso wie später Beethovens IX. und Bruckners III. Symphonie. Entwicklungsgeschichtlich stellt sich Mozart» „Requiem“ als Vorstufe zu'Beethovens „Missa Solemnis“ dar. So sehr Mozarts Werk auch Zeugnis eines innerlich selbständigen Verhältnisses zum Gegenstand der Darstellung sein mag, so streng und eindeutig ist seine stilistische Haltuhg. Hierin — und in einer Reihe von Anweisungen, die Mozart seinem Schüler gab — liegt die Schwierigkeit, den Anteil Süßmayers bei der Vollendung des Werkes musikphilologisch genau zu fixieren.
Die Wiedergabe durch Mitglieder der Hofmusikkapelle, der Philharmoniker, des Staatsopernchors und die Wiener Sängerknaben unter der Leitung von Karl Böhm war sauber und erfreute — infolge der kleinen Besetzung von Chor und Orchester — durch klare Stimmführung. Der Gesamteindruck war der einer guter Durchschnittsleistung. Die Soli sangen Hugo Mever-
Welfing und Harald Pröglhöf; an der Orgel begleitete Josef Böhm.
Wie für Mozarts letztes Werk, so gab auch für Verdis „Requiem“ ein äußerer Anlaß den Impuls zur Komposition. In seiner Gesamthaltung kann es nur bedingt als geistliches Oratorium gelten. Immer wieder kann man hören und lesen, daß dieses Werk auch musikalisch, seiner Substanz nach, eine Sonderstellung im Schaffen Verdis einnehme. Natürlich sind Form und Besetzung dem Gegenstand angepaßt. In der Substanz aber haben wir es mit einer wirkungsvollen, vor keinem äußerlichen Effekt zurückschreckenden Opernmusik zu tun. Verdi, der edle Humanist und Freigeist, hat zum Text lediglich Beziehung als Dramatiker. Bezeichnenderweise zeigt das Werk auch ein Stilgemisch, welches man immer dort feststellen kann, wo Gehalt und Form sich nicht ganz entsprechen. Gerade beim Anhören jener Teile, wo Verdi sich dem strengen kirchlichen Stil, der Grego-rianik, nähert (im Offertorium, Agnus Dei und Libera me mit seinen psalmodierenden Chorstellen), sträubt sich unser Gefühl gegen die romantisch-harmonische Ausdeutung der gregorianischen Melodien und die bedenkenlos-naive Mischung disparatester Stilelemente. Das „Italienische“ als gemeinsamer Nenner will uns kaum genügen.
John BarbirolU, der englische Dirigent italienischer Herkunft, dirigierte das Werk opernhaft-dramatisdi —' und tat recht damit. Die Klangkultur des Philharmonischen Orchesters bewahrte uns vor allzu grellen Effekten, der Staatsopernchor und die vier ausgezeichneten Solisten, die Opernsänger L. Welitsdi, E. Nicolaidi, J. PatZak und E. Koren, waren in ihrem Element und boten überdurchschnittliche Leistungen. Der Gesamt-. Stil der Aufführung entsprach dem Geist des Werkes und hielt sien in Grenzen, die der Text zieht und welche die Musik ständig zu überspülen versucht.
Die weltlichen Oratorien haben größtenteils historische, insbesondere antike Stoffe zum Gegenstand, „ödipus auf Kolo-n o s“ umfaßt jenen Teil der Trilogie des Sophokles, in welchem geschildert wird, wie der blinde ödipus, geächtet und verbannt, von seiner Tochter Antigone geleitet im Hain der Eumeniden Schutz und Asyl findet. Mendelssohn — der „halkyonische Meister“, wie ihn Nietzsche einmal nannte —, sieht die Antike ganz in jenem mildverklärten Licht, wie Winckelmann sie uns zeigte. In der Vertonung der Chöre folgt er fast ausnahmslos dem antiken Versmaß in der Übertragung J. Ch. Donners. (Nur jeweils die letzten Worte einer Strophe werden melismatisch verziert oder gedehnt.) Die genaue Anlehnung an den Sprachrhythmus bewahrt den Komponisten vor den gröbsten stilistischen Entgleisungen. So wirken diese Chorlieder als Ausdruck eines rückschauenden, leidenschaftslosen Verhältnisses zur Antike zwar einheitlich, aber etwas farblos und monoton: klassizistisch.
Die Darbietung' des Werkes, das in Wien zum erstenmal 1855 und zuletzt 1909 aufgeführt wurde, hatte fast den Reiz einer Erstaufführung. Der Wiener Männergesangverein unter F. Großmänn, von den Sympnonikern begleitet, war diesmal vor keine allzu schwierige Aufgabe gestellt. Die neue deutsche Nachdichtung des Textes von R. Bayr sprachen bekannte Wiener Schauspieler (E. Baiser — ödipus, Elisabeth Kallina — Antigone, Fred Liewebr— Theseus und andere), ohne den statuarischen Charakter antiker Tragödiengestalten sowie den Stil einer nichtszenischen Aufführung genügend zu berücksichtigen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!