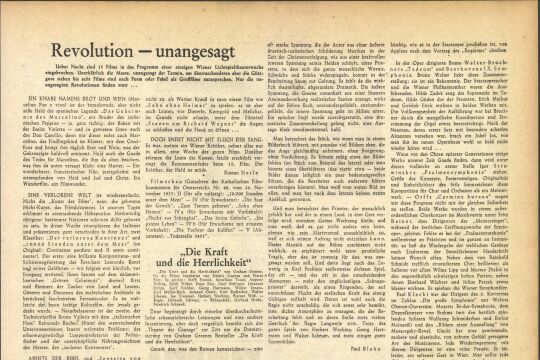Paradeensemble für Verdi
Verdis „Don Carlos“, langerwartete und einzige große Premiere der Salzburger Festspiele 1975, zugleich eine der aufwendigsten Opernproduktionen des Jahres in Europa, war auch einer der größten Erfolge, die Salzburg seit langem verbuchen konnte: Scharte doch Herbert von Karajan Spitzensänger um sich, wie wir sie in dieser Vollzähligkeit etwa in einer Wiener Staatsopernaufführung seit Jahren vergeblich suchen und wie sie auch in Paris, an der Scala, der Met oder in Covent Garden als Verdi-Ensemble kaum zu finden sind. Und dementsprechend ging aller Glanz dieser beispielhaften Aufführung vor allem von den Sängern und von der musikalischen Leitung aus ...
Verdis „Don Carlos“, langerwartete und einzige große Premiere der Salzburger Festspiele 1975, zugleich eine der aufwendigsten Opernproduktionen des Jahres in Europa, war auch einer der größten Erfolge, die Salzburg seit langem verbuchen konnte: Scharte doch Herbert von Karajan Spitzensänger um sich, wie wir sie in dieser Vollzähligkeit etwa in einer Wiener Staatsopernaufführung seit Jahren vergeblich suchen und wie sie auch in Paris, an der Scala, der Met oder in Covent Garden als Verdi-Ensemble kaum zu finden sind. Und dementsprechend ging aller Glanz dieser beispielhaften Aufführung vor allem von den Sängern und von der musikalischen Leitung aus ...
Natürlich zuerst einmal von Karajan selbst, der sich mit dieser ■wiedergäbe von seinem früheren überhitzten Verdi-Stil — man denke nur an den Salzburger „Othello“ — absetzt. Er sucht jetzt die Tiefen dieser Musik, streicht vom Klangprunk eine Menge ab. Nachgedunkelt wirkte diesmal die Orchesterpalette, mit der die Wiener Philharmoniker aufwarteten, verdüstert, wie es die dunklen Schicksalsverkettungen in dieser Oper wollen. Karajan entscheidet sich für massive wuchtige Schritte im Orchester, für gedehnte Phrasen und schwere Tempi. Die Szenen scheinen von der Musik geradezu belastet, die Heiterkeit, wie sie etwa noch im Park der Königin aufkommt, wirkt dadurch bewußt aufgesetzt, läßt alles Unheil ahnen und der Optimismus Don Carlos' wird damit sogleich ins Reich der Illusion verbannt. Und die Chöre (Wiener Staatsopernchor, Singverein) unterstreichen noch diese Atmosphäre: Sie klingen unerbittlicher als in den meisten „Car-los“-Aufführungen.
Allerdings haben schließlich auch der Bravour zuneigende Sänger wie Placido Domingo, eine Mirella Freni, eine Christa Ludwig mit dieser Auffassung Karajans nicht selten ihre Probleme. Fordert er doch von ihnen das Äußerste an Stimmbeherrschung, an Materialverausgabung und Volumen, um diese breiten Tempi aufzufüllen. Welche Bela-, stung etwa für den stimmlich imponierend gewachsenen Piero Cappuc-cilli als Marquis Posa in der Gefängnisszene, wenn Karajan musikalisch zu einem schleppenden Schrittempo neigt... Und stellenweise hat man das Gefühl, daß hier den Sängerin doch zuviel von ihrem Bravourglanz genommen wird, ja, daß manche Szene noch dichter geriete, wenn Karajan nicht so bewußt den Lauf drosselte. Doch das alles kann den einen Eindruck nicht mindern, den man von diesem „Don Carlos“ mitnimmt: daß es eine faszinierende Aufführung ist, eine Seltenheit auf der internationalen Opernszene.
Im Grunde müßte dieser Abend eigentlich „Philipp II. von Spanien“ heißen: Denn Nicolai Ghiaurov, den wir schon sehr oft sehr gut in dieser Partie gehört haben,, singt sie mit einer Intensität und strahlenden
Größe des Basses, wie wir es denn noch selten erlebt habere Er steigert sich in den dramatischen Ausforür“ chen, vor allem in der Szene mit dem Großinquisitor, zu beklemmender Wucht, Ausdrucksgewalt. Die Verzweiflung ist dagegen um so erschütternder. Als Darsteller dominiert er auf der Salzburger Bühne mühelos.
In Mirella Freni ist ihm eine lichtvolle Königin Elisabeth an die Seite gestellt: ein zartes Wesen, das die leichte Laranoyanz dieser Partie mildert und durch kluge psychologische Deutung ersetzt. Stimmlich begeistert die sanfte Schönheit ihres Soprans. Ein Geschöpf, eingezwängt in die Kälte dieses Hofes, durch Sanftmut, Melancholie und die Träume vom Glück im Grunde den Gegnern ausgeliefert. Man versteht erst so, daß sie sich des einstigen Geliebten und Verlobten Carlos weder erwehren noch ihn in seinem illusionsschwangeren Vorwärtsdrängen leiten kann. „Mir erkoren, mir verloren“ könnte sie mit Wagners Isolde sagen. (Was Karajan in seiner Inszenierung fast schon überdeutlich, in einer Schlußszene in Blaulicht und totaler Vernebelung, in einer Art „Liebestod“ Elisabeths zeigt.) ;i§5|JfSI
Don Carlos, gesungen vom unvergleichlichen Placido Domingo, wird hier als menschliche Figur erst wirklich begreifbar. Ein unverbesserlicher Idealist, der impulsiv, ungestüm, ohne Konzept durch diese Welt stürmt. Und obwohl Domingo Verdis Lyrik mit berückendem Tenorschmelz deutet, versteht er dennoch auch die psychische Labilität dieses degenerierten Prinzen zu modellieren. Ein an Enttäuschungen Gebrochener wird sichtbar.
Piero Cappuccilli singt den Posa. Und man kann nur staunen, wie er sich gewandelt, wie er seine Stimme in der Zusammenarbeit mit Karajan entfaltet hat. Dieser Posa, der früher in seiner Wiedergabe einförmig, auch einschichtig wirkte, hat Ausdruckstiefe, etwas Beschwörendes. Persönlichkeit wird spürbar. Und das Stimmaterial versteht er jetzt viel differenzierter einzusetzen. Als Prinzessin Eboli ist Christa Ludwig zu hören, die in der Premiere nicht ideal disponiert war und die zweite Vorstellung bereits absagen mußte. Eine Künstlerin, die stets verläßlich, mit feinem Empfinden für die Reize einer Partie singt Doch hier enttäuscht sie ein wenig. In der Parkszene strich man ihr die zweite Liedstrophe, in ihrer großen Arie im Gemach des Königs wirkte sie überanstrengt.
Unverständlich blieb, daß und wie Gheorghe Crasnaru als Großinquisitor in diese Paradebesetzung kam: Eine kleine, kaum tragende Stimme. Von Schwärze, von drohendem Feuer keine Spur. Kein Zoll Persönlichkeit. Die Auseinandersetzung mit dem König findet im Grunde gar nicht statt... In der Reihe der kleineren Partien ist'Vor allem Jose %an 'Dem als-''»&«'!vV<sei«eT perfekte Be-: setzung.
Übrigens hat auch der Regisseur Herbert von Karajan neben dem Musiker in dieser Aufführung bestätigt, daß ihm „Don Carlos“ liegt: Er versucht zwar nicht, ein psychologisch kunstvolles Inszenierungskonzept zu verwirklichen, aber er löst die Szenen optisch sehr reizvoll, stellt und arrangiert die Bilder mit sicherem Geschmack, und zwar so sicher, daß die viel zu breite Bühne keinen Moment zu groß oder leer wirkt. Ein lebendiges Szenenganzes präsentiert sich da, für das übrigens Günther Schneider-Siemssen ein durchaus adäquates Bühnenbild geschaffen hat. Als Einheitselement wählte er ein Grundrißdreieck, mit der Spitze zum Publikum. Darauf baut er sein Verwandlungssystem: Palast, Kathedrale, Parkanlagen, Klosterhallen, ja selbst die Gemächer Philipps fügen sich tadellos in diesen Raster ein. Und für die Auto-dafeszene ist Karajan und Schnei-der-Siemssen ein imponierender Wurf gelungen, der von allen Klischees abweicht: Die Ketzerverbrennung findet direkt vor dem Publikum statt, dahinter auf rot ausgeschlagener Tribüne beten König, Königin und Hofstaat. Ein bombastisches Spektakel mit Flammen, Rauch, Qualm, den an den Scheiterhaufen gehefteten Sündern, die sich im Feuer winden... Ein Szenenschluß, wie er der Großen Oper ansteht. Ein Meyeiibeer hätte Salzburg darum beneidet.^/fQ ,JfX^
Schade ist nur, daß Karajan sich nicht entschließen konnte, die fünf-aktige Fassung des „Don Carlos“, die Verdi 1867 in Paris herausbrachte, in Salzburg zu spielen. Gewiß, sie ist aufwendiger, wesentlich länger. Aber gerade für ein Festival von der Exklusivität Salzburgs wäre es wohl eine Attraktion gewesen. Um so mehr, als erst sie verständlich macht, was sich im „Carlos“ eigentlich an Ideen, an psychologischen Motivationen, historischen Verknüpfungen verbirgt. Denn durch die Streichung des ganzen ersten Aktes und zweier Szenen des zweiten und dritten Akts und der Ballette irt der Fassung von 1884, die Verdi für Wien herstellte, bleibt so vieles in dieser Konfliktsituation zwischen
Philipp, Elisabeth, Carlos und Eboli unverständlich. Dennoch versuchte Karajan zum Beispiel die Parkszene,“ in der die als Königin verkleidete Eboli auf den Prinzen Carlos trifft, psychologisch zu verdeutlichen; und auch das ist ihm besonders gut gelungen.
Zwei Konzerte des London Sym-phony Orchestra dominierten in der dritten Woche der Salzburger Festspiele: eines unter Dr. Karl Böhm, das andere unter Leonard Bernstein, der erstmals nach 16 Jahren wieder in Salzburg gastiert und am 30. August mit den Wiener Philharmonikern auch noch Gustav Mahlers Achte Symphonie aufführen wird (die Verfilmung findet Anfang September in Wien statt). Bernstein, Amerikas Music-Showmaster Nummer 1, präsentierte'sich zugleich als Pianist, Dirigent und Komponist. Problematisch wirkte dabei vor allem seine Wiedergabe von Mozarts G-Dur-Klavierkonzert (KV 453).
Natürlich ist Bernstein eine so starke Persönlichkeit, daß er mit seiner impulsiven Wiedergabe das Publikum zur Begeisterung mitreißt. Denn die Show, die er als dirigierender Pianist und klavierspielender Orchesterleiter abzieht, ist unvergleichlich. Aber Mozart kommt dabei stellenweise zu kurz. Vor allem seine Allegro-Tempi wirkten ungestüm, manches zu hastig, manches verschleppt. Lediglich im Andante ließ er die Melodie aussingen.
Mit der Wiedergabe seiner Chi-chester-Psalms erwies er seinem eigenen Werk einen hervorragenden Dienst. Denn nur er selbst kann dieses stellenweise doch recht banale Werk, das eine Art jüdischen _ Religionsgefühls in der Musik erzeugen will, wirklich so dirigieren, wie man es im Großen Festspielhaus hörte. Voll dramatischer Spannungen, unverwechselbar pathetisch (vor allem in der Führung des Wiener Jeunesse-Chors), dann wieder bewußt kindlich naiv... Zum Gedenken an Dimitri Schostako-witsch dirigierte er das Largo aus dessen 5. Symphonie und nach der Pause Sipelius „Fünfte“.
Im Mittelpunkt des Böhm-Konzerts stand übrigens eine ungewöhnlich spannende Wiedergabe des Schumann-Klavierkonzerts: der Russe Emil Gilels spielte sie. Wer Gilels als Nur-Techniker kennt, staunte. Denn jetzt hat er sein Spiel gleichsam ins Gegenteil verkehrt, vernachlässigt geradezu das technische Element und widmet sich fast ausschließlich der Vertiefung des Ausdrucks, dem Ausloten musikalischer Zusammenhänge. Daß dabei Schumanns festliches Klavierkonzert zu kurz kommt, kann nicht verwundern. Denn bei Gilels merkt man sozusagen, wie er sich vor dem Publikum mit dem Stück zusammenrauft, wie er das Werk in eine Form zu zwingen versucht. Das ist gewiß sehr reizvoll, ja, ein paarmal traut man sich kaum zu atmen, weil man gespannt ist, wie er wohl in seinem eigenbrötlerischen Spiel weiterfahren will; aber schließlich bleibt der Zuhörer doch der Enttäuschte. Denn mit dem fabelhaften Orchester und Karl Böhm fand Gilels stellenweise nicht einmal zusammen, manche technisch heikle Stelle überspielte er. Daß die Londoner einen schlechthin idealen Schumann-Klang anzubieten haben, bewiesen sie erst nach der Pause mit des Komponisten 4. Symphonie. Da stimmte einfach alles. Böhm führt das Orchester zwar mit einem Mindestaufwand an Zeichengebung, aber die Musiker, mit denen er sich besonders gut versteht, wissen genau, was er will, worauf es ankommt.
Überzeugender wirkte Gilels in seinem Solistenkonzert im Großen Festspielhaus: Besonders Liszts h-Moll-Sonate scheint ihm auch persönlich zu liegen. Alle falsche Hektik, alle falsche Bravour und die lärmenden Ausbrüche, die manche Pianisten in dieses Werk legen, streifte er ab: Das Werk wirkte geläutert, klarldnig; die Montagetechnik von Phantasieelementen wie auch die thematischen Verflechtungen klangen um so durchsichtiger. Mit fein reguliertem Anschlag paßte Gilels Detail um Detail zueinander. Beethovens Sonaten op. 79, op. 81a („Lea Adieux“) und op. 90 wirkten dagegen eher glatt, wenngleich Gilels auch bei ihnen seine Art, sich ein Werk zu erarbeiten, offen darlegte.