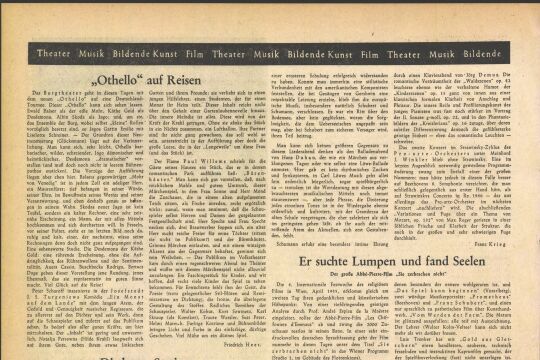Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Viel Mozart, aber kein Mozart-Stil
Mit Ausnahme von Verdis „Don Carlos“ spielen die Salzburger Festspiele heuer ausschließlich Reprisen. Die nun vier Jahre alte „Hochzeit des Figaro“, die „Entführung aus dem Serail“, die sogar schon ihr zehnjähriges Jubiläum begeht, die zwei Jahre alte „Frau ohne Schatten“, „Cosi fan tutte“, die drei Saisonen absolviert hat. Das Diktat des budgetären Engpasses, der Einsparungen auf allen Sektoren bedeutet, und die Notwendigkeit, jede Produktion in Hinkunft bis zur Altersgrenze aus-und abzunützen, bestimmen nun für die nächsten Jahre das Gesicht des Festivals.
Mit Ausnahme von Verdis „Don Carlos“ spielen die Salzburger Festspiele heuer ausschließlich Reprisen. Die nun vier Jahre alte „Hochzeit des Figaro“, die „Entführung aus dem Serail“, die sogar schon ihr zehnjähriges Jubiläum begeht, die zwei Jahre alte „Frau ohne Schatten“, „Cosi fan tutte“, die drei Saisonen absolviert hat. Das Diktat des budgetären Engpasses, der Einsparungen auf allen Sektoren bedeutet, und die Notwendigkeit, jede Produktion in Hinkunft bis zur Altersgrenze aus-und abzunützen, bestimmen nun für die nächsten Jahre das Gesicht des Festivals.
Das muß sich auf die Qualität der Aurführungen durchaus nicht abträglich auswirken. Bei der „Frau ohne Schatten“ etwa, wurde erst bei der diesjährigen Reprise die große Qualitätssteigerung möglich. Bei der „Hochzeit des Figaro“ hält Herbert von Karajan seit dem zweiten Jahr konstant das hohe Niveau, ja die Erlesenheit der musikalischen Realisation. Nur bei der „Entführung“ hat erst die Jubiläumssaison sich zur Katastrophe ausgewachsen. Denn seit seinem spektakulären Abgang 1974 aus Salzburg und nach dem peinlichen Streit um die musikalische Leitung dieser „Entführung“ will Streh-ler mit Salzburg nichts mehr zu tun haben. Also schickte er seinen Mitarbeiter Ferruccio Solerl, der das Konzept der „Entführung“ auffrischen mußte.
Was er da zustandegebracht hat, ist eine Banalisierung der Ideen Strehlers, eine leere Fassung ahne Geist, Witz, Ironie. Ja, nicht einmal die technischen Voraussetzungen für dieses Konzept sind exakt erfüllt. Die originalen Lichteinstellungen Strehlers sind allzu oft bloß irgendwo getroffen.
Wo ein Marionettentheater mit Schattenspielefifekten seinen eigenartigen Zauber atmen soll, hat Soleri ein Spektaktel zusammengebastelt, das irgendwie abschnurrt: lieblos, ohne Strehlers optische Kultur. Eine Schule der Beiläufigkeit. Und der Dirigent L^fl^egerstaW<y'hleiii da™ Soleri kaum nach. Wie er die Sänger führt, läßt uns zweifeln, ob er zu Mozarts Musik überhaupt Beziehungen hat.
Die Besetzung ist übrigens nicht gerade arm an Durchschnittlichkeit. Weder Margaret Price als Constanze, deren Stimme bereits viel zu schwer ist und in den Koloraturen stellenweise versagt, noch Werner Hollwegs unprofilierter Stadttheater-Belmon-te haben Festspielniveau. Das Paar Blondchen-Pedrillo (Sona Ghazarian, Gerhard Vnger) sind da schon überzeugender besetzt. Fernando Corena läßt als Osmin den düsteren Baß vermissen, der eigentlich für das „Erst gespießt und dann gehangen“ nötig wäre. Er trifft auch nicht mehr so recht die komödiantisch überdrehte Schwerfälligkeit, wie sie Strehler wünschte. Und Kurt Heintel als Bassa Selim deklamiert nur pathetisch Phrasen, wo Heitau früher eine psychische Zwangslage, eine Entscheidung zur Toleranz fühlbar gemacht hat. Auf diese „Entführung“ kann man jedenfalls verzichten.
Hingegen ist der Salzburger „Figaro“ im Groden Festspielhaus immer noch ein Ereignis. Und zwar von den Sängern her, wie von Karajan. Er gibt dieser Aufführung musikalischen Glanz, oft bis zum Siedepunkt hochgetriebene Spannung, steigert die Tempi, daß die Funken stieben. Wieder kann man das temperamentvolljugendliche, dabei würdevolle Grafenpaar Almaviva bewundern: Elizabeth Harwood und Torrn Krause singen es mit imponierender Stimmkultur. Edith Mathis verfügt über eine geschmeidige, weich timbrierte Stimme, die ihre Susanna lieblich, fast schon herzig erscheinen läßt. Jose van Dam ist stimmlich allmählich zu einem vorzüglichen Figaro geworden, der nur noch im Spiel mehr die politische Profilienung dieser Figur hervorkehren müßte. Als Cherubino ist erneut Frederico von Stade zu hören, deren reines, klares Material von Jahr zu Jahr besser gefällt. Außerdem überrascht ihre Spielfreudigkeit, die sie selbst vor kniffligen Turnübungen nicht zurückschrecken läßt. Immer wieder ein Idealgespann sind Jane Berbie (Marcellina), Paolo Montarsolo (Bartolo) und Michel Senechal (Basilio).
Ein wenig problematisch geblieben ist freilich Jean-Pierre Ponnelles Inszenierung, die von Jahr zu Jahr detailreicher, um nicht zu sagen: überladener wirkt. Die hektische Betriebsamkeit kennt bald keine Grenzen mehr. Alles schnurrt ab wie bei einem Automaten. Man könnte dieses Geturtel und Getolle zwar durchaus auch aus Mozarts Partitur und aus dem Libretto von Beaumarchais und Da Ponte herauslesen. Aber das störende Moment, das verhindert, daß dieser „Figaro“ zu einer Paradeaufführung aus einem Guß wird und so etwas wie einen Mozart-Stil vorzeigt, übersieht Ponnelle immer wieder: Es sind die regietechnischen Pannen, diese leidigen logischen Fehler, sinnlose Zwischenvorhänge im dritten Akt, die über alle Maßen ausgespielte Nadelsuche Bar-berinas vor geschlossenen Vorhang, die Unlogik, mit der die Gräfin und Susanna die Entkleidungsszene Che-rubinos im zweiten Akt vorführen, die falsche Komödiantik des Gärtners ... Das sind Lücken im Regiekonzept, die wie Sand im Getriebe dieses albschnurrenden Mechanismus wirken.
Zwei Orchesterkonzerte unter Claudio Abbado und Riccardo Muti mit den Wiener Philharmonikern; ein Konzert des London Symphony Orchestra unter Andre Previn, zwei Liederabende, von Leontyne Price und Dietrich Fischer-Dieskau, sowie zwei Mozart-Matineen, zwei Serenaden und ein Kammerkonzert bescherte die erste Salzburger Festspielwoche. Sensationell vor allem das Salzburger Comeback der schwarzen Sopranistin Leontyne Price.
Nach mehr als zehn Jahren kehrt Karajans Donna Anna und Leonora nach Salzburg zurück; und sie hat, nach Uberwindung ihrer Stimmkrise, bis heute nichts vom Flüidum der schwarzen Primadonna, des Weltstars verloren. Leontyne Price wirkt heute noch wie ein Elementarereignis. Am meisten fasziniert sie in mu-sikdramatischen Werken, etwa in Puccinis „La Rondine“ und „Madame Butterfly“ oder in Gershwins „Summertime-', also mit den Zugaben, die sie an ihr reines Liedprogramm anhängte. Da spielt sie souverän all ihr Können aus: die eminent kultivierte Technik, dank der sie manchmal auftretende kleine Probleme mit dem Stimmaterial der Mittellage souverän kaschiert, die strahlende makellose Höhe, die heute noch durch Farbigkeit des Ausdrucks und Leuchtkraft begeistert, nicht zuletzt die persönliche Ausstrahlung. Denn sie ist eine Persönlichkeit, bei der alles zusammenstimmt... Glanzlichter ihres Liedprogramms waren natürlich die Spirituals. Da schöpft sie aus der Tiefe eigener Empfindung, aus ihrer Welt. Aber auch in allen anderen Stücken romanischer Herkunft, etwa bei Poulencs witzig pointiertem „Pont“ und „Violon“, oder in Respi-ghis gefühlvollen Piecen setzt sie mit Fingerspitzengefühl Glanzlichter. Sie hält die Stimme schmiegsam, tastet die Melodiebögen, die Miniaturszenen behutsam ab. Und da funkelt und blitzt alles. Kein Glück hatte sie hingegen mit Beethovens „Ah perfi-do“, weil sie diese Szene und Arie stilistisch nicht erfaßt. Hörbar nicht ihre Sache sind Richard Strauss' Lieder, obgleich sie etwa „Als müdem Lied erklang“ sehr kultiviert vorträgt. Am Flügel assistierte ihr David Garvey.
Großen Jubel ernteten die Wiener Philharmoniker mit ihren Konzerten unter Abbado im Großen Festspielhaus und unter Muti in der Felsenreitschule. Mit beiden Dirigenten ist die Zusammenarbeit organisch gewachsen, beide versuchen in ihren Programmen den Klassikern und Romantikern „klassische Moderne“ gegenüberzustellen: Abbado etwa stellte Strauss' „Tod und Verklärung“ Bergs „Drei Orchesterstücke“ (op. 6) gegenüber, die er allerdings zu sanft und apart schillernd deutete und ihnen dafür viel von ihrer expressionistischen Kraft, von ihrer gewaltsamen Entladung (am deutlichsten in den Hammerschlägen) und ihrer Symbolik der Zerstörung nahm. Zu leger ging auch Muti mit Bartöks „Deux Images“ von 1910 um: die schillernde Farbenvision nach De-bussy-Art im ersten Teil („In voller Blüte“) klang hektisch, das Dorf-Rondo hingegen zu wenig markant, wobei außerdem noch die Verfassung des Blechs einiges zu wünschen übrig ließ. Schwer zu sagen, wie weit dabei die akustischen Verhältnisse und die Feuchtigkeit der Felsenreitschule den philharmonischen Bläsern Probleme schufen.
Solist des Abbado-Konzerts war Clifford Curzon, ein renommierter Mozart-jPianist, mit dem die Philharmoniker immer wieder musizieren: Diesmal wirkte er unkonzentriert, seine Wiedergabe des c-Moll-Klavierkonzertes (KV 491) klang schlampig; mit Abbado geriet er im Tempo auseinander, vieles klang altmodisch eingedickt. Für ein Festkonzert eine reichlich fragwürdige Wiedergabe, die eigentlich die gleichen Eigenschaften zeigte, wie Cur-zons Konzert im Jahr 1974. Und irgendwie ist seine Wiedergabe für Salzburg symptomatisch. Denn da wird viel Mozart gespielt (im nächsten Jahr wahrscheinlich sogar ausschließlich Mozart-Opern), aber noch nie war man einem Mozart-iStil so fern wie jetzt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!