Mozarts Musikdramen bei den Salzburger Festspielen:
Faszinationen und Flops.
Das gesamte Bühnenschaffen Wolfgang Amadeus Mozarts: Dieses Geschenk machen die Salzburger Festspiele ihrem Publikum zum 250. Geburtstag des Genies. Alle 22 Opern, Frühwerke und Fragmente eingeschlossen, kommen diesen Sommer an Mozarts Geburtsort zur Aufführung. Diese Kraftanstrengung erlaubt auf einzigartige Weise, die künstlerische Entwicklung des Komponisten nachzuvollziehen - und nicht nur die. In Mozarts individuellem künstlerischen Reifeprozess spiegelt sich auch ein Stück Operngeschichte wider, die hier wie in einem Brennglas auf den Punkt gebracht ist: Schon die ersten vier Salzburger Aufführungen umspannen die Entwicklung des europäischen Musiktheaters von der barocken Opera seria hin zum musikalischen Drama und, wenn man so will, bis zum Heraufdämmern der Romantik.
Wann, wenn nicht im Mozartjahr, soll ein Werk wie "Il re pastore" (1775) in großem Rahmen zur Aufführung kommen? Es handelt sich um eine so genannte Serenata, eine für fürstliche Gärten oder Paläste bestimmte, abgespeckte Opera seria, bestehend aus einer strengen Abfolge von Rezitativen, in denen die Handlung vorangetrieben wird, und nach einem bestimmten Schema konstruierten Arien, in denen das Gefühlsleben der Protagonisten Ausdruck findet. Im Mittelpunkt steht der edle Hirte Aminta (Annette Dasch), der von Alexander dem Großen (Kresimir Spicer) als rechtmäßiger König von Sidon eingesetzt wird. Doch weil Aminta nicht die für ihn ausgesuchte Prinzessin Tamiri (Arpiné Rahdjian), sondern seine geliebte Nymphe Elisa (Marlis Petersen) heiraten will, kommt es kurz zu Unstimmigkeiten, bevor sich alles im obligaten Happy End, im Lieto Fine auflöst.
Die langen Rezitative, denen in der Großen Universitätsaula obendrein die Übersetzungen fehlen, sind ermüdend, doch dann wieder gelingt es Thomas Hengelbrock an der Spitze des Balthasar-Neumann-Ensembles, die Musik des jungen Komponisten regelrecht zum Brodeln zu bringen, so wie man es sonst nur von Barockmusik kennt. Höhepunkt ist eine ergreifende Arie Amintas mit Violinsolo, bei der Hengelbrock in seiner Funktion als Regisseur Sebastian Hamann wie einen Stehgeiger in Szene setzt. Die für die Da-capo-Arien typische Improvisation hingegen beherrschen heute offenbar nur noch wenige Sänger. Zu Mozarts Zeiten waren Koloraturen und Kantilenen eben noch nicht in Stein gemeißelt.
Von den Jugendwerken ...
"Lucio Silla" (1772) ist eine waschechte Opera seria, auch hier schreitet die Handlung in den Rezitativen voran, während die Gefühle in den Da-capo-Arien vertieft werden - vom Aufbau also wie eine Barockoper, aber eben nicht in einer barocken Klangwelt angesiedelt, sondern in einer Mozartschen, wie man sie aus den zur gleichen Zeit entstandenen Streichquartetten kennt. Tomas Netopil, der das Orchester des Teatro La Fenice Venedig dirigiert, vermag dem Werk freilich keine überraschenden Feinheiten zu entringen, zu hören ist ein gefälliger, etwas biederer Mozart-Sound.
Dass dieses Stück um Liebe, Verrat und Politik am Hofe des römischen Diktators Sulla bühnentauglich ist, hat kürzlich das Theater an der Wien bewiesen. Denn in Salzburg hat niemand anderer als der künftige Intendant Jürgen Flimm die Inszenierung völlig vermasselt. Es fängt damit an, dass ausgerechnet bei einem Stück, das im Alten Rom spielt, die in den Fels gehauenen Arkaden der Felsenreitschule ungenutzt bleiben. Die chaotische Bühne (Christian Bussmann) sieht aus wie das Kulissendepot der Salzburger Festspiele, in der noch ein paar Tapetenwände aus alten Marthaler-Inszenierungen herumstehen. Scharen von Komparsen und Tänzern irren über die Bühne und lenken von den Protagonisten ab, die aufgrund der unprofessionellen Lichtführung leicht aus den Augen zu verlieren sind. Gelungen ist allein die Umdeutung des abrupten, nicht einmal durch eine entsprechende Arie erhellten Lieto Fine in ein realistischeres Ende. Von den Solisten bleiben Monica Bacelli (Cecilio), Julia Kleiter (Celia) und vor allem Annick Massis in Erinnerung, die in der Partie der Giunia genregerecht mit aberwitzigen Koloraturen brilliert.
Auch unverkennbar Mozart, aber Lichtjahre entfernt: "Le nozze di Figaro" (1786), die erste der drei kongenialen Kooperationen des nunmehr arrivierten Komponisten und des schillernden Librettisten Lorenzo Da Ponte. Ein vielschichtiges Musikdrama, das bestehen wird, so lange es die Oper gibt. Das geniale Werk funktioniert als leichte Komödie in Rokokokostümen ebenso wie als dunkles Seelendrama, in dem es nichts zu lachen gibt - so nämlich hat es Regisseur Claus Guth im ehemaligen kleinen Festspielhaus, nunmehr Haus für Mozart, auf die Bühne gewuchtet. Alle Beteiligten sind der übermächtigen Spannung zwischen den Polen bürgerlicher Konvention und Eros gnadenlos ausgesetzt. Ibsen und Strindberg lassen grüßen, das Stiegenhaus, in dem dieser "Figaro" spielt, ist direkt einem Ingmar-Bergman-Film entlehnt (Bühne: Christian Schmidt).
Die Aufführung wurde im Vorfeld von gewissen Medien allein auf die Supernova am Opernhimmel, nämlich Anna Netrebko reduziert. Dabei fügt sich der Superstar in der Rolle der schlauen Zofe Susanna klaglos in das Ensemble ein, das der schönen Russin in nichts nachsteht. Eine tolle Stimme, Darstellungskraft und Ausstrahlung haben auch Bo Skovhus als Graf, Ildebrando D'Arcangelo als Figaro und Christine Schäfer als Cherubino (Dorothea Röschmann als Gräfin hat zumindest einen wunderbaren Sopran).
Dass Susanna von Anfang an ein Verhältnis mit dem Grafen unterhält, widerspricht nicht einmal der Musik. Immerhin singt sie ein veritables Liebesduett mit dem Grafen. Auch sonst wartet Nikolaus Harnoncourt, wie nicht anders zu erwarten, mit zahlreichen wohlüberlegten Abweichungen vom Gewohnten auf. So hat der Dirigent die Tempi gehörig variiert, manchmal sind sie schneller als gewohnt, meist aber langsamer, was schon bei der Ouvertüre deutlich ins Ohr sticht und, wie man hört, bei den Wiener Philharmonikern für Diskussionen gesorgt hat.
... zu Figaro und Zauberflöte
Wie eine Pest haben sich die Verdoppelungen von Figuren im Regietheater ausgebreitet, deswegen ist bei einer Gestalt wie "Cherubim" (Uli Kirsch) vorbeugende Skepsis angebracht. Doch dieser Doppelgänger von Cherubino, eine Art geflügelter Amor, an dessen Fäden die Protagonisten zappeln, macht durchaus Sinn. Wie ein Alp lastet er auf des Grafen Schultern, er kommt und geht spektakulär aber am Ende aller Verwirrungen, wenn die Herzen der Schlossbewohner endgültig erkaltet sind, verliert er seine Macht über sie. Ein Entwicklung, die Basilio (Patrick Henckens) vorwegnimmt, wenn er die Vorzüge eines sicheren Panzers preist. Klar, dass Harnoncourt diese oft gestrichene Arie für wesentlich hält und nicht auf sie verzichten will.
Mit der "Zauberflöte" (1791) schließlich, so hat es Harnoncourt einmal gesagt, beginnt die Ära der Romantik im Musiktheater. Doch diese Aufführung im Großen Festspielhaus dirigiert Riccardo Muti und daher klingen die Wiener Philharmoniker, wie man es von ihnen bei Mozart gewohnt ist - und das perfekt. Die bunte Bühne mit ihren naiv-expressionistischen Riesenfiguren basiert auf Entwürfen des im Mai dieses Jahres verstorbenen holländischen Malers und Bildhausers Karel Appel. Die Inszenierung (Pierre Audi) ist märchenhaft, wartet von Versenkungen, Flügen bis hin zu Pyrotechnik mit allen klassischen Theatereffekten auf. Ideal für Kinder, leider aber hat die Aufführung nichts zu bieten, was über die in jedem Opernführer nachzulesende Handlung hinausgeht. Es singen René Pape (Sarastro), Genia Kühmeier (Pamina), Christian Gerhaher (Papageno) und Paul Groves, der allerdings als Tamino alles andere als eine Idealbesetzung ist.
Die überzeugendste Sängerin des Abends ist die großartige Diana Damrau als Königin der Nacht. Und wer mittlerweile durch die Salzburger Schule der frühen Mozartopern gegangen ist, wird sofort erkennen: Die ein überkommenes Prinzip repräsentierende Figur mit ihren expressiven Koloraturen ist ein Relikt aus der alten, ebenso überkommenen Opera seria. Im wahrsten Sinn des Wortes der Abgesang auf eine Kunstform, von der sich Mozart zu jener Zeit schon längst abgelöst hat, ohne sie gering zu schätzen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!























































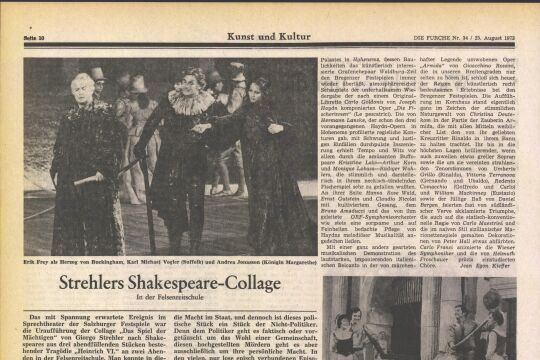































%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)











