Glanz und Elend des Regietheaters: "Die Fledermaus", "Ariadne auf Naxos", "Was ihr wollt" und "Der Fall der Götter" bei den Salzburger Festspielen.
Teilweise tumultös verliefen die letzten Premieren der diesjährigen Salzburger Festspiele. Ob "Fledermaus", "Ariadne auf Naxos" oder "Was ihr wollt" - in Buhstürmen und -orkanen, wie zu lesen war, entlud sich der Zorn des Premierenpublikums über das so genannte Regietheater.
Die Buhrufer, die in den Folgevorstellungen merklich weniger wurden, kämpfen jedoch auf verlorenem Posten. Der Forderung nach "Werktreue", hinter der die Forderung nach einem naiven Realismus steckt, kann das heutige Theater nicht mehr nachkommen. Mit dem Siegeszug des Films hat das Theater als populäre Wirklichkeitssimulation ausgedient. Eine möglichst lebensechte Geschichte in möglichst authentischer Kleidung an möglichst originalen Schauplätzen möglichst wirklichkeitsnah zu erzählen, das können Kino und Fernsehen besser. Zu diesen Medien ist auch das breite, an Kunst nicht interessierte Publikum abgewandert.
Die Bühne stellt sich als ein technisch hoffnungslos überholtes Medium dar, auf den gängigen Werken der Theater- und Opernliteratur lastet der Staub von Jahrzehnten, ja Jahrhunderten. Damit Sprech- und Musiktheater noch eine künstlerische und ökonomische Existenzberechtigung haben, müssen sie etwas anders bieten als naiven Realismus. Die Antwort ist das so genannte Regietheater.
Warum Regietheater?
So werden Stücke, die in weiter Vergangenheit spielen, szenisch in die Gegenwart versetzt, damit die politischen, zwischenmenschlichen und inneren Konflikte von Figuren aus dem England des 17. Jahrhunderts oder dem Alten Griechenland genauso aktuell erscheinen, wie sie tatsächlich sind. Welchen Grund gäbe es, Shakespeare oder Sophokles überhaupt noch aufzuführen, wenn dem nicht so wäre?
Das Regietheater kann auch auf Ebenen unter der sichtbaren Oberfläche der Handlung eines Stückes verweisen: Zwischenmenschliche werden als soziale Konflikte, existentielle Probleme als gesellschaftlich bedingt gedeutet; das Unterbewusstsein der Figuren kann genauso visualisiert werden wie geschichtliche Zusammenhänge.
Schließlich kann das Stück kommentiert werden. In so manchem Werk treten Ideologien oder Werte zu Tage, die heute nicht mehr vertretbar sind. Darauf weist das Regietheater zu Recht hin.
Selbstverständlich führt Regietheater nicht automatisch zum künstlerischen Erfolg. Es gibt hervorragende und katastrophale Regietheater-Aufführungen, ebenso wie es hervorragende und katastrophale konventionelle Aufführungen gibt. Für das Gelingen einer Aufführung gibt es Kriterien, zum Beispiel: Machen die Regieeinfälle Sinn? Ist das Ergebnis aus einem Guss? Die letzten vier großen Premieren der Salzburger Festspiele erlaubten in geradezu exemplarischer Weise einen Blick auf Glanz und Elend des Regietheaters.
Regisseur Hans Neuenfels beteuert, seine umstrittene "Fledermaus"-Inszenierung sei "kein Gag, sondern eine ernsthafte Befragung eines Mythos". Als Provokation wäre sie gelungen, man denke nur an die Empörung der Premierenbesucher, als ernst gemeinte Auseinandersetzung ist sie jedoch völlig misslungen. Zum einen ist die Johann Strauß-Operette in der Felsenreitschule stink-langweilig, das ist der Tod jedes Theaters. Zum anderen gelingt es Neuenfels nur zu einem geringen Prozentsatz, all das, was ihm eingefallen ist, auch in verständlicher Form zu vermitteln. Manches erschließt sich, aber viel zu viele Fragen bleiben offen.
Der dekadente Fürst Orlofsky wird von dem Vokalextremisten David Moss verkörpert. Toll, aber warum zum Teufel ereilen ihn andauernd undefinierbare Krämpfe? Bei den Neureichen und Emporkömmlingen wird nicht Champagner getrunken, sondern Kokain geschnupft. Gut beobachtet, doch warum schlafen alle nach Genuss der aufputschenden Droge ein? Orlofskys Schloss ist eine Wunschmaschine, in der Eisenstein (Christoph Homberger) zum Göring-Verschnitt und Frank (Dale Duesing) zum Führer einer faschistischen Partei mutieren. Okay, aber warum verändern sich Rosalinde (Mireille Delunsch) und Adele (Anna Korondi mit der gesanglich überzeugendsten Leistung) nicht? Sicher ist es auch die Fülle an neu erfundenen stummen und nicht stummen Rollen (Eisensteins Kinder, die sich am Ende umbringen), die den Blick auf das versperrt, was Neuenfels eigentlich sagen will.
Der Tiefpunkt der Aufführung ist jedoch der völlig missratene Frosch - obwohl hier die Schuld nicht nur bei Neuenfels liegt. Er hat der hier weiblichen Figur zwar einen zum Teil unerträglichen Text geschrieben ("Das Gefängnis, der grausamste Ort menschlicher Entwürdigung. Selbst die Operette kann darüber nicht hinwegtäuschen"), doch wenn man ihn im Programmheft nachliest, so ist er stellenweise sogar recht lustig. Elisabeth Trissenaar ist zu Humor jedoch offenbar nicht fähig, und so geraten die komischen Passagen ebenso peinlich wie die ernstgemeinten.
Genialer Wurf
"Ariadne auf Naxos" im großen Festspielhaus ist zwar auch alles andere als "werktreu", jedoch das genaue Gegenteil der "Fledermaus", nämlich ein genialer Regie-Wurf. Regisseur Jossi Wieler erzählt dem Zuschauer von einem ungewöhnlichen Abend im Salzburger Festspielhaus und bringt damit das Kunststück zuwege, die beiden so heterogenen Bestandteile des Richard Strauss-Werkes, Vorspiel und Oper in einem Aufzuge, zu einem kompakten Ganzen zu verschweißen.
Ein schwerreicher Mäzen - vielleicht Alberto Vilar, dessen Konterfei einem aus jedem Programmheft entgegenblickt? - gibt ein privates Diner im Salzburger Festspielhaus (Bühne: Anna Viebrock). Zur Unterhaltung hat er eine Operntruppe und eine Rockband engagiert, die in den Gängen des Festspielhauses aufeinandertreffen. Wer zahlt, schafft an, also lässt der Sponsor bestellen, er wünsche einen gemeinsamen Auftritt. Die Jungs und ihre Sängerin Zerbinetta (Natalie Dessay) feixen, der um sein Werk "Ariadne auf Naxos" besorgte Komponist (Susan Graham) und die bornierte Primadonna (Deborah Polaski) weigern sich. Ende des Vorspiels.
Das Crossover findet also nicht statt, und The Zerbinettas lungern weiter in den Festspielhaus-Gängen herum, wo schon drei Putzfrauen (laut Libretto: drei Nymphen) ihrer Arbeit nachgehen. Versunken in Liebeskummer sitzt auch Ariadne (Deborah Polaski), vielleicht Schauspielerin, vielleicht Dramaturgin, in einem Fauteuil. Die Rock-Lady Zerbinetta erklärt der vergeistigten Intellektuellen, wie das so ist mit der Liebe und den Männern und führt es ihr auch gleich vor: Bevor sie mit einem ihrer Bandmitglieder eine schnelle Nummer schieben geht, hinterlässt sie den anderen Stiefel, Top und Höschen als Trost. Als schließlich der fesche Bacchus (Jon Villars), vielleicht Schauspieler, vielleicht Operettensänger, hereinschneit, verliebt sich Ariadne prompt in den Schönling mit Gérard Depardieu-Frisur und ist von ihrem Kummer geheilt.
Perfekt wird diese "Ariadne" freilich erst durch eine nicht zu überbietende musikalische Qualität: Die Sänger sind von allererster Güte, vor allem Natalie Dessay, die hinreissend ihre barocken Wahnsinns-Koloraturen meistert und auch Christoph von Dohnányi, der die Wiener Philharmoniker dirigiert, beherrscht das Strauss-Idiom perfekt. Was man von Marc Minkowski, der bei der "Fledermaus" das Mozarteum Orchester Salzburg dirigiert, nicht behaupten kann. Selten hat Strauß so wenig nach Strauß geklungen; das kann interessant sein - ist es aber in diesem Fall nicht. Ein weiterer Grund für das Misslingen dieser "Fledermaus".
Hier und jetzt
Christoph Marthaler ist ein Regisseur, der zusammen mit seiner kongenialen Bühnenbildnerin Anna Viebrock jedem Stück ein bizarres Pandämonium der Spießigkeit macht. Lässt man sich auf das unentwegte Singen, Turnen, Schlafen, Umfallen und andere Marthalerismen ein, so wird William Shakespeares "Was ihr wollt" im Salzburger Landestheater zu einer gar köstlichen Komödie. Stimmakrobat Graham F. Valentine als Narr, Ueli Jäggi als gefoppter Malvolio und Josef Ostendorf als fetter, saufender Junker Tobias ("Sir Toby") entschädigen bei weitem für die seltsame Auflösung des Finales. Marthaler mag man oder man mag ihn nicht - zweifellos aber ist er einer der bedeutendsten Regisseure der heutigen Zeit.
"Der Fall der Götter" auf der Perner-Insel in Hallein ist ein Beispiel dafür, dass eine im Prinzip gute Regie-Idee sich als nicht praktikabel erweist. Regie führten Johan Simons und Paul Koek In dem auf dem Drehbuch zu Luchino Viscontis Film "La caduta degli dei" basierenden Stück geht es um den blutigen Machtkampf innerhalb einer deutschen Industriellen-Familie in den Jahren 1933/34. Um zu zeigen, dass oft der Zufall entscheidet, ob jemand zum Täter oder zum Opfer wird, werden alle Familienmitglieder von insgesamt vier Schauspielern der Gruppe Zuidelijk Toneel Hollandia verkörpert. So spielt der beeindruckende Jeroen Willems gleich drei aufeinanderfolgende Generaldirektoren der Essenbeck'schen Stahlwerke, Fedja van Huêt einen SA-Offizier und einen Anti-Nazi.
Das Ergebnis: Verwirrung, die noch durch die persönlichen Diener, die den Herrschaften wie Schatten folgen (simple Verdoppelungen der Figuren gibt's ja schon auf jeder Provinzbühne), verstärkt wird. Ärgerlicher Schnickschnack ist es, wenn die Diener Regieanweisungen wiedergeben, die dann von den Schauspielern nicht befolgt werden.
Das ist schade, denn das Stück ist ein Drama von Shakespear'schen Dimensionen (Visconti und seine Mitautoren nahmen auch bewußt Anleihen bei "Macbeth"). Einige Male, wenn die störende Musik verstummt, kann das Stück auch seine packende, archetypische Kraft voll entfalten. Denn "Der Fall der Götter" ist nicht nur ein Nazi-Stück. sondern es zeigt, wie eine menschenverachtende politische Bewegung sich in die Gesellschaft einschleicht, sie verdirbt und zersetzt - eine Geschichte von hier und jetzt.
Aber einen solchen Zusammenhang kann erst das Regietheater herstellen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!





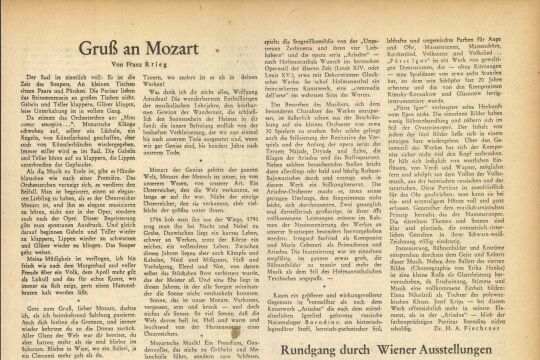







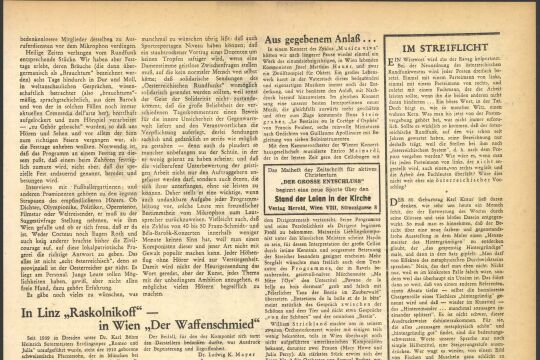



















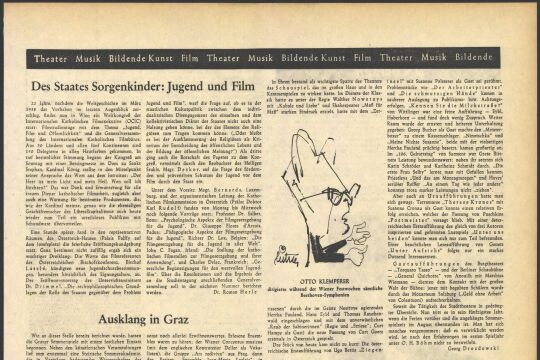






























































%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)



