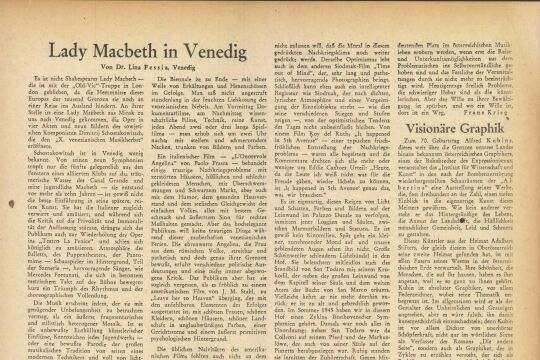Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zwei große Premieren
Ob „Carmen“ als Festspieloper in der Mozart-Stadt am rechten Platz ist, soll hier nicht erörtert werden. Eine Festspielattroktion ist sie jedenfalls. Zumindest im Repräsentationsstil der Monsterinszenierung Herbert von Karajans. Diese „Carmen“ trifft zweifellos den Geschmack eines saturierten Publikums, das einem gesellschaftlichen Ereignis beiwohnen und für sein Geld etwas haben will. Was es hier zu sehen und zu hören kriegt, ist von großer Schönheit; man fühlt sich von keinen Problemen belästigt, träumt sich mit Behagen in das Fin de siėcle zurück, das man für das goldene Zeitalter hält, und. ist fasziniert von dem Inszenierungsaufwand. Denn Karajan hat sich in der Tat viel einfallen lassen, um den gewaltigen Bühnenraum des Neuen Festspielhauses jeden Augenblick mit Aktion zu füllen. Schade, daß dabei die psychologischen Tiefblicke, die das Regiekonzept den eigentlichen Handlungselementen abgewinnt, von dem äußeren Glanz der Aufführung oft überstrahlt werden. Der Dirigent Karajan erweist sich wieder als Klangkünstler größten Formats. Unter seinen Händen leuchtet das Gewebe der Partitur in allen Nuancen, Vom ersten grellen Beckenschlag bis in die hauchzarten Linien kammermusilkailisch'er Strukturen erweisen sich die Wiener Philharmoniker als ein Instrument von wunderbarer Tonqualität. Höchstes Lob auch gebührt dem Staatsopernchor; die Chöre der Zigarettenarbeiterinnen, ob im schwebenden Pianissimo oder in dem atemraubenden Presto des Streitchors, können nicht vollendeter gesungen werden.
Die Carmen Grace Bumbrys hält jedem Vergleich stand, auch wenn sie die Partie anders anlegt als ihre großen Vorgängerinnen: zu Beginn eher zurückhaltend, fast mädchenhaft heiter und ohne jene dämonische Ausstrahlung, die sie unwiderstehlich machen sollte, steigert sie sich nach und nach zu wilder Sieghaftigkeit. In ihrem aufreizenden Spott, in ihrer Aggressivität liegt die Herausforderung an die zerstörenden Gewalten der Leidenschaft, spiegelt sich das unbewußte Verlangen nach Untergang und Tod. Dieser Tanz am Abgrund hin, dieses übermütig lustvolle Spiel mit der Gefahr ist in ihrer Darstellung von starker Spannung. Sängerin und Schauspielerin sind bei ihr eine unmittelbare Einheit. Die Stimme spielt mit, wird zum stärk- sten Mittel dramatischen Ausdrucks.
Jon Vickers ist als Don Josė nicht jener gefühlvolle Belkantotyp, der diese Rolle so oft verkörpert. Seine Stimme hat heldisches Timbre, er ist ein Mannsbild, dem man Raserei und Gewalttat zutraut. Gleichwahl gelingen ihm in der Blumenarie lyrische Töne von innigster Zartheit. Mirella Frenibringt für die Partie der Micaela einen herrlichen Sopran mit, der anfangs fast dramatische Akzente hat, dann aber durch die Empfindung beseelter Unschuld ergreift. Der Escamillo des Südamerikaners Justino Diaz, einer guten Erscheinung mit wohlklingendem Bariton, wirkt als Persönlichkeit neben Don Jose, dem er doch überlegen sein sollte, ein wenig farblos. Auch ist die Stimme in der Tiefe noch flach, ohne die profunde
Macht, die diese Partie fordert Nadine Sautereau (Frasquita) unc Jane Berbiė(Mercedes) bieten ansprechende Leistungen. Das übrige Ensemble bleibt in den Maßen eine: guten Repertoirevorstellung. Die Balletteinlagen im zweiten Akt vom Ballet de Espananach dei Choreographie Mariemmas hinreißend getanzt, wurden zu einen: vielbejubelten Höhepunkt des Abends. Teo Ottos Bühnenbildei wirken wie riesige Gemälde aus dem 19. Jahrhundert. Sie nehmer den ganzen Bühnenraum ein unc bieten im ersten Akt die bis in die Mauerflecken naturalistische Illusion eines spanischen Stadtplatzes im zweiten das Fragment einei Schenke von den Ausmaßen eine! Festspielbühne und im dritten di« balladenhafte Stimmung einei Meeresbucht, von der ein Schmugglerpfad durch zerklüfteten Fels ins Land führt. Das letzte Bild mi: dem schweren Gitter zur Rechter und der abweisend kahlen Arenawand symbolisiert gewissennaßer den Gefängnishof des Schicksals aus dem es kein Entrinnen gibt Die Kostüme von Georges Wakhe- vitch sind vielfach revuehaft aufwendig und prunkvoll. Dem Geis’ des Werkes wäre Bescheidung gemäßer gewesen.
Kann man die Festspielqualifikation der „Carmen“ für Salzburg in Zweifel ziehen, so steht Shakespeares Lustspiel „Ein Sommernachtstraum“ in dieser Hinsicht außer Diskussion. Seine poetische Tiefe und Leichtigkeit, das Wunder seiner Sprachgestalt machen es zum Festspiel katexochen. Im Stufenbau der Handlungsbereiche, dem volkstümlichen, dem höfischen und dem der bald luftig hellen, bald erdhaft dunklen Geisterwelt, ist das Werk festlich frohen Anlässen geradezu auf den Leib geschrieben. Es läßt sich auf jedem Schauplatz etablieren, im Theater, in Gärten, Schloßhöfen und sogar in der Felsenreitschule; die Möglichkeiten seiner theatralischen Verwirklichung sind ohne Zahl. Also durfte die Wiederaufnahme dieser königlichsten aller Komödien nach vierzigjähriger Pause in den Spielplan der Salzburger Festspiele freudig begrüßt werden. Und da man die Inszenierung Leopold Lindtberg anvertraut hatte, einem der besten Shakespeare-Kenner und -Interpreten des heutigen deutschen Theaters, durfte man auch viel erwarten. Aber man wartete und wartete — vergeblich. Geschlagene vier Stunden lang, und das wäre auch dann zuviel, wenn man behaglicher säße als in der kalten Felsenreitschule. Ein Sommernachtstraum, der nicht aufhört, wird zum Sommernachtsalptraum.
Das war der eine Fehler dieser Inszenierung. Einen zweiten, der wohl dem Streben nach höherer theatralischer Wahrscheinlichkeit entspringen mag, sehe ich in der Vermischung der realen mit der irrealen Sphäre. Im Grunde ist alles wahrscheinlich, was und woran man glaubt. Nur: man muß eben glauben. Die Geisterwelt Shakespeares mit ihren Elfen und Kobolden ist poetische Realität, und man sollte sie nicht als Kostümfarce, als sommerlichen Maskenulk, als Spiel im Spiel auffassen und erklären, wozu die Einführung von Doppelrollen dienen sollte. Geht nicht jeder mystische Zauber verloren,
wenn der Elfenkönig Oberon niemand anderer als der Herzog ist, der sich einen Jux machen will, wenn die Amazonenkönigin mit der Elfenkönigin Titania und Puck mit Philostrat, dem gravitätischen Maitre de plaisir am Hof des Theseus, identisch ist? Allzu leicht streift rationale Auslegung dem Gedicht seinen Schimmer von den Schmetterlingsflügeln. Natürlich gab es auch viel Schönes, überraschende Regieeinfälle, Heiterkeit und mitreißendes Leben. Geglückt im ganzen und wirklich lustig waren die Rüpelszenen. Otto Schenk als Flaut- Thisbe hatte mit drastischer Komik, der feinere Josef Meinrad mit dem unbeschreiblich einfältigen Eifer des Zettel größten Erfolg. Heinz Reinekes rauhstimmig derber Holzknecht von einem Puck war der markante Orientierungspunkt des Inszenierungskonzepts, in das sich, nebstbei gesagt, die Orffsche Musik besser eingefügt hätte, als Mendelssohns romantisch-verträumte Entrücktheit. Romuald Pekny wurde seinen Rollen (Theseus-Oberon) vor allem als machtvoller Sprecher gerecht. Gisela Stein war eine schöne und lebensvolle Hippolyta-Titania. Die Hermia Brigitte Grothumsgewann durch ihre natürliche, mädchenhafte Anmut alle Sympathien; ihre Liebe zu dem recht ungeschlachten Lysander Peter Striebecks werden viele ebenso wenig verstanden haben wie ihr empörter Vater (Robert Tessen). Sonja Sutter und Peter Arens paßten da entschieden besser zusammen. Dem Bühnenbildner Jörg Zimmermann gelang es, vor die ernsten Felsgalerien einen geheim- nisdurchwobenen Märchenwald zu zaubern. Er gab dem poetischen Kronjuwel der Komödienliteratur eine Fassung, die sogar die in dieser Aufführung blinden Facetten zum Leuchten brachte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!