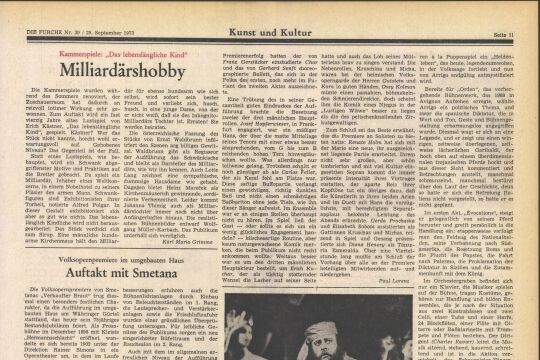Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Verschenkte Chancen
Angekündigte Sensationen finden meist nicht statt: Und offenbar schon gar nicht in der Staatsoper. Denn gerade nach dem Ergebnis dieser lang und gründlich vorbereiteten Premiere iron Verdis „Macht des Schicksals’, für die sich immerhin drei profilierte Künstler zum Team zusammenfanden — der Dirigent Riccardo M u t i, der Regisseur Luigi Squarzina und der Bühnenbildner Pier-Luigi P i z z i —, muß man sich fragen, ob es nicht einfacher und billiger gewesen wäre, Margareta Wall- nianns alte Inszenierung aufzufrischen? Das Ergebnis hätte jedenfalls überzeugender ausfallen müssen!
Angekündigte Sensationen finden meist nicht statt: Und offenbar schon gar nicht in der Staatsoper. Denn gerade nach dem Ergebnis dieser lang und gründlich vorbereiteten Premiere iron Verdis „Macht des Schicksals’, für die sich immerhin drei profilierte Künstler zum Team zusammenfanden — der Dirigent Riccardo M u t i, der Regisseur Luigi Squarzina und der Bühnenbildner Pier-Luigi P i z z i —, muß man sich fragen, ob es nicht einfacher und billiger gewesen wäre, Margareta Wall- nianns alte Inszenierung aufzufrischen? Das Ergebnis hätte jedenfalls überzeugender ausfallen müssen!
Denn die Inszenierung der Wallmann strotzte jedenfalls nicht von sovielen Ungereimtheiten der Regie, von solchen optischen und Spannungsleerläufen in den Massenszenen, von solchen Diskrepanzen zwischen den einzelnen Bildern.
Keine Frage: Verdis Werk selbst ist schon recht zwiespältig, wirkt in der ungestrichenen Dreieinhalbstundenfassung „fragmentarisch’, weil so viele bloß szenisch kaschierende Momente dazutreten, die die Handlung eigentlich nur bremsen. Das von Logik nicht sonderlich gequälte Schicksalsdrama um die Liebenden — die Marchesa Leonora und dem Mestizen Alvaro — und den getöteten Vater und die Familienehre rächenden Bruder Leonoras, Don Carlos, muß schon sehr gestrafft werden, um seine Dynamik entfalten zu können. Das haben Muti, Squarzina und Pizzi wohl gespürt.
Ihr erster Schritt, die Szenen so rasch wie möglich aufeinander folgen Zu lassen, ist denn auch richtig kalkuliert: Rasch und lautlos wechseln die neun Bilder. Klostermauem, Weinschenken, Schlachtfelder, Steinhöhlen… Gleich altersgebräunten Gemälden in einem prunkvollen Rahmen. Die fast durchwegs aus Jute gefertigten Dekorationen in Graubraun und Beige, also in der Farbe der Anmut, der Verzweifelten, des Unglücks, sind wohl eingepaßt in den schwerlastenden Prunkvorhang, einen gleichsam versteinerten Portalrahmen.
Das Tempo stimmt also. Aber leider nicht die Bilder selbst. Da paßt so manches nicht. Ungereimtheiten, Stilbrüche! Das Konzept zerbröckelt langsam. Und spätestens, wenn Squarzina Heeresmassen zu führen hat, scheitert er: ein totaler Leerlauf der Inszenierung. Ensemble um Ensemble schleppt sich trag dahin. Ein roter Faden läßt sich schließlich kaum noch finden. Phantasielos marschieren Uniformierte auf und ab, treiben Marketenderinnen und Kaschemmenpublikum ihr Unwesen nach „spanischem Klischee’. Und ein Ballett, munteres Landvolk, das aus dem „Bettelstudenten’ stammen könnte, springt sinnloserweise übers kurz vorher als Schlachtfeld adaptierte Gelände…
Daß wenigstens die Protagonisten in ihren heftigen Auseinandersetzungen mehr Darstellungsstil zeigen ist zwar erfreulich, rettet indes die Inszenierung nicht, die da allzu breit zelebriert wird; und zwar eigentlich ganz gegen das Konzept, das doch die nervöse Hektik dieses Werks vorzeigen will: die besessenen Menschen, die einander nachstellen, einander verfolgen und morden; jeder selbst Jäger und Gejagter, der die schreckliche Ausweglosigkeit erkennt, ein jeder irgendwie Opfer dieses mörderischen Schicksals, das alle zermalmt…
„Buhs’ gab es jedenfalls am Schluß dieser „Macht des Schicksals’ für Squarzina, für Pizzi, für ein paar Sänger. Daß es dennoch auch stürmischen Jubel gab, war vor allem Riccardo Muti zu danken: er macht besessene Leidenschaft und tödlichen Haß in dieser Oper fühlbar, er spornt die Philharmoniker zu brillantem Spiel an und hält die Ensembles immerhin mit intensiver Führung zu starkem Ausdruck an.
Die Besetzung selbst wirkte allzu unausgeglichen, vermochte eigentlich nur in ganz wenigen Partien zu überzeugen: Vor allem war da Cesare Siepi als Pater Guardian — der einzige Sänger, der demonstrierte, was erlesene Stimmkultur vermag, was es heißt, eine solche Partie mit all ihren Tiefen auszuloten. Kostas Paskalis als Don Carlos vermochte immerhin dem rachebesessenen Aristokraten Profil und Leidenschaft zu geben. Sesto Bruscantini pointierte die Partie des Fra Melitone mit derbem Humor und polterndem Gesang.
Aber sonst? Am überzeugendsten noch Gilda Cruz-Romo als Leonora: zwar fehlt es ihr an Wärme, samtigem Timbre; ihr Sopran wirkt in der Höhe etwas hart, im Piano zu gedeckt, aber sie vermag immerhin mit wöhlnuanciertem Ausdruck diese Partie zu gestalten. Franco Bonisolli ließ hingegen als Alvaro all den Zauber des strahlenden Tenors vermissen: wenig Schmelz, die Spitzentöne leuchten nicht metallisch, das Piano atmet wenig lyrische Wärme. Den Tiefpunkt des Abends bescherte Joy Davidson als Preziosilla: Stimmlich war sie total überfordert — ein Fall wie Eugene Holmes in der „Aida’-Premiere —, in der Personenführung war sie ein Opfer Squarzinas, der sie im konventionellsten Zigeunerklischee erledigte.
Für eine allgemein mit Spannung erwartete Gala der Staatsoper also eine eher dürftige Bilanz! Eine verschenkte Chance!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!