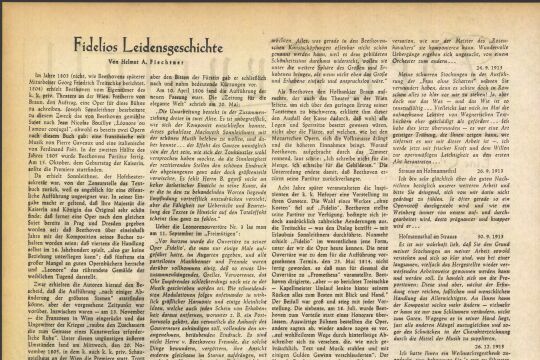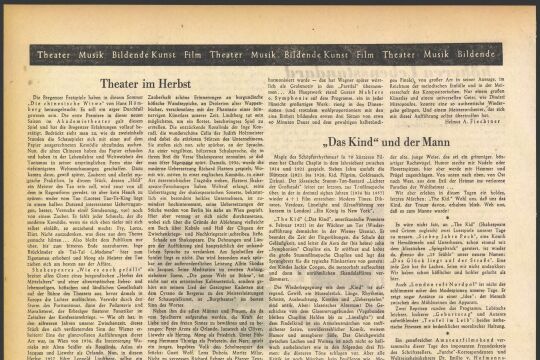Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Nicht nur namenlose Freude
Einen „Durchbruch, nach dem es kein Zurück mehr gibt“, sah Unterrichtsminister Sinowatz in der TV-Direktübertragung dieses „Fidelio“ aus der Wiener Staatsoper; einen „wichtigen Lernprozeß, in dem man die nötigen Erfahrungen für weitere weltweite Liveübertragungen sammeln könnte“, Bundestheaterchef Robert Jungbluth. Keine Frage: Die „Öffnung der Bundestheater“, dank der man in Hinkunft die wichtigsten Produktionen von Burg, Staats- und Volksoper dem Publikum ins Haus liefern wird, war höchste Notwendigkeit ■ Für die Mehrzahl der Steuerzahler, die nie im Leben diese Häuser von innen gesehen haben, werden die Bundestheater damit ihre „Anonymität“ verlieren. Und die Mal um Mal wieder totgesagte Oper wird die Chance haben, ihre Lebensfähigkeit und Attraktionskraft neu zu beweisen Nach „Fidelio“ steht bereits für Mai Karajans „Troubadour“-Ausstrahlung fest, über die Weihnachtspremiere 1978 von „Carmen“ mit Franco Zeffirelli und Carlos Kleiber und über eine Aufzeichnung von Einems „Besuch der alten Dame“ wird bereits verhandelt Es gibt also wirklich kein Zurück!
Die Produktion des „Fidelio“ selbst hat allerdings auch anderes bewiesen: Nämlich, daß die Auffrischung dieser 1970 einzigartig glanzvollen Inszenierung Otto Schenks - jetzt im Hinblick auf die Liveübertragung -, das Wunder von damals nicht wieder herbeizwingen konnte. Verglichen mit dem Ereignis von damals ist Schenk und Bernstein diesmal nur „Halbes“ geglückt
Freilich, dieses „Halbe“ ist noch immer attraktiv genug, noch immer großes Operntheater, das auch dementsprechend leidenschaftlich vom Publikum gefeiert wurde. Aber das Unvergleichliche ist nicht mehr so recht Ereignis geworden. Am Bühnenkonzept lag es wohl sicher nicht Denn Günther Schneider Siemssens Festungs- und Gefängnishof mit den monumentalen Seitentürmen und schwer lastenden Laufstegen ist unverändert erhalten geblieben. Ein Rahmen von großer Einfachheit, imponierender Wucht und beklemmender Trostlosigkeit. Ein Hauch von Konzentrationslager über dem ganzen.
Woran liegt es aber dann? Daran, daß Leonard Bernstein heute diese Musik mehr nach innen schwingen läßt? Oder daran, daß auch der im szenischen Zupacken nirgends zimperliche Regisseur Schenk zu seiner eigenen Meisterleistung zuviel Distanz gewonnen hat? Bernstein vor allem zelebriert heute diesen ersten Akt mit großer Schönheit aber in einer Breite, die oft an der Grenze des Durchhaltbaren ist. Für Sänger, die stimmlich an solchen Langstreckenläufen zu scheitern drohen, wie für das Orchester, die Philharmoniker, die die Prozedur des Uberdehnens merkbar als „nicht ihr Tempo“ empfinden.
Ein endloser Anlauf in Richtung zweiter Akt. Vom geheimnisvoll zelebrierten Quartett „Mir ist so wunderbar“, wo Bernstein Bratschen und Celli in berückender Schönheit musizieren läßt, Verhaltenheit. Zurückhaltung. Insichruhen. Überall diese Freude an Lyrik. Aber die federnde Spannkraft fehlt. Erst im zweiten Akt, erst in der Kerkerszene und in der großen Leonoren-Ouvertüre reißt er alle Kräfte zum Aufschwung zusammen. Und der Schritt vom Gelähmtsein vor Schrecken bis zum Aufschrei der namenlosen Freude wird zur Entladung aller Kraft Das ist Bernstein, wie wir ihn von früher kennen und schätzen.
Otto Schenk fügt sich Bernsteins musikalischem Rhythmus. Er läßt im ersten Akt die Zügel locker schleifen (um wieviel dynamischer da hingegen die Wirkung im TV), erst im zweiten rafft er sich zu scharfer Dynamik auf. Neben vielen menschlichen, klug erdachten Details bleiben allerdings Figuren wie Rocco oder Jaqino in der Führung blaß. Was mir an dieser Aufführung wirklich fehlte, war die ausgewogene, harmonische Besetzung. Da blieb die Aufführimg manches schuldig. Gundula Jdnowitz war indisponiert; daß Leonore ihre Partie nicht ist merkt man auch, wenn man alle Störfaktoren abzieht Eine nervöse Liebende, die zwar Temperament, Inbrunst, Leidenschaft, Ängste spürbar macht; aber von der Stimme her bleibt sie viel schuldig.
Als Florestan imponiert Rene Kollo. Er bescherte das Ereignis des Abends. Die schöne, in der Diktion klare Stimme, die ergreifende Tiefe seines Flehens, seines Hoffens, die sparsame Gemessenheit mit der Schenk ihn den Edelmann spielen läßt ergeben den edlen Menschen schlechthin Hans So-tin enttäuschte: Den Sprung vom König Marke zum grausamen Bösewicht Pizarro schafft er nicht Das geschmeidige Material bleibt auf der Strecke, läßt Schwärze, Härte, Grausamkeit vermissen Eine Fehlbesetzung. Manfred Jungwirth ist ein eindrucksvoller Rocco. Solide die Führung der Baßstimme, Urgemütlichkeit und Unbekümmertheit strahlen aus der Goldarie; düster verhalten ist er in der Kerkerszene. Lucia Popp - eine hebliche Marzelline, Adolf Dallapozza - so farblos, wie dieser Jaqino fast immer ist Hans Helm, ein kultivierter Minister.
Bei der Premiere wirkte das alles noch etwas unausgeglichen, zuwenig festlich. Für die Fernseh-Direktüber-tragung schienen aber alle wie ausgewechselt Die Konkurrenz mit dem spektakulären „Don Carlos“ aus der Mailänder Scala bestand dieser „Fidelio“ mühelos.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!