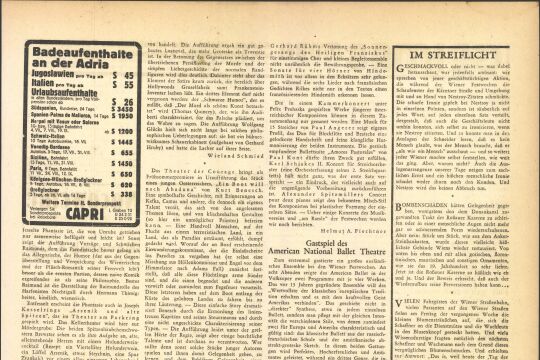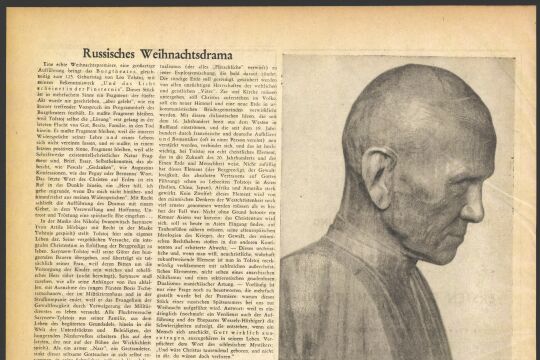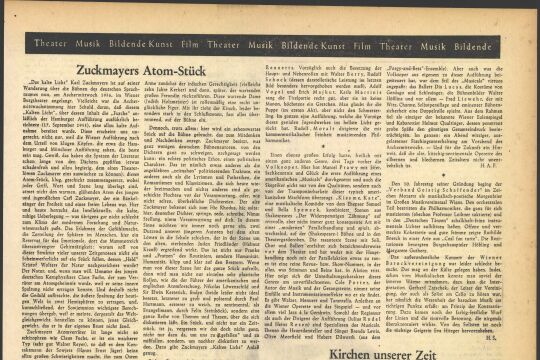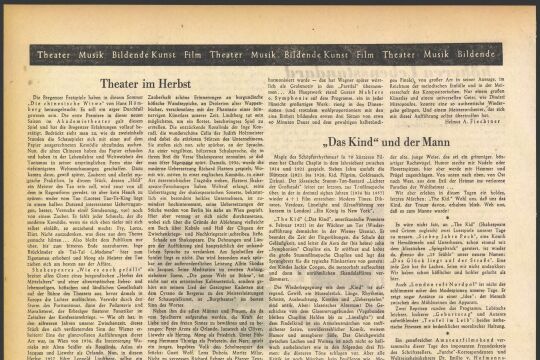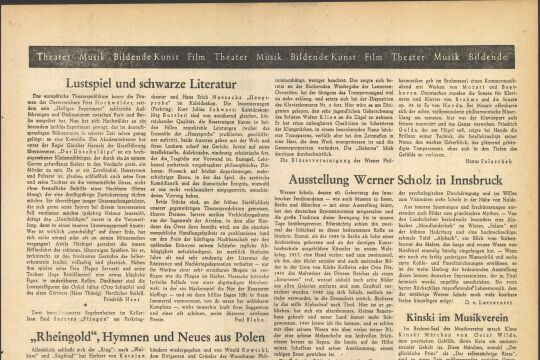Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Uraufführung und Gastspiel in der Staatsoper
Da bedeutendste künstlerische Ereignis der Wiener Festwochen 1956 war die Uraufführung von Frank Martins Oper „Der Sturm“ nach Shakespeare. Vor mehr als fünf Jahren schrieb Martin bereits „5 Chansons d'Ariel“ für Frauenchor. Aber Shake-spearej Zauberlustspiel in der Schlegelschen Ueber-tragung beschäftigte den Komponisten — der zwar schon ein halbes Dutzend Bühnenmusiken, aber noch nie eine Oper geschrieben hatte — schon viel früher. Von der Unantastbarkeit dieses Textes, von der Logik der Szenenfolge und der psychologischen Folgerichtigkeit des Handlungsverlaufes überzeugt, hat Martin sich — auch wenn er damit auf manchen Effekt verzichten mußte — keinerleit Aenderungen, sondern lediglich einige unwesentliche Kürzungen erlaubt. Wir empfangen daher mit dem „Stur m“ aus der Hähd des Schweizer Komponisten die — unseres Wissens — erste vollständige Shakespeare-Oper. Zur Realisierung dieses gewagten und- schwierigen Unterfangens setzt Martin die Erfahrung und die Kunstmittel einer reifen schöpferischen Persönlichkeit ein. Immer wieder erkennen wir beim Anhören dieser anspruchsvollen, differenzierten, farbigen und wohlklingenden Musik gewisse Martinsche „Grundfiguren“: das aus dem „Vin herbe“ bekannte lyrische Rezitativ mit den häufigen Halbtonschritten, seine — meist kurzen — schwebenden oder fließenden Osti-nati, die zwölftönigen Melodiebildungen, gewisse harmonische Wendungen und rhythmische Passagen. Nur ist Martins Palette, mit früheren Werken verglichen, noch reichhaltiger und farbiger geworden, ohne daß die unverwechselbare Eigenart seines Stiles je verwischt wird oder, zugunsten der Wirkung, künstlerische Konzessionen gemacht werden. Von dem an Debussys „Nuäges“ erinnernden Vorspiel bis zu den karikierenden Jazzsynkopen mit gestopften Blechbläsern, welche die um den König von Neapel versammelte Hofgesellschaft charakterisieren 'Anfang d~s 2. Aufzugs), ist alles von einer vollkommenen stilistischen Einheitlichkeit. In den Sol' sowie im Terzett von Caliban, dem Ungeheuer, Trinkulo, dem Spaßmacher, und Stephano, dem betrunkenen Kellner, erweist sich Martin — und dies ist eine neue Seite seines reichen Talents — auch als Humorist, Satiriker und Karikaturist von hohen Graden. So gibt es in dieser Partitur, neben weitgeschwungenen lyrischen Partien, meisterhaft gesteigerten Monologen (Prosperos Erzählung), dramatischen Duetten (Ferdinand und Mirande) auch moderne Tanzrhythmen und knallige Jahrmarktsmusik ä la Strawinsky. Ueber allem aber wacht ein unfehlbarer künstlerischer Geschmack, der buchstäblich keinen Takt lang „ausläßt“. — Martin hat mit der Ausführung dieser Partitur deshalb so lange gezögert, weil er daran zweifelte, eine Bühne zu finden, die für ein solches Wagnis zu haben und solchen Ansprüchen gewachsen wäre. Denn sein Werk erfordert tatsächlich „singende Schauspieler“, es erfordert — für die Rolle des Ariel, dessen Worte, hinter der Bühne, von einem kleinen, kammermusikalisch begleiteten Chor gesungen werden — einen erstklassigen Tänzer, es fordert einen Bühnenkünstler, der zaubern kann, und man braucht, zu ihrer vollkommenen Realisierung, ein Meisterorchester. Die Wiener Staatsoper hat mit den Sängern Christa Ludwig, “Eberhard Wächter, Anton Dermota, Frederik Guthrie, Karl Kamann, Murray Dickie, Karl Dönch und einigen andern ihre besten Kräfte aufgeboten. Willy Dirtl als Ariel hatte eine stumme Hauptrolle. Dirigent, Regisseur und BüWhenbildner waren illustre Gäste: Ernest Ansermet, dem Werk Martins seit vielen Jahren verbunden, Heinz Arnold, der die Intentionen des Komponisten mit echter Einfühlung verwirklichte, und Georges Wakhevitsch aus Paris, der eine Reihe märchenhaftphantastischer Bühnenbilder sowie die nobel-prunkvollen Kostüme schuf. Das luxuriös ausgestattete Ballett des 3. Aktes leitete Erika Hanka. Im Kreis aller Ausführenden konnte sich der Komponist für den lang anhaltenden Beifall des festlichen Auditoriums immer wieder bedanken.
Mit Chor, Orchester und Solisten gastierte die Mailänder „Seal a“ — als erstes vollständiges Ensemble nach 1945 — an der Wiener Staatsoper. Donizetiis tragische Oper „L u c i a d i L a m-mermoor“, die zuletzt vor 30 Jahren unter Toscanini in Wien gespielt wurde, ist eine Schauerballade von Liebe und Trug, Wahnsinn, Mord und Selbstmord. Aber der Text ist nicht von oder nach Shakespeare (sondern von Salvatore Cammaro nach Walter Scott), und die Musik nicht von Verdi, sondern von dem unermüdlichen Routinier Gaetano Donizetti, der es auf insgesamt 71 Opern brachte.
Man nennt solche Bühnenwerke „Sängeropern“, und von den Sängern muß auch anläßlich des Scala-Gastspieles zuerst gesprochen . werden. Der Stern und der Star des Abends- war Maria M e n e-ghini-Callas, die etwa 30jährige, in Amerika geborene Griechin. Sie ist nicht nur eine phänomenale, heute bereits weltberühmte Sängerin, sondern — mit ihrem schlanken, übergroßen Wuchs und den edlen Gesten — auch eine glänzende und interessante Schauspielerin. Ein. „Phänomen“ ist diese Stimm tatsächlich: durch ihre Kraft und ihren Umfang, durch ihr Timbre und durch die zahlreichen Regif ster, über die sie verfügt. Für unsere Ohren un1 gewohnt sind ihre zuweilen allzu spitzen Spitzentöne und die recht schrille und unbekümmer forcierte oberste Lage. — Neben ihr haben sich die drei prächtigen Stimmen von Rolando P a n e r a i, Giuseppe Di Stefano und Giuseppe Zampieri glänzend behauptet, zumal ihr Organ für unser Gefühl „schöner“ ist als das der Callas. Auch wirken diese drei Darsteller durch imposante Erscheinung und sicheres Auftreten. Von „Spiel“ kann kaum gesprochen werden.
Denn: Herbert von Karajan hatte diese Aufführung nicht nur arrangiert und dirigiert, sondern auch inszeniert. Für das Arrangement sind wir ihm besonders dankbar (denn wer kann es sich schon leisten, nach Mailand zu fahren, um dort die Scala zu besuchen!); als Dirigenten haben wir ihn bewundert, obwohl er aus der „Lucia“ eine Donizetti-Symphonie mit obligaten Singstimmen machte (hierzu diente ein mit' ständigem dramatischem Hochespres-sivo spielendes 100-Mann-Orchester, das jeden anderen Sänger glatt zugedeckt hätte); als Regisseur, der vermutlich auch auf die Ausstattung Einfluß hatte, zeigte sich Karajan ungeübt und konventionell. Zur italienischen Belcantooper gehören Leben und Bewegung auf der Bühne (und die Italiener agieren doch so gern und so gewandt!), und nicht der statuarische Händel-Stil. Wenn Karajan als Regisseur einmal etwas probierte, so wirkte es fast naiv, so zum Beispiel im
1. Bild des 3. Akts, wo, nach einer Trauerbotschaft, der gesamte Chor, wie auf Kommando, sich in schwarze .Mäntel hüllt und sich solcherart aus einer Fest- in eine Trauerversammlung verwandelt. Trotz dieser Mängel war die Aufführung höchst eindrucksvoll — und lehrreich in mancherlei Beziehung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!