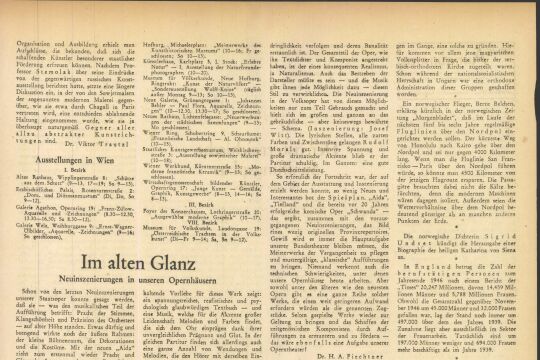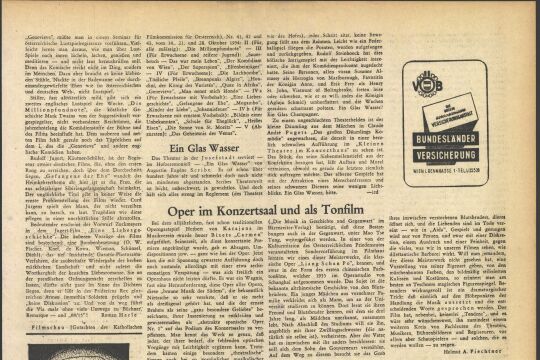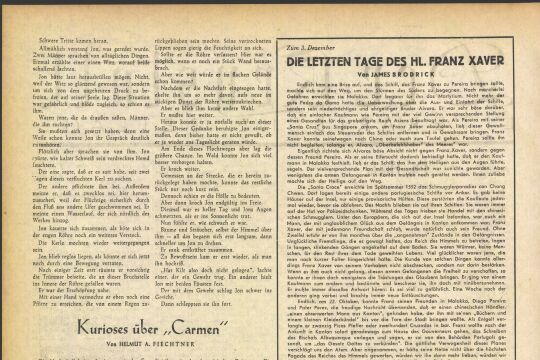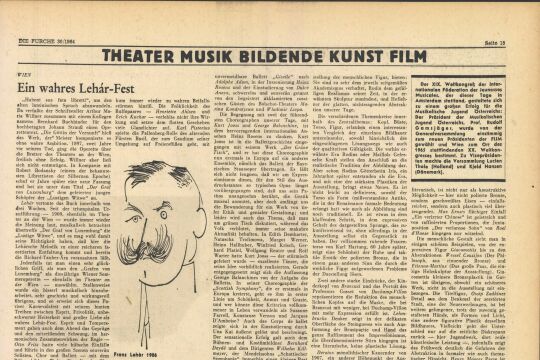Ierkundigt man sich, in Paris angekommen, -< was man in der Oper sehen, im Konzert hören müsse, so lautet der Rat von Kritikerkollegen und Opernhabitues übereinstimmend: „Gehen Sie unbedingt in .Carmen'. Eine solche Aufführung haben wir hier lange nicht gehabt, wahrscheinlich hat es sie an der Pariser Oper in dieser Art überhaupt nie gegeben.“ Wir gingen also in die neue Pariser „Carmen“ und sahen:
Ein verschwenderisch ausgestattetes „spectacle lyrique“ — so nennen die Franzosen ihre Opernaufführungen, in dem das Spektakuläre zuweilen stärker in den Vordergrund tritt als das lyrische oder das dramatische Element. Der Gesamtstil der Inszenierung kann als realistisch, ja naturalistisch bezeichnet werden, wobei freilich— man möchte meinen: wie durch Zufall — Bildwirkungen entstehen, wie man sie bei Delacroix oder bei Goya findet. Ähnlich wie Preminger in seinem berühmten Tonfarbfilm „Carmen Jones“— und sehr im Gegensatz zur Wiener Prunkaufführung - zeigt man in der Pariser Oper eine „Carmen in Lumpen“. Was nicht etwa heißen soll, daß ein spanisches Elendsmilieu auf der Bühne nachgebildet wird. Man hat nur versucht, etwa jene Atmosphäre wiederzugeben, jenen Rahmen zu rekonstruieren, in welchem sich die von Prosper Merimee in seiner berühmten Novelle gestaltete Handlung abgespielt haben könnte.
Da ist zunächst ein mit wimmelndem Leben erfüllter Platz in Sevilla, mit einer zugleich schlampigen wie operettenhaften Soldateska und mit äußerst realistisch raufenden Fabrikarbeiterinnen. Carmen wird kurzerhand mit einem Strick an einen Tischfuß angebunden. Und es beginnt auch schon der Auftritt von Pferden und anderem Getier, das in dieser Inszenierung eine von der Pariser Presse vieldiskutierte Rolle spielt. Zwölf stattliche Pferde, zwei Esel, ein Hund und ein Affe wirken bei der Aufführung sehr erfolgreich mit und werden immer wieder mit Applaus begrüßt. Hier steht zweifellos der Spektakel im Vordergrund (es gibt gleich zu Beginn auch einen mit Pferden bespannten Wagen, der über die Bühne rollt). Das zweite Bild, die Schenke von Lillas Pastia, ist gleichfalls sehr milieuecht und empfängt ihren besonderen Reiz durch zwei Tanzgruppen: eine im Hintergrund links und eine im Vordergrund rechts. Trotzdem bleibt genügend Raum für die leidenschaftlichen Aktionen dazwischen, dank der ungewöhnlichen Breite von 30 Meter, welche die Bühne der Pariser Oper besitzt. — Der Schmugglerakt zeigt eine wahrhaft abenteuerliche und gefährliche Berglandschaft mit steil aufragenden Felsen vor einem tiefblauen Fluß (oder Bergsee). Micaela und der Toreador kommen hoch zu Roß — und das entbehrt nicht der Berechtigung (während man sich sonst fragt, wie um alle Welt die beiden sich zu Fuß in diese abgelegene Gegend verirren). — Beim großen Defilee des 4. Aktes schließlich, vor den Toren der Arena, ist der Aufwand von Menschenmassen, Wagen und Pferden vollends gerechtfertigt. Hier spielt der Regisseur auch einen letzten Trumpf aus: in den vorausgegangenen Bildern sah man wie zu Stein erstarrte graue Bettlergestalten liegen, sitzen und stehen, Symbole der Armut, die überall gegenwärtig ist. — Nun, nachdem Don Jose seine geliebte Carmen getötet hat (indem er sie in sein kurzes Messer rennen läßt), erheben sich diese grauen Elendsgestalten plötzlich lautlos und starren auf das unglückliche Paar: ein unheimlicher Effekt, der dem Grand-Guignol entstammen könnte... *
Regisseur dieser vielbeachteten und diskutierten Aufführung ist Raymond Rouleau, der vom Theater herkommt — und auch das ist etwas Neues für Paris; desgleichen die hochtalentierte Bühnenbildnerin Lila de Nobili, die zwar schon für die Oper gearbeitet hat, aber gleichfalls überwiegend an Sprechbühnen beschäftigt ist. — Die französische Kritik rühmt dieser Neuinszenierung nach, daß sowohl die Solisten wie der Chor selbständig, auch mit dem Rücken zum Publikum, agieren, ohne ständig auf den Dirigenten zu schauen. Bei uns eine Selbstverständlichkeit in einer gut vorbereiteten Aufführung, für die Pariser Oper ein Novum. Denn Regie und Ensemblespiel in unserem Sinn kennt man dort kaum (daher auch der sensationelle Erfolg der in Paris gastierenden Stuttgarter Oper; daher auch das zusammenfassende Urteil über die neue „Carmen“ in der Zeitung „Forces Nouvelles“: „Endlich besitzen wir in Frankreich eine Inszenierung, die mit ausländischen Aufführungen rivalisieren kann, würdig auch, mit den Leistungen Felsensteins verglichen zu werden“). Man verspricht sich sogar, neue Publikumsschichten mit dieser Aufführung ins Theater zu ziehen und betont, daß für solche Leistungen nicht nur Talente, sondern auch reichliche Mittel (die für die Pariser Oper nur selten zur Verfügung gestellt werden) notwendig sind.
Den Gast berührt es eigentümlich, daß in Paris, wo „Carmen“ vor 85 Jahren — wie man weiß: ohne besonderen Erfolg — uraufgeführt wurde, nicht die Originalfassung Bizets mit gesprochenen Dialogen (Opera comique!) benützt wird, sondern die spätere mit den Rezitativen des Bizet-Freundes Aitt Giiraud. Fürchtet man für das Französisch der Gäste? Denn die Besetzungsliste nennt einige fremde Namen: Jane Rhodes heißt die schöne Titelheldin, die, mit etwas hellem Organ, eine leidenschaftliche, aber immer ästhetische und wohldurchdachte Carmen darstellt. Die Frauenrollen sind durchweg gut, die der Micaela mit Andrea Guiot vorzüglich besetzt, was man von den männlichen Partien nicht behaupten kann, von denen nur der Escamillo Gabriel Bacquiers den Durchschnitt überragt. Einen etwas matten, aber trotzdem mit freundlichem Beifall bedachten Don Jose gab Marcel Huylbrock; in den männlichen Nebenrollen: Rialland, Mars, Romagnoni und Germain. — Louis Fourestier dirigierte exakt, im übrigen ohne besondere Kennzeichen. Für die Ballettszenen hatte man sich die von Lele de Triana geleitete spanische Truppe „Sol y Sombra“ engagiert. Dafür trägt der Programmzettel den Vermerk: „Während der Aufführung rauchen die Künstler Zigarren und Zigaretten der Französischen Tabakregie.“
Die Pariser sind also stolz auf ihre neue „Carmen“. Sie leitet eine neue Ära der Staatstheater unter der Direktion von A. M. Julien ein, dem E. Bondeville als Generaldirektor des Opernhauses zur Seite steht. Die „Carmen“-Premiere fand in Anwesenheit von General de Gaulle statt, und anläßlich seines Frankreich-Besuches wird man sie auch Herrn Chruschtschow vorführen. Und zwar womöglich am letzten Abend seines Pariser Aufenthaltes und ganz entgegen der Gepflogenheit, hohen Gästen als Galavorstellung einen „Spectacle de Ballet“ zu bieten...
Glückliches Ballett — in Paris! Es ist hochgeschätzt und hat wöchentlich seinen „jour fix“, gegenwärtig ist es der Freitag, dazu oft noch einen außertourlichen Abend. Im Großen Opernhaus, nach seinem Erbauer auch „Palais Garnier“ genannt, gibt man ein großes, fast zweistündiges Ballett „La Dame aux Camelias“ nach der Novelle von Alexander Dumas (Verdi schrieb seine Oper „Traviata“ nach dem Stück von Dumas fils, das er während eines Paris-Aufenthaltes im Jahre 18 51/52 gesehen hatte). Ein Wagnis, ohne Zweifel, nach dem bekannten Theaterstück und der noch berühmteren Oper den Liebesroman der Halbweltdame Maguerite und ihres Armand in ein großes Tanzdrama zu verwandeln. Tatiana-Gsovsky schuf die Choreographie, Henri Sauguet schrieb eine interessante, moderne und bühnengerechte Musik dazu, und erstklassige Tänzer standen für sämtliche Rollen zur Verfügung, an der Spitze Yvette Chauvire und George Skibine. Die Choreographin hat, ähnlich wie Erika Hanka im „Mohr von Venedig“, eine Rahmenhandlung erfunden: Im Sterbehaus der Marguerite werden ihre Möbel, ihr Schmuck und andere Erinnerungsstücke versteigert. In der „fühllosen Menge“ befindet sich auch Armand, der plötzlich in den Händen des Ausrufers das rote Kleid entdeckt, in dem er die Geliebte zum erstenmal gesehen hat. Er reißt es an sich, und die Erinnerung glücklicher und schicksalsvoü-trauriger Tage , steigt mit Macht herauf: der Ball, auf dem er sie kennenlernte, die Tage des Glücks und der Liebe in Bougival, das Zerwürfnis, das Wiedersehen im Spielsalon, mit einem anderen, die Beleidigung der Geliebten, und schließlich ihr Tod. — Dieser „Trick“ gibt der Choreographin die Möglichkeit, die ganze Handlung in die Sphäre des Irrealen, Traumhaften zu tauchen und, besonders im letzten Bild, Wahn und Wirklichkeit, auf zwei Ebenen gegenübergestellt, gewissermaßen zu kontrapunktieren.
Die dritte Ebene bildet der Zuschauerraum, das breite Amphitheater der Großen Pariser Oper, als dessen Fortsetzung die Bühne erscheint. Wenn sich der Vorhang hebt, schaut man in einen riesigen Kuppelsaal in Braun, Gold und Dunkelrot, ausgestattet mit dem gleichen ein wenig verstaubten Prunk wie das Palais Garnier. Das letzte Bild ist dämmerig, schleierig, mit bläulichen Schatten in den Spiegeln, die das Doppelspiel reflektieren. Hier ist dem Bühnenbildner Jacques Dupont etwas wirklich Poetisches gelungen, angemessen der zarten Grazie und dem fragilen Charme von Yvette Chauvire und1 ihren Kolleginnen in den kleineren Rollen, angemessen auch der atmosphärisch dichten Musik von Henri Sauguet.
Nach diesem Tanzdrama, das bei uns „abendfüllend“ wäre, folgt in der Grand Opera noch ein zweites Ballett, kürzer und handfester, aus einer völlig anderen Sphäre und mit dem exotischen Titel „Quarrtsiluni“. Die Choreographie stammt von Harald Lander, die Musik von Knudage Riisager, die originellen Kostüme und das kühne Bühnenbild von Bernard Dayde, einem der meistbeschäftigten Ausstattungskünstler von Paris. Es handelt sich um ein Eskimosujet, und zwar um einen rituellen Tanz, der das Himmelslicht beschwört (die irreale Beleuchtung ließ nicht erkennen, ob es sich um die Sonne oder um den Vollmond handelte). „Wir nennen Quarrtsiluni“, kommentiert das Programm nach der Erzählung einer alten Eskimofrau, „jene Stille, in der man auf etwas wartet, das bald ausbrechen wird.“ Die Musik beginnt mit einem minutenlangen Trommelsolo, das von Michel Descombey mit großer Intensität und Wildheit getanzt wird. Allmählich treten andere Instrumente hinzu (ä la Bolero von Ravel), der Tanz ergreift eine Gruppe nach der anderen, die sich aus ihrer Erstarrung löst, bis zum Schluß das ganze Orchester in Fortissimo-Fanfaren explodiert (etwa im Stil des letzten Satzes der „Pini di Roma“ von Respighi) und das gesamte Ballett in einem stampfenden Rhythmus den Bühnenboden erzittern macht: sehr wirkungsvoll, nur ein wenig zu elegant choreographiert, ein „Sacre de printemps“ in Taschenformat.
Zum Schluß noch ein Blick auf das Pariser Konzertprogramm. In der Woche vom 2. bis 8. März fanden in Paris insgesamt 23 musikalische Veranstaltungen statt, davon zehn Orchesterkonzerte (unter diesen zwei mit Chor), sechs Klavierabende, zwei Orgelkonzerte und mehrere Kammermusikabende in verschiedener Besetzung. Folgende berühmte Solisten gastierten während dieser Woche in Paris: Alexander Brailowsky, Arthur Grumiaux, Maurice Gendron, Geza Anda, Emil Gilleis und David Oistrach. Kurz vorher war Irmgard Seefried, begleitet von Dr. Erik Werba, in Paris, und in den Zeitungen lasen wir sehr anerkennende Besprechungen ihres Liederabends mit Schumanns Zyklus nach Gedichten der Maria Stuart, Liedern von Hugo Wolf und Gustav Mahler. — Ausführlich wurde auch eine Aufführung der 1. Symphonie von Gustav Mahler durch Igor Markewitsch in einem Lamoureux-Konzert gewürdigt. Bei dieser Gelegenheit erinnern fast alle französischen Tagesund Wochenzeitungen an den bevorstehenden 100. Geburtstag Mahlers, lenken die Aufmerksamkeit des Publikums auf sein in Frankreich wenig bekanntes Werk und berichten von der Gründung eines französischen Gustav-Mahler-Komitees, unter dessen Patronanz mehrere Mahler-Aufführungen, u. a. auch im französischen Rundfunk, stattfinden werden.