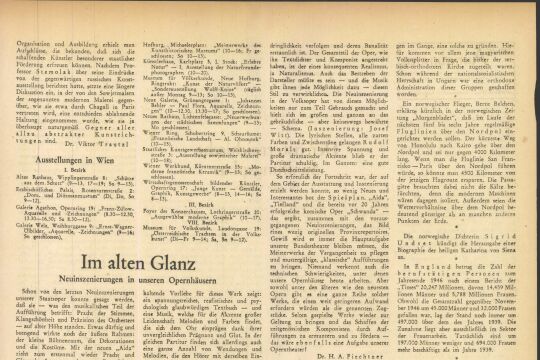IN UNSEREM ERSTEN BERICHT über das Wiener Opernfest, in dem der Staatsakt und die beiden ersten Aufführungen im neuen Haus geschildert wurden, schrieben wir an dieser Stelle („Furche“ vom 12. November 1955): „Wer während der letzten Wochen und Monate die Vorbereitungen, Ankündigungen und programmatischen Erklärungen im Hinblick auf die Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper aufmerksam verfolgte, den konnten wohl zuweilen Zweifel und Sorgen überkommen, ob das während der festlichen Wochen Dargebotene auch wirklich dem entsprechen werde, was sich Wien, was sich ganz Oesterreich und die Welt von diesem Ereignis in künstlerischer Beziehung erwartet.“
Die Erwartungen waren hochgespannt, nicht nur infolge des festlich-feierlichen Rahmens, in dem sich die Einweihung des großen Hauses am Ring vollzog, sondern auch auf Grund vielversprechender Erklärungen, die der neue Direktor des Hauses, Dr. Karl Böhm, bereits mehrere Monate vor der Wiedereröffnung abgegeben hatte und die, ganz oder auszugsweise, in mehreren Zeitungen und Zeitschriften abgedruckt wurden. Man kann die ausführlichste in der Festschrift „Wiener Staatsoper 1955“ (Seite 55 bis 57) nachlesen. Wir zitieren:
„Die Fortschrittlichkeit der Wiener Staatsoper muß darin bestehen, daß der Spielplan alle bedeutenden künstlerischen Aeußerungen der Vergangenheit und Gegenwart aufzeigt, daß im Laufe der Jahre, unter Wahrung möglichst großer Mannigfaltigkeit, wieder so etwas wie ein Wiener Opernstil entsteht. Ein Stil also, der auf den Grundlagen der Vergangenheit und auf den schöpferischen Kräften der Gegenwart ruht.
Große Opernkunst, wie wir sie in Wien gewohnt sind, und wie sie meiner Auffassung vom idealen Operntheater entspricht, läßt sich nur in einem ständigen Ensemble, mit Künstlern, die in Geist und Charakter aufeinander abgestimmt sind, erreichen. Nur ein Theater, dem das künstlerische Personal durchweg längere Zeit zur Verfügung steht, kann die erforderliche kulturelle Aufbauarbeit leisten. Ferner: Das Ensemble muß für den Spielplan vorhanden sein und nicht umgekehrt, der Spielplan für das Ensemble...
Darum werde ich bemüht sein, die sogenannten Repertoirevorstellungen zu Qv.alitätsvorstel-lungen zu machen.. Dies kann nur durch ständige künstlerische Erziehung des Ensembles geschehen. Ich sehe es überhaupt als meine Hauptaufgabe an, die Mitglieder zu einem wirklichen Ensemble zusammenzuschweißen, sie zu lenken und zu künstlerischen Hochleistungen hinzuführen ...
Vom größter Bedeutung scheint mir auch die Erkenntnis, daß die Kunstform der Oper nicht nur eine musikalische, sondern ebenso eine dramatische ist. Nur dann, wenn es gelingt, die musikalischen Belange des Operntheaters mit den szenischen auf einen Nenner zu bringen, sind die Voraussetzungen für die Schaffung eines ausgeprägten Opernstils gegeben. Bei allen Maßnahmen, die ich zur Festigung des Wiener Opemstils getroffen habe, ging es mir immer darum, die musikalische und die szenische Aufführungsform auf eine Linie zu bringen. Das spezifisch wienerische Musizieren und Theaterspielen schafft erst den Wiener Opernstil.“
Ein umfassendes und ein ausgezeichnetes Konzept, das, als es verkündet wurde, die Zustimmung der gesamten Wiener Presse und wohl auch der am künftigen Schicksal der Wiener Oper interessierten Oeffentlichkeit gefunden hat. Befassen wir uns zunächst mit der Person dessen, der in erster Linie berufen wäre, es zu realisieren.
DR. BÖHM STEHT, LAUT VERTRAG, der Wiener Staatsoper sieben Monate im Jahr zur Verfügung. In dieser Zeit hat er 60 Dirigierverpflichtungen, wobei jede Neuinszenierung für drei Abende zählt. Während des Opernfestes stand Dr. Böhm zehnmal am Pult, seither, also vom 5. Dezember bis Mitte Februar, sechsmal (und zwar fünfmal im Dezember und einmal im Jänner), das sind insgesamt sechzehn Abende unter der Leitung des neuen Chefs. Dann trat Dr. Böhm seinen ihm vertragsmäßig zustehenden Urlaub an, war während dieser Zeit in Berlin beschäftigt und befindet sich gegenwärtig auf einer Tournee in Amerika. Von dieser wird er am 28. Februar zurückkehren, wird aber bereits vom 9. März bis zum Ende des Monats eine Gastspielverpflichtung in Neapel absolvieren. In den Monaten April und Mai soll Dr. Böhm in Wien sein und wird seine Tätigkeit hier, vorläufig, nur für vier Tage unterbrechen, um das Staatsopernensemble zu den Maifestspielen nach Wiesbaden zu führen.
Durch die häufige Abwesenheit in dieser kritischen Zeit entstand im Ensemble ein Gefühl der Unsicherheit und in der Oeffentlichkeit jenes Unbehagen, das keinem aufmerksamen Beobachter entgehen konnte. Nicht nur hätte man sich gewünscht, daß der Herr des Hauses öfter am Pult erschienen wäre, sondern, was noch wichtiger ist, daß er sich gerade in dieser Zeit um den gesamten künstlerischen Betrieb mehr hätte kümmern sollen. Und zwar nicht nur um den musikalischen Teil, sondern auch um Regie und Ausstattung. *
ABER - „HIER STOCK' ICH SCHON“, denn wir stehen vor der Frage, ob der neue Operndirektor damit nicht überfordert ist, d. h. ob Dr. Böhm hierfür das nötige Interesse, vor allem aber die erforderlichen Fähigkeiten besitzt. Es hat nämlich nur wenige Dirigenten gegeben, die in ihrer Eigenschaft als Operndirektoren auch die gesamte Inszenierung mitzubestimmen und zu überwachen in der Lage waren. (Die seltenen Ausnahmen sind bekannt.) Man wird also hier nach neuen, den Direktor und musikalischen Leiter entlastenden Lösungen suchen müssen, um den „neuen Wiener O p e r n s t i 1“ realisieren zu können. Daß man mit den gegenwärtig in der Staatsoper beschäftigten S p i e 11 e i t e r n auf die Dauer nicht das Auslangen finden wird, haben einige Neueinstudierungen während der letzten Wochen erwiesen. Aber man ist bereits dabei, unter den besten Regisseuren (wir nennen nur: Schuh, Rennert, Gielen, Wieland Wagner, Graf, Rott, Lindtberg, Felsenstein und Strehler) Umschau zu halten und jene zu engerer Mitarbeit heranzuziehen, die gewillt und in der Lage sind, an der Lösung dieser Aufgabe mitzuarbeiten. Um sich einzelnen Künstlern zu widmen und die einmal fixierte Regie in Ordnung zu halten, bedarf es eines womöglich jungen und tatkräftigen Regieassistenten (und wir wüßten im Augenblick keinen geeigneteren als den Wiener Walter Davy).
NICHT WENIGER WICHTIG ist die Frage des B ü h n e n b i 1 d e s, das in seiner gegenwärtigen unzulänglichen Form einen der Hauptgründe für das Unbehagen an den Leistungen der Staatsoper bildet. Auch hier scheinen die derzeit vorhandenen Kräfte nicht zu genügen, obwohl Robert Kautsky und Stefan Hlawa ab und zu Gutes, ja Apartes geschaffen haben. Auf diesem Gebiet gibt es ebenfalls internationale Kapazitäten, von denen zumindestens einzelne als Mitarbeiter zu gewinnen wären (wir nennen: Wakhewitsch, Kokoschka. Clave, Neher, Jürgens aus München, Theo Otto und Jean Pierre Ponelle).
WICHTIG IST FERNER, daß nicht nur Regisseur, Dirigent und Bühnenbildner sich auf einen einheitlichen Stil für ein bestimmtes Werk einigen, sondern daß durch Koordination der verschiedenen Spielleiter und ihrer Inszenierungen allmählich der Wiener Opernstil erarbeitet wird. Daher würde es zum Beispiel — so interessant das Experiment sein mag — keinen Fortschritt auf der angedeuteten Linie bedeuten, wenn man etwa Wieland Wagner für eine Wagner-Inszenierung im Bayreuther Stil gewänne; es käme vielmehr darauf an, ihn mit einer bestimmten Aufgabe für die W i e n e r Oper zu betrauen.
NICHT NUR ATTRAKTION fürs Publikum, sondern auch Gewinn für das Ensemble und das Orchester bedeuten — wie jetzt eben das Gastspiel von Andre Cluytens beweist — das Engagement hervorragender Gastdirigenten. Clemens Krauß und Erich Kleiber wären hier in erster Linie in Betracht gekommen. Aber beide sind nicht mehr. Nennen wir auch hier einige Namen: als ersten noch einmal Cluytens, den wir bald am Pult der Staatsoper wiederzusehen hoffen, Solti, Karajan und Rossi, oder ein anderer italienischer Dirigent für italienische Opern. Neben diesen werden nicht nur die beiden sehr fähigen und schätzenswerten „Hausdirigenten“ Heinrich Hollreiser und Rudolf Moralt, sondern auch der Staatsoperndirektor noch genug dankbare Aufgaben finden.
SEHEN WIR NUN EINMAL VON DER PERSON des Staatsoperndirektors ab und prüfen wir, ob, was bisher von dem Ensemble, dem stellvertretenden Direktor und seiner vorgesetzten Behörde, der Bundestheaterverwaltung, geleistet wurde, wirklich Anlaß zu Kritik geboten hat.
Die Aufgabe war, so bald wie möglich ein Repertoire aufzubauen. Das geschah, indem man in rascher Folge ein Werk nach dem anderen aus dem Theater an der Wien ins neue Haus übernahm. Im Zeitraum von zwei Monaten wurden Insgesamt sieben Opern auf diese Weise „neueinstudiert“. Wer einen Opernbetrieb kennt, weiß, was das bedeutet. Eine szenische Erneuerung (Bühnenbild und Kostüme) war nicht möglich, weil die Kosten hierfür zu hoch gewesen wären und weil es die Werkstätten einfach nicht „geschafft“ hätten. Die alten Dekorationen im neuen, prächtigen Haus bildeten einen der Hauptgründe für das „Unbehagen“ an den Aufführungen. Von den Opern Zauberflöte, Tosca, Boheme, Hoffmanns Erzählungen, Troubadour, Maskenball, Tristan, Entführung und Salome haben nur die beiden letzteren die Uebersiedlung von der Rechten Wienzeile an den Opernring klaglos überstanden. Was Besetzung und musikalische Leitung betrifft, war sachliche Kritik eigentlich nur an den beiden Verdi-Opern berechtigt. Die übrigen Aufführungen können als gut, zum Teil als glänzend bezeichnet werden. Die Wiener Kritiker, insbesondere die einiger Mittagblätter, haben diese Neueinstudierungen scharf unter die Lupe genommen. Auch wir haben im Rahmen unserer
Kunstberichte mit Einwänden und Kritik an einzelnen Leistungen nicht hinter dem Berge gehalten. Nun gilt es aber, einen zusammenfassenden Rückblick zu tun, das Wünschbare und das Mögliche gegeneinander abzuwägen und durch Vergleiche mit anderen Opernhäusern das richtige Maß zu finden.
ALS SEINERZEIT DIE OPER vom Kärntnertortheater ins neue Haus am Ring übersiedelte, wurde in jenem noch zwei Jahre lang weitergespielt, in diesem aber während des ersten halben Jahres wöchentlich nur je zwei oder drei Vorstellungen gegeben. Im Jahre 1869 gab es im neuen Haus zwölf, im darauffolgenden Jahr fünfzehn Neuinszenierungen.
Bei der Uebersiedlung vom Theater an der Wien ins große Haus hat man sich entschlossen, sofort täglich zu spielen, und da zeigte es sich, daß man im Theater an der Wien nicht lange genug vorausger)lant hatte. Der jahrelange Managementbetrieb und das im Theater an der Wien zur Routine gewordene Von-der-Hand-in-den-Mund-Leben, ohne daß an einen einheitlichen Wiener Opernstil auch nur gedacht wurde (in den allerersten Jahren konnte man das auch nicht), rächen sich jetzt. Die Ausstattungen vor allem waren mehr oder weniger dürftig, was in dem kleinen Theater viel weniger zutage trat als jetzt, da man sie im festlichen Rahmen des großen Hauses sieht.
ZIEHT MAN ZUM VERGLEICH mit den Leistungen der Wiener Staatsoper die der andern großen Opernhäuser in der Welt heran, so sollte man nicht vergessen, daß die Metropolitan, die Scala und Covent Garden nur einen Teil des Jahres, maximal sechs Monate, spielen — und über wesentlich reichere Mittel verfügen. Die Stargehälter betragen dort durchschnittlich 1000 bis 1200 Dollar pro Abend (mit Spitzenhonoraren bis zu 1500 Dollar, zu multiplizieren mit 25)), und eine mittlere deutsche Bühne, zum Beispiel Bielefeld, kann sich fallweise ein Solistenhonorar von 1500 DM leisten. Zum Vergleich: Das Spitzenhonorar der Wiener Staatsoper beträgt ge?enwärtig 4200 S. Daher kann es sich die Wiener Staatsoper auf die Dauer nicht gestatten, daran werden wir uns gewöhnen müssen, jede Vorstellung mit Stars zu besetzen. Ebensowenig wie andere, besser dotierte Opernhäuser übrigens. Gewiß sollen nach wie vor an jede Aufführung hohe Maßstäbe angelegt werden. Aber wer einmal Gelegenheit gehabt hat. en suite die Aufführungen der Opernhäuser etwa von Rom, Paris oder Berlin zu besuchen, der weiß, daß auch dort mit Wasser gekocht wird. — Daß einige der Neuinszenierungen der Wiener Staatsoper einer besseren und intensiveren Spielleitung bedürfen, steht außer Frage. Bühnenbilder und Kostüme müssen sich — leider — nach den finanziellen Möglichkeiten richten, ebenso die Besetzung. Es erscheint uns daher unbillig, nach den ersten drei Monaten angestrengter Arbeit über die gesamte Leitung und Leistung der Staatsoper den Stab zu brechen.
DAS BREITE PUBLIKUM teilt, wie wir als Augen- und Ohrenzeugen wissen, dieses „Unbehagen“ der Kritik nicht. Das beweist nicht nur der oft stürmische Applaus, der einzelnen Sängern und dem gesamten Ensemble am Schluß der Vorstellungen gespendet wird, sondern auch der Besuch. Laut Mitteilungen der Bundestheaterverwaltung gab es im Dezember 9, im Jänner 18 und in der ersten Hälfte Februar 7 total ausverkaufte Vorstellungen, Die übrigen waren „hochprozentig“ besucht. Ohne Zweifel ist hierbei zu berücksichtigen, daß das neue Haus als besondere Attraktion mitwirkt. Aber das bedeutet für die Wiener Staatsoper auch eine ungewöhnliche, einmalige Chance. Wer einmal — und vielleicht zum erstenmal — in der neuen Oper gewesen ist, wird gern wiederkommen. Daß er von Mal zu Mal, von Monat zu Monat von dem, was er da hört und sieht, immer mehr befriedigt und begeistert wird, das wünschen wir dem Publikum und der Oper.