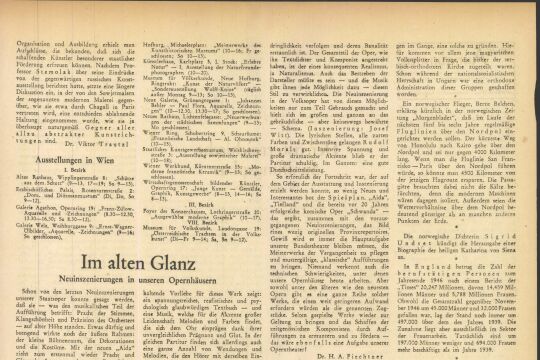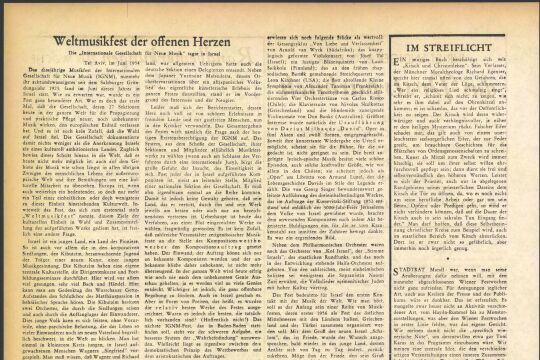Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das geistige Profil der Wiener Staatsoper
Anlaß zu diesem Brief ist die Nachricht, die allem Vernehmen nach auf Wahrheit beruht, daß der „W o z z e c k“, auf den wir schon sechs Jahre vergeblich warteten, in Wien nicht mehr aufgeführt werden soll. Es ist bezeichnend, daß dies niemals, weder vor noch nach den beiden durchaus erfolgreichen Aufführungen am 9. und 11. Februar, bekanntgegeben wurde. Doch lassen gut informierte Quellen keinen Zweifel darüber, daß der „Wozzeck“, nur für Paris einstudiert, „sang- und klanglos“ von der Wiener Bühne verschwinden soll.
Dieser Fall ist nur ein Beispiel und ein Symptom für eine Programmpolitik, die sich mit einer in der Operngeschichte einmaligen Konsequenz auf die Standardwerke einer längst historisch gewordenen Epoche, der klassischen und romantischen Musik, beschränkt, unter Ignorierung all dessen, was die Musikentwicklung eines halben Jahrhunderts gebracht hat.
Unter den 69 Opern, die die Programme beider Häuser der Wiener Staatsoper als „im Spielplan stehend“ aus weisen (wobei gar nicht nachgerechnet werden soll, was davon wirklich ständig gebracht wird), befinden sich drei Werke, die man eventuell als „der modernen Schule entwachsen“, wenn auch nur als Nebenprodukte, bezeichnen könnte, und zwar Menottis „Konsul“, der geistig allein dem beliebten Verismus des 19. Jahrhunderts verpflichtet ist, Prokofieffs Frühwerk „Die Liebe zu den drei Orangen“ und Honeggers dramatisiertes Oratorium „Johanna auf dem Scheiterhaufen“. Die wesentlichen Meister des 20. Jahrhunderts aber und ihre Werke, die die gesamte Musikentwicklung revolutioniert und ganz neue Möglichkeiten des musikalischen Theaters erschlossen haben, die auf der gesamten übrigen Welt anerkannt und aufgeführt werden, wie Alban Berg, Hindemith, Strawinsky, Bar- tok, Krenek, Orff, Egk, Milhaud, um nur die allerwichtigsten zu nennen, wurden so gründlich beiseitegelassen, daß es unter dem Wiener Publikum wenige gibt, die deren Namen kennen.
Die Auswirkung dieser Programmpolitik, die jeder mit dem Problem Vertraute von allem Anfang an hätte voraussehen können, wird heute bereits auch dem weniger Einsichtigen klar. Es ist der Mangel an Kontrasten und an neuen Eindrücken, der das auch noch so umfangreiche Repertoire verstauben und veröden läßt. Noch zu Gustav Mahlers Zeiten, als die Wiener Oper den Gipfel ihrer künstlerischen Entwicklung erreicht hatte und das Publikumsinteresse noch reger war, bestanden die Neuinszenierungen zur Hälfte aus Ur- und Erstaufführungen moderner Werke. Heute versucht man es, den frischen Geist durch die Reize üb er spitzt-r affinierter Inszenierungen zu ersetzen, womit weder dem Geschmack noch der Kunst irgendwie gedient wird. Hat die Oper in Wien bereits den Kontakt mit dem Geist der Gegenwart verloren, ist sie ein totes Museum qualitativ unterschiedlichster Produkte vergangener Zeiten und verflossenen Geistes geworden, in dem für jeden geistig regen Menschen sich bereits der Staub der Langeweile fingerdick ablagert? Und hier, beim Worte „Museum“, könnte wohl der traurige Verdacht auftauchen, der hier eingetretene Zustand wäre inspiriert durch jenen berühmten letzten Brief Richard Strauß’ an Dr. Karl Böhm, der auch einmal anläßlich einer der vielen Inszenierungen seiner Werke ostentativ im Programm abgedruckt wurde, worin ein resignierter Greis, der die Entwicklung der Musikgeschichte um 40 Jahre überlebt hat, in Verkennung aller Naturgesetze des Theaters, der Oper für die Zukunft überhaupt nur mehr die Funktion eines Museums der Standardwerke von Gluck bis (natürlich) Richard Strauß überlassen will.
Die frappante Kongruenz dieser Idee mit dem Bild, das das Wiener Opernrepertoire heute bietet, legt den Schluß nahe, die Opernleitung sei von solchen merkwürdigen Vorstellungen ausgegangen. Man müßte sich bemüßigt fühlen, diese durch Argumente zu widerlegen, läge es nicht auf der Hand, daß jeder denkende Theatermann sich diese Argumente selbst stellen könnte, wie es auch in dem Artikel geschieht, den Sie, Herr Sektionschef, persönlich in der Zeitschrift „Komödie“ (Heft 2, 1947, S. 58) unter dem Titel „Wie ich mir die Führung der Staatstheater denke“, geschrieben haben.
Ich erlaube mir, auszugsweise zu zitieren:
„Die Führung der Staatstheater stelle ich mir nicht nur so vor, daß die Theater das beste Ensemble bekommen und alle künstlerischen Leiter und Schauspieler in einer vollkommenen Ensemblekunst verschmelzen, sondern daß vor allem einmal diese Theater ein geistiges Profil erhalten ..„Ebenso wichtig ist aber auch das geistige Profil der Wiener Staatsoper. Der Weg, der in Salzburg mit Einems ,Dantons Tod‘ beschritten worden ist, muß unbedingt fortgesetzt werden. Deshalb muß keineswegs die Oper zu einer Experimentierbühne werden. Aber neben dem vollendeten Mozart, dem ausgezeichneten Verdi muß eben auch der modernen geistigen Strömung Rechnung getragen werden, die jungen Komponisten müssen zu Wort kommen. Die Zeit wird entscheiden, ob sie nur Geschöpfe der Zeit oder bestimmt waren für die Ewigkeit ...“ „Es war für mich ein Erlebnis, mit Männern wie Zuckmayer und Orff über die wichtigsten Probleme des Theaters und der Musik sprechen zu können. Dies um so mehr, als diese Männer mir bestätigt haben, daß die eingeschlagenen Wege und die eingeschlagenen Ziele vom Standpunkt des geistigen Europa aus richtig sind. Das hat mich noch mehr bestimmt, den eingeschlagenen Weg unbedingt, sicher und unbeeinflußt w eite r zug eh e n.“
Und nun frage ich, von der Folgerichtigkeit dieser Gedanken und Vorsätze tief beeindruckt: Was ist ge schehen, das dieses tapfere Vorhaben hemmte? Welche Mächte vermochten die weitere Profilierung des geistigen Antlitzes der Wiener Staatsoper zu verhindern und das Schicksal des „Museums“ zu verhängen? Es ist doch wohl nicht notwendig, daß der Leiter der Bundes- th.eater Verwaltung die Verantwortung für andere trage. Man muß den Gedan ken zurückweisen, daß die einzige Diskussionsbasis in der Erörterung bestehen kann, ob der Publikums- und
Kassenerfolg auf die Dauer nur mit d’Albert, Kienzl, Lortzing, Schmidt, Salmhofer, Lehar, Millöcker, Offenbach, Johann Strauß, Suppe, neuerdings auch Heuberger, weiter Massenet, Auber und Flotow, aber selbst mit Puccini, Tschai- kowsky, Bizet und R. Strauß zu erzielen sein wird. Ich erlaube mir, daran zu zweifeln.
Was dem „konservativen“ Wiener Publikum angekreidet wird, ist in Wirklichkeit auf diese Programmpolitik, die nicht nur von den Bundestheatern verfolgt wird, zurückzu führen. Ist es denn wirklich schon soweit — und diese Frage ist nicht ironisch gemeint —, daß das Wiener Publikum, das als das geschmackvollste gilt, dem der österreichischen Provinzbühnen von Graz, Innsbruck und Linz geistig unterlegen wäre, wo Werke von Kienek, Hindemith, Benjamin Britten, Bartok, Strawinsky, Orff und Egk erfolgreich aufgeführt werden konnten? Trotzdem kann die Tatsache nicht mehr verborgen bleiben — wie die immer weitersteigenden, demonstrativ betonten Erfolge der neuen Musik bei den wenigen Gelegenheiten, die dazu geboten wurden, beweisen —-, daß sich eine neue, anwachsende Publikumsschicht herausbildet, die in Opposition steht zur herrschenden Programmdiktatur, ein benachteiligtes „inneres Proletariat“, das nicht nur von der jungen Generation gebildet wird, und von dem — auf eine etwas weitere Sicht als die Eintagsperspektive, aus der heraus heute in Wien Programme gemacht werden — di e b e- rechtigte Hoffnung auf ein Weiterleben, auf ein S ich- behauptenkönnen Wiens als M usik stadt in den Augen der Welt und vor dem Forum der Geschichte besteht.
Instrument dieser Minderheit zu sein, ist die Aufgabe dieses Briefes. Akzeptieren Sie ihn, sehr geehrter Herr Sektionschef, als Bitte, die einer für alle diejenigen ausspricht, denen Tradition und Kultur und Geist keine inhaltslosen Phrasen, sondern Lebendiges sind. Die Wiederaufnahme des „Wozzeck“ und „The Rakes Progress“ soll ein Beginn sein, auf einem neuen Weg „u nb e- d in g t, sicher und unbeeinflußt weiterzugehe n“.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!