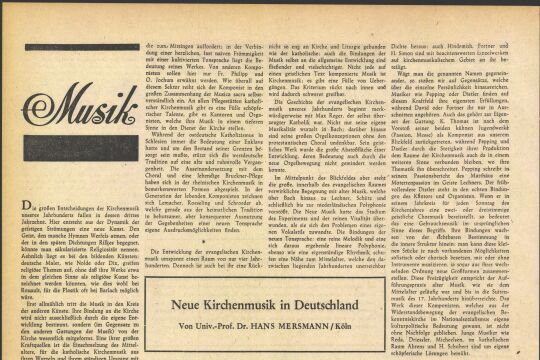Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Musik und Zeiigeisi
Wenn nicht alle Zeichen trügen, so vollzieht sich im musikalischen Schaffen unserer Tage eine Wandlung, die es von dem des vorausgehenden Menschenalters, also die Musik von 1950 von der von 1920, immer deutlicher abzuheben beginnt. Aufmerksam gemacht wurden wir darauf aber bereits vor eineinhalb Jahrzehnten, und zwar durch Paul H i n d e m i t h, der in seiner „Unterweisung im Tonsatz“ aussprach: „Frommen Meistern war die Kunst des Setzens ein Mittel, Gott zu loben und die Gemeinde der Mithörenden am Lobe teilnehmen zu lassen. Daß das Werk zur Ehre des höchsten Wesens geschaffen wird und darum auch seiner Unterstützung sicher ist, spüren wir bei vielen Komponisten, selten aber so eindringlich wie bei Bach, dem das Jesu juva' in seinen Partituren keine leere Formel war.“
Wie prägnant ist hier das Religiöse als die gestaltende Macht der geistigen Welt in Bachs Musik erfaßt! Wie tief aber hat Hinde-mith im gleichen Zusammenhang auch die Wahlverwandtschaft der neuen Musik mit der alten Musik begründet, wenn er sagt: „Ich weiß mich mit dieser Einstellung einig mit eirter Zeit, die weit von dem liegt, was die Allgemeinheit heute als Blütezeit der europäischen Musik auffaßt,“ Man könnte einwenden, daß es eine unstatthafte Verallgemeinerung sei, diese Auffassung eines einzelnen Komponisten für die zeitgenössische Musik schlechthin in Anspruch zu nehmen, daß Hindemiths Zeugnis doch nur für ihn persönlich gelten könne, ja, daß selbst bei ihm Theorie und Praxis nicht unbedingt ein und das gleiche seien. Nun, man braucht demgegenüber wohl kaum den Bogen aufzuzeigen, der sich vom „Marienleben“ über das „Unaufhörliche“ und über den „Mathis“ bis zum „Apparebit repentina dies“ spannt, um klarzustellen, wes Geistes Kind Hindemith wirklich ist.
Und ebensowenig ist ein Zweifel möglich, daß jene Worte nicht nur für Hindemith selbst, sondern für einen großen Teil der jungen Generation, die sich ihm mehr oder minder sinnfällig anschließt, mehr als eine historische Feststellung, daß sie ihnen künstlerisches Bekenntnis sind. Sehen wir einmal ab von dem längst bekannten Phänomen, daß die evangelische Kirchenmusik, die mit dem Tode Bachs „zu Ende“ war, in Deutschland seit einem Menschenalter eine schöpferische Auferstehung auf breiter Front erlebt hat, mit Distler, Pepping, Drießler und vielen anderen mehr, denen sich die Oesterreicher Johann Nepomuk David und eine ganze Gruppe von Deutsch-Schweizern mit Burkhard, Geiser, Brunner u. a. anschließt.
Wenn wir aber unseren Blick auf das internationale Konzertleben richten, dessen Wandlung uns nach langjähriger Isolierung doppelt deutlich vor Augen steht, dann begegnen wir nach Strawinskys älterer „Psalmensinfonie“ nun auch seiner Messe, begegnen der „Liturgischen Sinfonie“, den Claudel-Mysterien wie der „Johanna“, dem „Totentanz“ von Arthur Honegger, begegnen der „Sinfonia da Requiem“ Benjamin Brittens, der „Missa solemnis pro pace“ von Alfredo Casella, dem „Stabat mater“ von Francis Poulenc, dem Golgotha-Oratorium von Frank Martin; oder wir begegnen einen Meister wie Joseph Haas, der aus der katholischen Kirchenmusik zu den weit hinauswirkenden Formen von Singmesse und Volksoratorium findet, begegnen vollends den Erscheinungen so ausgeprägter religiöser Mystiker wie der des jüngst verstorbenen Heinrich Kaminski in Deutschland oder der Olivier Messiaens in Frankreich. Und angesichts eines so erdrückenden Materials ist es doch wohl kaum möglich, sich der Erkenntnis zu verschließen, daß sich innerhalb der neuen Musik des letzten Menschenalters, weit über die Grenzen eines einzelnen Landes hinausgreifend, eine geistige Wandlung erstaunlichen Ausmaßes und ebenso erstaunlicher Zielsetzung ankündigt.
Um es auf eine klare Formel zu bringen: die Musik, die in ihrer unablässig fortschreitenden Verweltlichung seit der Mitte des 18. Jahrhunderts ihre großartige Entwicklung zur Sprache des Subiektiven und Individualistischen einerseits, des Realistischen und Objektiven anderseits durchgemacht hat — sie kehrt heute, wenn nicht alle Zeichen trügen, wieder in ihren Ursprung, in das Religiöse ein.
Der unmittelbare Anstoß zu dieser Umwertung der Werte lag im Ausbruch des zweiten Weltkrieges und war schlechterdings nicht zu ignorieren. Denn es ist nicht zu ver-
DIE~WARTE~“
MITE 1 / NUMMER K «• MÄRZ 1»5J
kennen, daß die Situation, die er hervorgerufen hat, von der nach dem ersten Weltkrieg so verschieden ist wie Tag und Nacht. Was damals bei Siegern und Besiegten gleichermaßen als eine Befreiung von den letzten Fesseln einer überalterten Tradition erschien, ist jetzt zu einer Daseinsfrage auf Leben und Tod geworden. Die aufgeklärten und mehr oder minder materialistischen Weltanschauungen, die sich in unseren politischen Systemen verkörpern, haben die Welt in Schrecken gestürzt, und man kann nicht gerade behaupten, daß die aufgeklärten Ideale der Toleranz und Humanität sich im praktischen Leben der Menschheit wirksamer durchgesetzt und besser bewährt hätten als die christlichen Ideale von Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Wohl aber ist nicht zu verkennen, daß die letzten noch vorhandenen Glaubenskräfte sich beim Ansturm der Nemesis als die weitaus widerstandsfähigsten erwiesen haben.
Ist es da ein Wunder, daß die Menschheit angesichts des drohenden Menetekels ihrer apokalyptischen Selbstvernichtung im Taumel des aufgeklärten Radikalismus wieder Zuflucht bei den religiösen Geisteskräften sucht, die eben von der Aufklärung verschüttet wurden? Ist es ein Wunder, daß Ernst Toch seine zweite Sinfonie unter das Motto stellt: „Und wenn die Welt voll Teufel war'“ — ist es ein Wunder, daß die beiden aktuellsten Texte der heutigen Musik lauten: „Dies irae“ und „Dona nobis pacem“ — die beiden Höhepunkte von Meßordi-narium und Totenmesse, Texte, die ohne Bezug auf den „Judex crederis esse venturus' und auf das „Agnus dei, qui tollis peccata mundi“, also auf die Personalunion von Lamm und Richter, kurzum ohne Bezug auf die christliche Heilsbotschaft, völlig sinnlos und unverständlich wären?
Das ist das Bild, das sich bei nüchterner Betrachtung der heutigen Situation ergibt — und fürwahr: ist es nicht geeignet, unsere gewohnheitsmäßige Betrachtung der musikalischen Entwicklung, unsere Einstellung zur aktuellen Problemlage völlig umzustoßen? Seit Strawinskys „Sacre du printemps“ und Schönbergs „Pierrot lunaire“, also seit genau vierzig Jahren, vielleicht sogar schon doppelt so lange, nämlich seit Wagners „Tristan“, haben wir uns darauf eingestellt, Fortschrittlichkeit o.der^ Konservativismus der Musik an ihrer Tonsprache abzulesen. Und ebenso haben wir uns daran gewöhnt, daß der eine gerade diejenige dieser Eigenschaften als die wahrhaft produktive pries, die der andere als völlig unproduktiv verwarf. Bei solch babylonischer Sprachverwirrung kommen wir nun allerdings schon längst nicht mehr weiter. Während sich das Gezänk um die neue Musik in dieser Sackgasse festgerannt hat, sind die schöpferischen Geister, voran die ebenso scharf wie verschieden geprägten Individualitäten wie Bartok, Strawinsky und Hindemith, neuerding's in verblüffend analoger Wandlung ihrer eigenen Tonsprache völlig über die Alternative zwischen Tradition und Fortschritt hinausgewachsen. So konnte Strawinsky sich anläßlich seiner letzten Oper „The Rake's Progress“ in verwandter Altersweisheit ausdrücklich auf das große Wort Giuseppe Verdis berufen: „Kehren wir zu den alten Meistern zurücjc, und es wird ein Fortschritt sein.“
Das aber bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als daß Fortschritt und Konservativismus keineswegs nur in Antithese, sondern ebensowohl auch in Synthese treten können. Es erinnert uns an die ebenso alte wje simple Wahrheit, daß die Entwicklung der Kunst niemals geradlinig ins Uferlose führen, sondern immer nur nach Art einer Pendelbewegung in ewigem Auf und Ab zwischen den Extremen von Evolution und Tradition erfolgen kann. So ist die Frage nach dem Entweder-Oder schon an sich falsch gestellt, weil sie Ursache und Wirkung verwechselt. Denn dies eine lehrt uns die Musikgeschichte immer wieder auf das deutlichste: daß nicht die Behandlung des Klangstoffes den Geist der Musik gestaltet, sondern daß die Sache gerade umgekehrt ist. Mit anderen Worten: die Tonsprache entwickelt sich nicht, wie wir so gerne meinen, nach immanenten, physikalischmusikalischen, sondern nach transzendenten, geistig-metaphysischen Prinzipien. Oder, um es nur ja recht eindringlich zu machen: nicht der Ton, wie es uns ein unverkennbar materialistisches Schlagwort so wirkungsvoll eingehämmert hat, sondern der Geist ist es, der in letzter Instanz auch die Musik macht! Er ist recht eigentlich die treibende Kraft des Entwicklungsprozesses der Musik, des Pendelschlages zwischen Tradition und Fortschritt, des Pulsschlaees zwischen Stil und Mode, kurz: das schlagende Herz1 der Musikgeschichte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!