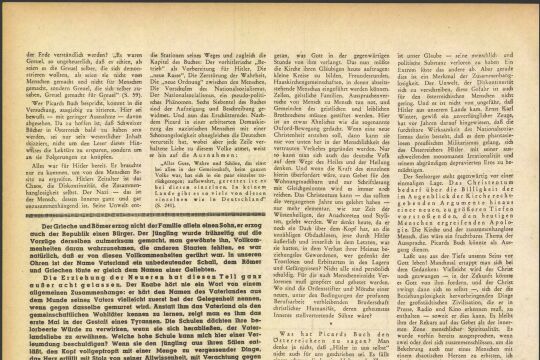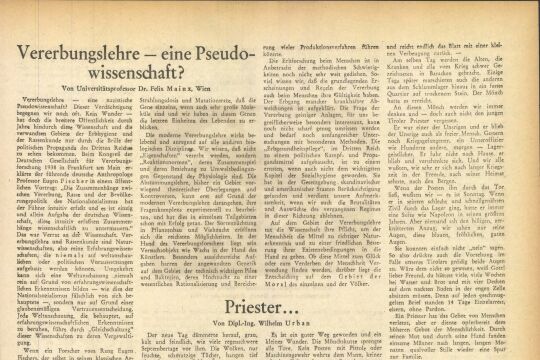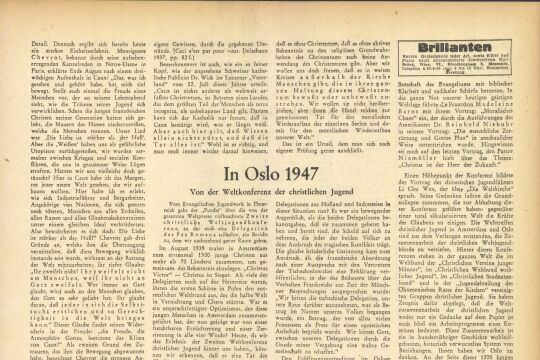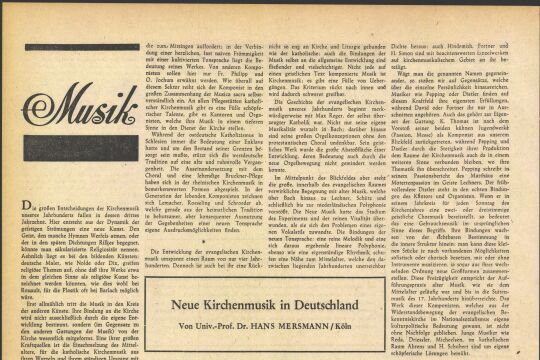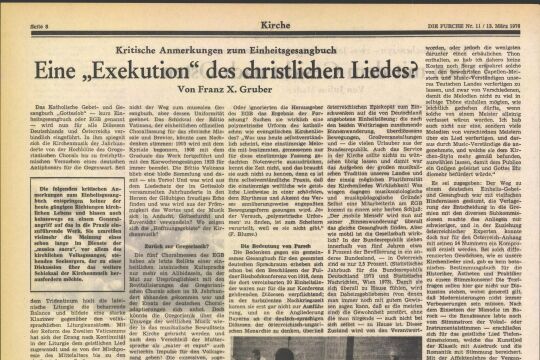Kirchenmusik vor neuen Gestaden
Kennzeichnend für die Kirchenmusik am Purismus, der cäcilianischen Reformbewegung Beginn unseres Jahrhunderts steht die Tat- fand auch die Messen der „Wiener Klassiker'1 sache des Unvermögens einer Symbiose des nicht kirchlich genug, hätte nicht Alfred gregorianischen Chorals mit den letzten Aus- Schnerich ihre; „Sanctitas“, „Bonitas -formaef' läufern der verglühenden Spätromantik, die und „Universitas“ unentwegt verteidigt.Dje Franz Liset in seiner „Missa choralis“ noch ge- päpstlichen Enzyklika Pius' X. und seiner lang. In einem gewaltigen Anpassungsprozeß, Nachfolger warben .zu.-knapp und.präzeptiy, als der die geistigen Strukturen der Kirche dem daß sie neues Leben in eine musikalisch er- seit der Aufklärung vorherrschenden Intellek- starrte Landschaft hätten bringen können, und tualismus angleichen sollte, bleiben die Kräfte die Kanäle zu den Strömungen der ersten De- dort eingesetzt, wo sich Fortschritt im Organi- zennien des 20. Jahrhunderts waren blok- satorischen auch im kirchlichen Raum zeigte, kiert... So verbrauchten sich die schöpferi- und so wurde mit Anton Bruckner der letzte sehen Kräfte in Symphonie und Oper, um mit große Kirchenmusiker zu Grabe getragen, mit der Raffinesse eines überhitzten Orchesters den dem auch das wechselseitige Spiel von geist- Leerlauf des Klanges“, durch ein Fbrtissimo aus licher und weltlicher Musik zu Ende ging. Der dem Orchestergraben wettzumachen.
Kennzeichnend für die Kirchenmusik am Purismus, der cäcilianischen Reformbewegung Beginn unseres Jahrhunderts steht die Tat- fand auch die Messen der „Wiener Klassiker'1 sache des Unvermögens einer Symbiose des nicht kirchlich genug, hätte nicht Alfred gregorianischen Chorals mit den letzten Aus- Schnerich ihre; „Sanctitas“, „Bonitas -formaef' läufern der verglühenden Spätromantik, die und „Universitas“ unentwegt verteidigt.Dje Franz Liset in seiner „Missa choralis“ noch ge- päpstlichen Enzyklika Pius' X. und seiner lang. In einem gewaltigen Anpassungsprozeß, Nachfolger warben .zu.-knapp und.präzeptiy, als der die geistigen Strukturen der Kirche dem daß sie neues Leben in eine musikalisch er- seit der Aufklärung vorherrschenden Intellek- starrte Landschaft hätten bringen können, und tualismus angleichen sollte, bleiben die Kräfte die Kanäle zu den Strömungen der ersten De- dort eingesetzt, wo sich Fortschritt im Organi- zennien des 20. Jahrhunderts waren blok- satorischen auch im kirchlichen Raum zeigte, kiert... So verbrauchten sich die schöpferi- und so wurde mit Anton Bruckner der letzte sehen Kräfte in Symphonie und Oper, um mit große Kirchenmusiker zu Grabe getragen, mit der Raffinesse eines überhitzten Orchesters den dem auch das wechselseitige Spiel von geist- Leerlauf des Klanges“, durch ein Fbrtissimo aus licher und weltlicher Musik zu Ende ging. Der dem Orchestergraben wettzumachen.
Aber war die Kirchenmusik die einzige Leidtragende in dieser so zwiespältigen Zeit? Hatte nicht der Historismus in der kirchlichen Baugesinnung die Signale zur Retrospektive der Kirchenmusik gegeben? Erst nach dem kurzen Versuch auch eines kirchlichen Jugendstils wurden die Wege zur Moderne geebnet. Die Annäherungsversuche, im kirchenmusikalischen Geschehen nachzuziehen, waren eher zaghaft; anscheinend war der Stil der neuen Kirchen Grund genug, sich zufrieden zu geben. Wer wagte es noch dazu, sie mit problematischen Aussagen von Kompositionen zu belasten, wenn die Ästhetik des Raumes wie ein Damoklesschwert über den Gläubigen hing? Es wurde der Anschluß verpaßt, und die es wagten, im Sinne der Zeit zu schreiben, einer Aufführung nicht für würdig erachtet. Die einsamen Rufer der zwanziger Jahre hörte man nicht, und die Musik der Kirche war auf Sparflamme gesetzt. Die große Synthese gelang nicht mehr, denn die Gesellschaft hatte sich schon im vergangenen Jahrhundert der Religion entledigt und in ihrer Musik mit dem Werk Richard Wagners das Thema der Erlösung von einem wohl menschlichen, aber zutiefst bürgerlichen Ausgangspunkt her angegangen. Keiner der Großen hielt es noch für notwendig, Musik für die Kirche zu schreiben, die Säkularisation war ein endgültiger Zustand geworden. Wie charakteristisch steht dafür das Beispiel Richard Strauss': Er verwendet das Credomotiv im „Zarathustra“ nur im karikierenden Sinn — „Von den Hinterwäldlern“!
Doch wider Erwarten waren es „Außenseiter“, welche die Türen zu ien Orgelemporen der Kirchen öffneten! Wer sind diese Outsider? Josef Matthias Hauer (1883 bis 1959) schrieb seine „Lateinische Messe“ im Tahre 1926, Paul Hindemith (1895 bis 1963) die Messe für gemischten Chor i capella im Jahre 1956 und Igor Strawinsky (1882 bis 1971) sein Hochamt für San Marco in Venedig im Jahre 1955. Die Offiziellen wußten mit dem „chinesisch“ katholischen Hauer so wenig anzufangen, wie mit dem Protestanten Hinde-nith und dem orthodoxen Strawinsky ...
Das Schicksal der Außenseiter ist bekannt. Sie werden nicht ernst genommen, erst später erkennt über ien anfänglich kleinen Kreis der Bewunderer hinaus die Allgemeinheit, was sie zu sagen hatten. Mit ler zunehmenden Organisation der Kirchenmusik war auch die Betriebsblindheit mithereingezogen and hatte „mutig“ die Ränder des :hristlichen Lebens besetzt. Erst langsam fand sich mit den liturgischen Bahnbrechern Pius Parsch md Michael Pfliegler die Richtung su den Quellen katholischer Glaubensgesinnung. In der Kirchenmusik ist dieses „Von-weit-her-Kommen“ der Außenseiter auffallend, nehmen sie doch musikalisch die Ökumene vorweg, die das II. Vaticanum dekretierte.
Des Entdeckers der Zwölftonmusik, Josef Matthias Hauers, liturgisches Werk aus der zweiten Schaffensperiode blieb ein Torso: Symbol
der Zeit, die neu anzufangen versucht, wo die Romantik zu Ende ging. In der Überschichtung des Klangbildes offenbart sich der Ubergang zu neuen Ufern. Der Schüler, Nikolaus Fheodoroff, vollendet mit dem vorhandenen meli-schen Entwurf das einzige Werk einer Messe im ursprünglichen Sinne der Zwölftonmusik und sagt über Hauers Messe:
„Sie gehört zu jenem Kreis von Werken, in denen Josef Matthias Hauer Großformen aus einer einzigen Zwölftonreihe zu entwickeln bestrebt war. Zu diesem Zweck wird die Reihe, das Grundmaterial, einer beständigen Permutation unterworfen, woraus bei einer entsprechenden Periodisierung mühelos eine logisch zusammengefügte Erweiterung resultiert. Somit ist dieses schöne und interessante Werk, das J. M. Hauer durchaus nicht als Finger- oder Geistesübung verstanden, sondern aus einer urreligiösen Haltung geschrieben haben mag, aufführbar geworden:“
Die Aufführung erfolgte freilich erst 46 Jahre später. (Wir berichteten darüber in unserer letzten Weihnachtsnummer.) Das für gemischten Chor, ein Kammerorchester und Orgel geschriebene Werk birgt meditative und mystische Kräfte wie die Messen Anton Bruckners und bleibt richtungsweisend auch für das Ende unseres Jahrhunderts, weil Hauer als „homo religio-sus“ zum Ordinariumtext der Messe in gläubiger Weise Stellung bezieht. Eine frühe Messe aus der Wiener Neustädter Periode des Meisters ist verschollen, und nach den Opern „Salambö“ und „Die schwarze Spinne“ verstummt der Kirchenmusiker Hauer, um in seiner dritten Schaffenszeit nur noch absolute, von den 44 Tropen gespeiste Zwölftonspiele zu komponieren.
/
Dem österreichischen Volksschullehrer Josef Matthias Hauer, mit seinem Beruf nach alter Lehrertradition der Kirche als Organist und Chorleiter verpflichtet, war das Anliegen um die „musica sacra“ wohl vertraut, für Paul Hindemith kam die Stunde der Berufung im Zenith seines Schaffens. Nach seinem Selbstzeugnis wollte sich der gar nicht so gute, aber treue Protestant, nicht in die Angelegenheiten der katholischen Kirchenmusik einmengen. Seine Zurückhaltung wurde noch durch die innere Überzeugung bestärkt, daß nach der klassischen Polyphonie Palestrinas nur wenig der katholischen Kirchenmusik hinzugefügt werden könne. Daß er sich aber intensiv mit den Formproblemen der Messe auseinandersetzte, bezeugt die Absicht, drei Messen für verschiedene Schwierigkeitsgrade zu komponieren. Die vollendete A-cap-pella-Messe, deren Uraufführung unter Hans Gillesberger mit dem Wiener Kammerchor am 12. November 1963 in der Wiener Piaristen-kirche stattfand, ist nur für „Spitzenchöre“ gedacht. Eine zweite, in der die vokalen Linien von Instrumenten leicht gestützt werden, war teilweise ausgeführt und befindet sich im Nachlaß. Eine dritte, „ganz leichte“, wollte Hindemith auch noch schreiben.
Was bewog ihn, mit der ausge-
führten A-cappella-Messe dennoch einen ausgezeichneten Beitrag zur katholischen Kirchenmusik beizusteuern? Waren es seine tiefe Gläubigkeit, das gute Zureden katholischer Freunde, die Vorbilder Johann Sebastian Bach, Robert Schumann und andere? Wir müssen seinem Biographen Andres Briner Recht geben, wenn er dazu schreibt: „Daß in der veröffentlichten Messe das Thema der menschlichen Existenz in einer ungesicherten geistigen und sozialen Welt hörbar wird, ist auch von Menschen wahrgenommen worden, die Hindemiths Tonsprache und ihrer Fragestellung an sich fernstehen. Es könnte sich im Laufe der Zeit erweisen, daß gerade diese Messe dazu bestimmt ist, Hindemiths Kunst als einen lebensnotwendigen Versuch verständlich zu machen, sich innerhalb eines unermeßlichen Chaos zu bewahren.“ Die Messe, im Todesjahr des Meisters geschrieben, weist in ihrer modernen Polyphonie zum Ausgangspunkt Palestrina und visiert die Kirchenmusik bis über die Grenzen unseres Jahrtausends an. In der Kürze und Dichte ihrer Aussage der Lateinischen Messe Hauers wesensverwandt, fügt sie dem verinnerlichten Ausdruck des Österreichers das mutige Bekennerhafte des Deutschen hinzu und wird mit Stra-
winskys russisch empfundener Liturgiesprache zu einem weitragenden Zeichen einer sich neu formierenden Glaubenswelt.
Für diesen letzten „grand old man“, Igor Strawinsky, wird Religion nie zu einem modischen Anliegen. Ein Komponist mit sakralen Ambitionen muß seine Karten offen auf den Tisch legen, ein gläubiger Mensch sein und nicht nur an „symbolische Gestalten“, sondern auch an die Person Gottes, an die Person des Teufels und an die Wunder der Kirche glauben.
„Wieviel ärmer sind wir ohne den sakralen musikalischen Gottesdienst, ohne die Messe, die Passionen, die Kantaten für • das ganze Kalenderjahr, die Motetten, geistlichen Konzerte und Vespern und soviel anderes. Dies sind nicht nur veraltete Formen, sondern Teile des musikalischen Geistes außer Gebrauch. Die Kirche wußte, was schon dem Psalmisten bekannt war: die Musik lobpreist Gott. Musik ist ebenso fähig oder sogar fähiger, ,Ihn' zu loben, als die Kirchenbauten mit ihrem ganzen Schmuck. Sie ist das größte Ornament der Kirche. Glory, Glory, Glory — die Musik der Motette von Orlandus Lossms preist Gott, und dieses besondere ,Gloria' existiert in der Welt nicht. Und nicht nur das Gloria, obgleich ich daran zuerst denken muß, weil das Gloria im Laudate, die Freude der Doxologie, alles andere als erloschen ist — auch Gebet, Buße und vieles andere können nicht verweltlicht werden. Das Wesen verschwindet mit der Form. Ich sage, daß wir einfach ohne die Kirche, unseren eigenen Plänen überlassen, um viele musikalische Formen ärmer sind.“
Dieser profunde Kenner der östlichen und westlichen Kirchenmusik sollte nach einer „Psälmensym-phonie“, einem „Pater noster“ und einem „Ave Maria“ jene wundervolle „Messe“ im Jahre 1948 schreiben, die rusissches Melos mit der lateinischen
Kirchensprache in einzigartiger Weise vermählt; er bezeichnet das Lateinische geradezu als die der Musik nächste Sprache und bedient sich ihrer in der „Psalmensymphonie“ und dem szenischen Oratorium „Oedipus rex“. Mit dem „Canticum sacrum“, einer Motette zu Ehren des heiligen Markus für Chor und Orchester, den „Threni“ (Lamentationen des Propheten Jeremias) und der Vervollständigung dreier Madrigale des Gesualdo di Venosa rundet sich das kirchenmusikalische Oeuvre des Außenseiters ab.
Mit der explosiven Ausklammerung der lateinischen Kultsprache durch die nachkonziliare Praxis der Regionalkirchen standen alle Möglichkeiten für die Muttersprache im Gottesdienst offen. Fast unvorbereitet trafen die Dekrete des II. Vaticanums das Volk Gottes und verschreckten erst recht die Kirchenmusiker, sich in der traditionsgesättigten, großen Form der lateinischen Meßkomposition auszudrücken, da die internationalen Großräume der katholischen Kirche zu musikalischen Partikularkirchen geworden waren und das Zeitalter der Ruralmesse mit deutscher Muttersprache und auswechselbaren Komponistennamen begann. Wenn schon die Kirchensprache national wurde, sollte sie einen Schuß Internatio-nalität durch die an den Jazz angelehnte Form des Rhythmus' gewinnen, und ähnlich, wie im vergangenen Jahrhundert sich eine Sturzflut gefälliger Kurz-, Leicht-, Sonntags-, Winter- und Messen im leichtesten „Kirchenstyl“ über die Gläubigen ergoß, geht es heute mit den dürftigen Fabrikaten modischer Kirchensongs. Den Ernst der Situation zeichnet nochmals Strawinsky: „Natürlich gibt es heute auch vulgäre Kirchenmusik, aber dann kommt sie in Wirklichkeit nicht von der Kirche, npch ist sie für die Kirche geschrieben.“ Wie sehr aber das lateinische Hochamt seinen hohen Stellenwert beim gläubigen Volk behalten hat, bezeugen die Besucherzahlen an den Feiertagen. Das Hochamt mit dem volkssprachlichen Charakter als Hochform mit Vielstimmigkeit und Orchester liegt noch in weiter Ferne.
Wird es tausend Jahre dauern? Soviel Zeit verging von der Einführung der altslawischen Kirchensprache unter dem heiligen Cyrillus bis zur glagolitischen Messe Leos JanäCeks (1854 bis 1928). Nach lateinischen Motetten, tschechisch geistlicher Chormusik, einer Modellmesse für seine Schüler ersteht das hinreißende Werk der „Missa Gla-golskaja“ und bietet sich unserer Kirchenmusik im Zeichen der Volkssprachlichkeit zur Nachahmung an..
„Es ist im Grunde das gleiche volksmäßig-vertrauliche Verhältnis zu Gott in seiner glagolitischen Messe, wie es aus den schönen tschechischen Advents-, Weihnachtsund Dreikönigsliedern atmet. Und aus diesem Anknüpfen an die Volksüberlieferung, durch das Jan&iek seine Abwendung von den Konventionen der künstlichen Kirchenmusik ausgleicht, ergibt sich auch eine weitere Eigentümlichkeit der Messe: einer alten Überlieferung folgend, beginnt und schließt die Messe mit feierlichen Fanfaren über Paukenbegleitung (die hier in orchestral ergänzter Gestalt erscheint); im Schlußabschnitt der Messe ist vor diese Fanfare noch das übliche Postludium eingefügt“ (Jaroslav Vogel).
*
Wird es ein Dufay um das Jahr 2000 sein, der aus regionalen Ebenen die Kirchenmusik zu neuen Gipfeln führt? Aber müßten nicht als unabdingbare Voraussetzung die nationalen Komposi teure ihr Schweigen um die „musica sacra“ brechen?