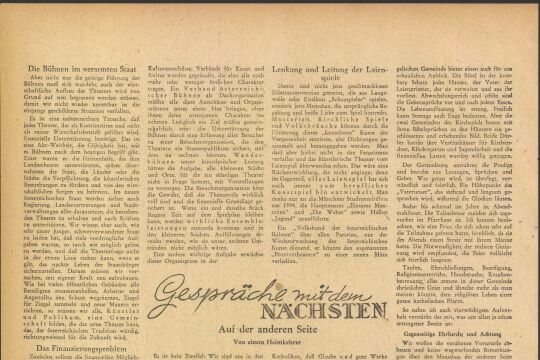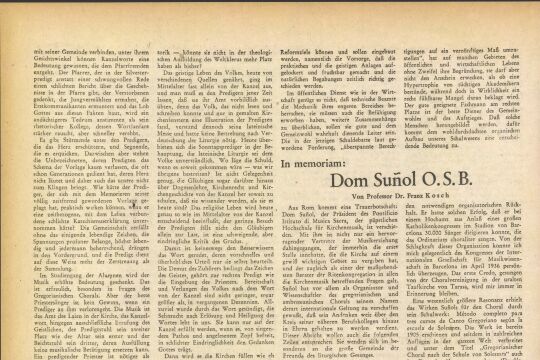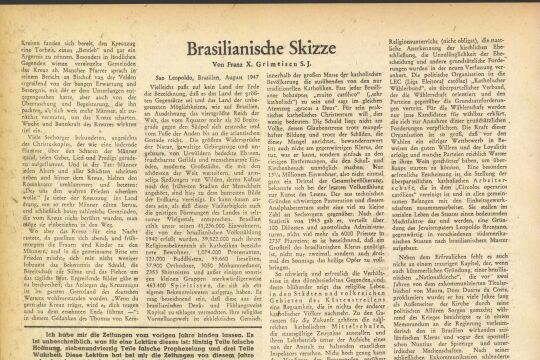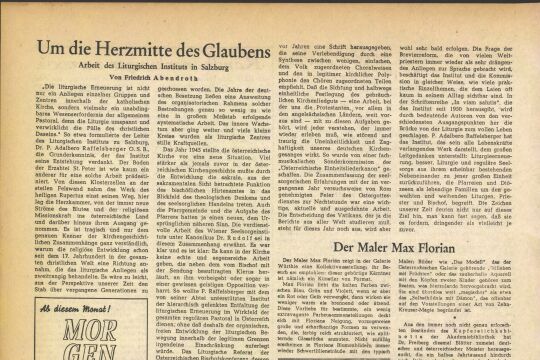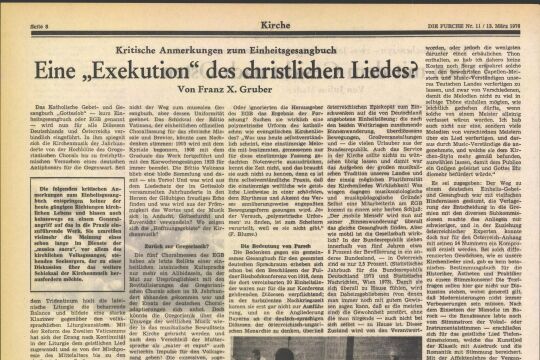Die Regel des hl. Benedikt ist zuvörderst Anweisung zur Vollkommenheit und Richtschnur für gemeinsames, auf Gott hingeordnetes Leben. Ihr Verfasser, einer der größten Charakterbildner aller Zeiten, hat mit geradezu unübertreffbarer Bedachtnahme jegliches Bedürfnis ins Auge gefaßt, es in kurzen, klaren Worten umschrieben und festgelegt. Ihm liegt vor allem die Verherrlichung Gottes am Herzen, wenn er sagt: „… es darf also nichts dem Gottesdienst vorgezogen werden.” (Kap. 43.) Seine Regel hat dadurch geradezu einzigartige Bedeutung für die Liturgie und daher auch in besonderer Weise für die Musik.
Die Kapitel 8—19 ordnen, wie bekannt, das tägliche Stundengebet. Sie sind ein Markstein in der Breviergeschichte und haben die Entwicklung wesentlich beeinflußt, obwohl ihr Verfasser in übergroßer Bescheidenheit ausdrücklich bemerkt: wenn dem einen oder dem anderen diese Verteilung nicht gefallen sollte, möge er sie ändern, wie es ihm besser erscheint.” (Kap. 28.) Dem Theologen ist dies Ausdruck wissender Demut, dem Künstler Gewährung individueller Freiheit.
Daß diese Freiheit durch den ohne Zwang geleisteten Gehorsam dem Abte gegenüber eine Bindung an die Regel eingeht, , ist in seiner höchsten Ausprägung geradįsu königliche Beherrschung des eigenen Ichs, die, ins Künstlerische versetzt, als Phantasie, gebändigt im Willen zur Gestalt, definiert werden müßte. Damit, daß Benedikt dem Stundengebet die wohlausgewogene Ordnung gab, war er nicht nur Mann des Gebetes, sondern auch Künstler. Das Herstellen harmonischer Verhältnisse, mit dem auch das musikalische Kunstwerk in höchstem Grade rechnet, ist hier die eigentliche Grundkraft, obgleich man sie hier nicht als solche ansieht und selbstverständlich dem Gebet den Vorrang gibt.
Aber nicht nur die Form liegt St. Benedikt am Herzen, auch die innere Haltung: „… stehen wir so beim Chorgebet, daß unser Geist im Einklang sei mit unserer Stimme.” (Kap. 20.)
Der Gründer von Monte Cassino wäre aber nicht jener überragende Menschenkenner gewesen, wenn er nicht auch gewußt hätte, daß man zum inneren Menschen auch die äußere Fähigkeit des Tuns besitzen muß. So schreibt er ausdrücklich am Ende des 38. Kapitels vor: „Die Brüder sollen aber nicht der Reihe nach vorlesen und singen, sondern nur, wer die Zuhörer erbauen kann.” Er wiederholt dies mit noch entschiedeneren Worten in Kap. 47, wo er verfügt: „Keiner nehme sich heraus zu singen oder vorzulesen, er sei denn imstande, diese Aufgabe so zu erfüllen, daß die Zuhörer erbaut werden. Das soll mit Demut, Würde und Furcht geschehen und von dem, der vom Abte den Auftrag erhält.”
Aus diesen Worten spricht nicht nur der große Theologe, sondern auch der ästhetisch empfindende Gestalter des Gottesdienstes, der genau weiß, ein wie stark integrierender Bestandteil des opus Dei die Musik ist. Diese einfachen, klaren Sätze sind das Fundament einer bis in die Gegenwart andauernden benediktinischen Musikkultur, die auch über die Klostermauern hinaus in die Welt gewirkt hat.
Schon dadurch, daß die Regel St. Benedikts Vorbild wurde für alle Mönchsorden des Mittelalters, gingen auch die auf das Singen bezogenen Weisungen in diese über. In der Mönchsregel Chrodegangs v. Metz (f 766), die für die weltlichen Kanonikats- stifte üblich wurde, finden wir beispielsweise die gleichen Gedankengänge, wenn Kap. 50 „Von den Sängern” verlangt, daß sie sowohl durch ihre Stimme als auch durch ihr Können hervorragend sein sollen (Migne, Patrol. Lat. 89, 1079). Sie haben auch sowohl Wort wie Ton „gut und schön” hervorzubringen. Wer das nicht Kann, “der solle schweigen, bis er es besser gelernt habe. Die Aufforderung zum Lernęn und Bessermachen wiederholt das 51. Kapitel und legt so auch seinerseits Zeugnis ab von der umfassenden Tätigkeit, die die Klöster des Mittelalters im Gesangunterricht entfalteten. Damit wird aber das schon bei Benedikt ausgesprochene ästhetische Moment herausgestellt und durch die Forderung nach Studium noch verstärkt. Also, nicht nur Innerlichkeit allein genügt in der kirchlichen Musik, man muß auch Schönheit und damit Erbauung geben; womit wiederum der oberste Zweck des opus Dei, die Hinwendung des Menschen zur Gottnähe, angestrebt wird.
Diese Anordnungen fielen auf fruchtbaren Boden; die Sängerschulen des Mittelalters in St. Gallen, Metz, Reichenau und an vielen anderen Orten wurden zu ausgezeichneten Pflanzstätten jener einstimmigen Kunst, die sich „Gregorianischer Choral” nennt. Nach dem Vorhergesagten ist es vielleicht auch kaum verwunderlich, daß der künstlerische Gestalter des Chorals, von dem er auch seinen Namen bekam, Papst Gregor I. der Große (540—604), selbst Benediktiner war. Seine Scola cantorum war es, die, von ihm angeregt, die künstlerisch so unendlich ausgewogene, aber auch virtuos beschwingte Gestalt der Melodien festlegte.
Bedenkt man, was diese chorale Kunst im Laufe der Jahrhunderte alles aus sich heraussprossen ließ, dann kann man einigermaßen erfassen, welche Bedeutung die Sorge Benedikts um die würdige Ausgestaltung des Gottesdienstes auch für die Musik hat. Anselm Schubiger hat in seinem Buch „Die Sängerschule von St. Gallen”, Einsiedeln 1858, ein anschauliches Bild des mittelalterlichen musikalischen Lebens gegeben, und dabei wird man mit Freude gewahr, wie der kulturbildende Auftrag des Stifters Neues entstehen läßt. Sequenzen, Tropen, geistliche Spiele, geistlich beeinflußte Begrüßungsgedichte, Kinderfeste, alles war in einem lebendigen Strom von Musik eingebettet, der Altar und Klosterhof, Gottesdienst und tägliches Leben durchfloß.
Daß er im Laufe der Zeiten versiegte, lag an mancherlei Faktoren, daß diese hohe einstimmige Kunst aber wieder neues Leben gewann, ist neuerdings benediktinisches Verdienst. Solesmes heißt der Ort und Dom Prosper Gueranger der erste Geist, an dem weitere sich entzündeten: Pothier, Mocque- reau, Gajard. Beide Male, im VI. Jahrhundert wie im XIX., sind die Zeiten durchaus nicht günstig, sind alles andere als ruhig, aber — „der Geist weht, wo er will” — und so nimmt die Musik zum opus Dei neuerdings gewaltigen Aufschwung. Unablässige wissenschaftlich-historische Arbeit führt zur Wiederherstellung der durch die Medicaea (1614) vollkommen verdorbenen gregorianischen Melodien. Mit päpstlicher Entschließung1 Pius’ X. von 1904 wird die authentische Ausgabe der „Vaticana” gutgeheißen und mit dem Graduale Romanum, 1908, der erste Band der wiedergewonnenen Melodien vorgelegt. Von da an datiert die Choralrestauration, der Wille des hl. Benedikt hat kunstreinigend gewirkt. Aus den Bestrebungen um die Liturgie wurde auch ein Werk im Dienste der Musik.
Die wissenschaftlichen Bestrebungen, die hier zu praktisch-künstlerischen Ergebnissen führten, sie waren dem Benediktinerorden schon im Mittelalter eigen. Der Name Engelberts von Admont (f 1331) stehe als einer für viele und wenn man an Fürstabt Martin Gebert von St. Blasian im Schwarzwald denkt (1720—1703), dann begegnet man in seiner Person einem Forscher auf liturgiewissenschaftlichem, aber auch musik- geschichtlichem Gebiet. Mit seinen „Scrip- tores ecclesiastici de Musica sacra potis- simum”, St. Blasien 1784, in deren drei Bänden er 63 Traktate erstmalig herausgab, hat er den Grundstein zur Erforschung der mittelalterlichen Musik gelegt.
Es blieb einem französischen Juristen, E. de Coussemaker, Vorbehalten, in Erkenntnis der großartigen Bedeutung dieses Werkes eine vierbändige Fortsetzung zustande zu bringen, die „Scriptores de musica medii- aevi”, Paris 1864—1876. Der benediktini- sche Geist des „ora et labora” wirkte hinaus in die Welt.’
Er hat dies auch sonst reichlich getan auf musikalischem Gebiet. Hermann, der Mönch von Salzburg, auch er war Benediktiner, schenkt uns im 14. Jahrhundert als einer der ersten in Österreich neben geistlichen Gesängen auch mehrstimmige weltliche Lieder, Tagelieder und volkstümliche Texte, der Schottenabt Benedictus Cheli- donius führt 1515 sein Schauspiel „Volup- tatis cum virtute disceptatio” mit vierstimmigen Chören von Jacobus Diamond auf, und noch in der Mitte des XVIII. Jahrhunderts spielt die Benediktineruniversität in Salzburg Schuldramen, deren zwei auch den damals zehnjährigen Mozart als Komponisten sehen: „Die Schuldigkeit des 1. Gebotes” und „Apollo und Hyazinthus”. Man lese in der außerordentlich gearbeiteten Studie Dr. P. Altmann Kellners über P. Benedikt Lechler, was und wie beispielsweise im XVII. Jahrhundert in Kremsmünster musiziert wurde. Dabei kann man sich eines vergnüglichen Lächelns nicht erwehren, wenn in einer Rechnung von 1647 zu lesen steht, daß „auf ir Gnaden geburts tag zu ainer Comedi ain Fux Claidt” und auch ein „Pern Claidt” von einem Kremsmünste- rer Kürschner gemacht wurde. Gregorianischer Choral und „Comedi”-Spielen, als äußerste Gegensätze, dazwischen Tafelmusik, etwa eine Sinfonia, und dazu die unterrichtende Tätigkeit: Es ist wahrlich reiches künstlerisches Leben, das sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat.
Das ist Vergangenheit, gleichzeitig aber Verpflichtung in der Gegenwart, denn; die Worte der Regel sind heute noch Tag für Tag lebendig und die Verpflichtung zum opus Dei besteht nach wie vor; so also auch die Sorge um die Musik. Es mag in den heutigen Zeiten oftmals schwer fallen, den Weisungen St. Benedikts nachzukommen, aber Hindernisse werden heute wie ehedem mit dem zuversichtlichen „ora et labora” überwunden. Daß mancher verzagen möchte angesichts unüberwindlich scheinender Schwierigkeiten, ist menschlich verständlich, aber hier verpflichtet nicht nur die Tradition, die sicher oftmals als Last empfunden wird, hier fordert das Leben und noch dazu ein Leben im Geiste und aus der Weisheit Benedikts. Immer noch, .wenn man glaubt, die Kirche sei tot, war sie lebendiger denn je, und in diesem Sinne wäre das Wiederaufleben von Chorknaben in den Stiften Österreichs sehr zu begrüßen. Jüngst hat das Schottenstift in Wien das Wagnis unternommen und damit der altgewohnten benediktinischen Musikerziehung einen neuen Brennpunkt geschaffen. Das ist aber nun nicht nur vom Standpunkt der liturgischen Musik aus wertvoll, sondern von dem der Musikerziehung schlechthin. Abgesehen davon, daß sorgfältiger Unterricht hier, unbeeinflußt von Tages- und Konzertereignissen, organische Fortbildung ermöglichen kann, die Buben stehen in täglicher praktischer Übung und wachsen so in eine Musikalität hinein, die ihresgleichen nirgends sonst möglich ist. Daß die Schulung nicht einseitig bleibt, dafür sorgt schon die Liturgie selbst mit der Abstufung der Feste, aber auch die sonstigen, in einem Stift vorkommenden Gelegenheiten.
Engherzigkeit ist der Ragei St. Benedikts vollkommen fremd und sie muß es auch allen, ob im Kloster oder in der Welt, sein, die mit Musik zu tun haben oder in Ihre Nähe geraten. Und wer nichts davon versteht, der bringe wenigstens verstandes- mäßig jenes Entgegenkommen auf, das für ein gedeihliches Wachsen der Musik notwendig ist. Ein aneiferndes Wort, ein weise gesprochenes Lob kann, auch wenn es aus „unmusikalischem Herzen” kommt, einem Sängerknaben Ansporn zu weiterem Fleiß sein. Die moraltheologische, wenn man will, auch pastorale Begründung dieser Forderung braucht Trägern geistlicher Gewalten ja im besonderen nicht auseinandergesetzt zu werden, außerdem ist sie ein rein ethisches Erfordernis — Menschenfreundlichkeit —, worüber eigentlich kein Wort zu verlieren ist.
So ist eigentlich durch die Regel Benedikts immer wieder Musik lebendig geworden, durch Jahrhunderte hindurch schon, in den mannigfachsten Formen und Arten. Da hat sich im Benediktinerorden ein Schatz von hohen künstlerischen Werten angehäuft. Es wäre an der Zeit, daß er einmal in zusammenhängender Darstellung der übrigen Welt gezeigt würde; vielleicht bietet das heurige Jubiläumsjahr den Anstoß dazu. Es ist bestimmt kein leichtes Unterfangen, aber auch seine Vollendung würde den Grundsatz St. Benedikts klar und deutlich aussprechen: „Ut in omnibus glorificetur Deus — Auf das in allem Gott verherrlicht werde.”