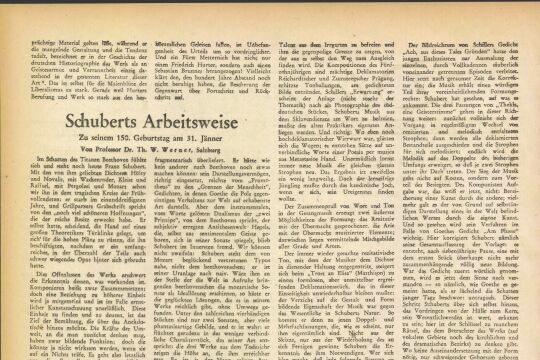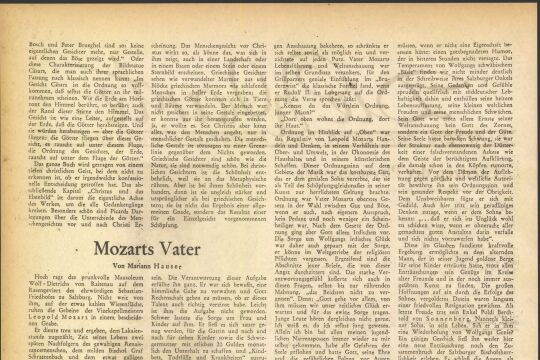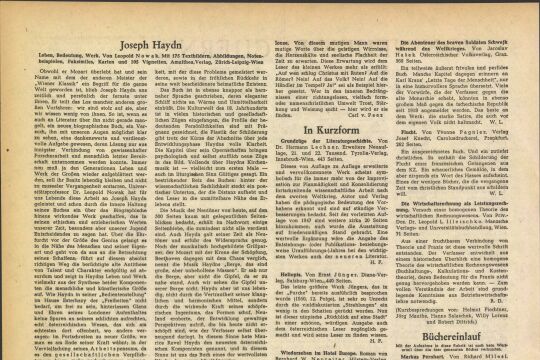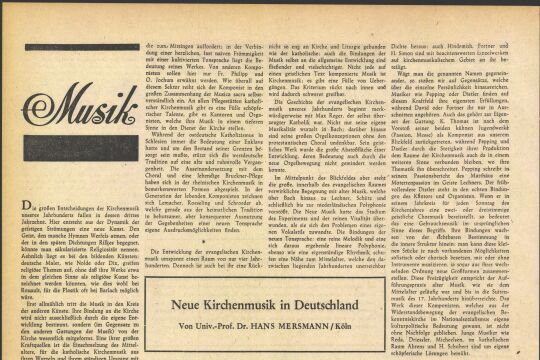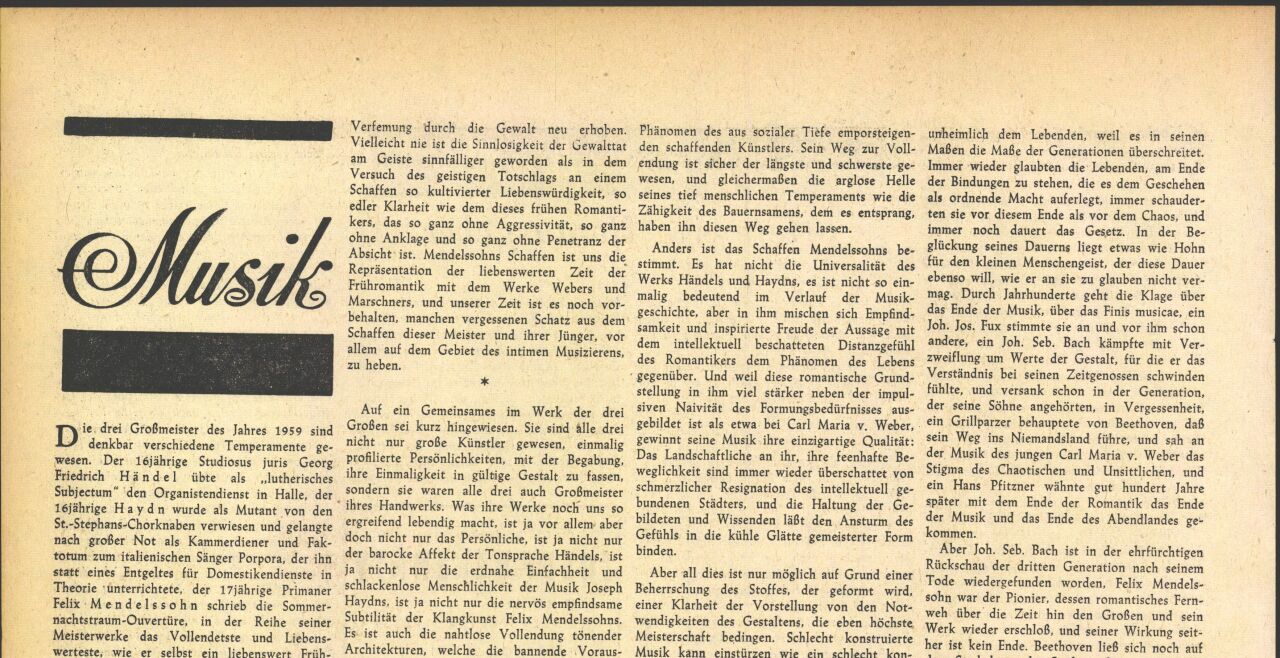
Die drei Großmeister des Jahres 1959 sind denkbar verschiedene Temperamente gewesen. Der 16jährige Studiosus juris Georg Friedrich Händel übte als „lutherisches Subjectum“ den Organistendienst in Halle, der 16jährige Haydn wurde als Mutant von den St.-Stephans-Chorknaben verwiesen und gelangte nach großer Not als Kammerdiener und Faktotum zum italienischen Sänger Porpora, der ihn statt eines Entgeltes für Domestikendienste in Theorie unterrichtete, der 17jährige Primaner Felix Mendelssohn schrieb die Sommernachtstraum-Ouvertüre, in der Reihe seiner Meisterwerke das Vollendetste und Liebenswerteste, wie er selbst ein liebenswert Frühvollendeter war, der mit 38 Jahren starb, Genosse Mozarts und Schuberts im raschen Verbrennen seiner Lebensenergie. Die beiden anderen Meister sind alt geworden. Händels Leben, eines der großen Zeugnisse des barocken Seinsgefühls, war ein Leben der äußersten Kontraste, der sich gewaltsam entladenden Energien des Schaffens und des Sichdurchsetzens, der Skandale, Zusammenbrüche und des gigantenhaften Sichwiederaufrichtens. Deutschland, Italien, England sind die Schauplätze, für die damalige Zeit noch' eine weltweite Lebensbühne, der Hauptakteur ein Mann der großen Welt, Freund von Königen und Aristokraten des Blutes und des Geistes, ebenso Gespött der Plebs wie Zielscheibe der Angriffe der Kritiker einer in sich vermorschenden höfischen Gesellschaft. In einem Tageskampf bis zur physischen Lähmung zerschlagen, der vielleicht zum erstenmal in der Musikgeschichte auch die aktuelle Werkpersiflage in Gestalt der Bettleroper des Pepusch, die als Dreigroschenoper sozial revolutionäre Sprengkraft noch in unserer Generation bewiesen hat, zum Werkzeug nahm, hat sich dieser Gigant an Lebenskraft wieder aufgerichtet, seine Gemeinde neu gewonnen und in der Großform des Oratoriums die Aussagegestalt geschaffen, die seinen Altersruhm befestigt und sein Werk über die Zeiten hin gesellschaftsträchtig gemacht hat.
Der alternde Haydn hat anläßlich seiner Englandreise die Pflege der Händelschen Oratorien dort erlebt und sich durch dieses Erlebnis inspirieren lassen, seine eigenen beiden Großkantaten, die „Schöpfung" und die „Jahreszeiten“, zu schaffen und damit unbewußt den Anstoß für das Entstehen der bürgerlichen Musikvereine zu geben, die das Musikleben bis in das 20. Jahrhundert hinein profiliert haben. Dies, nachdem er in der Ausreifung der Form des Streichquartetts und der klassischen Symphonie die Grundgestalten der bürgerlichen Musikkultur gewonnen hatte und nachdem er evolutionär den Stand des schaffenden und ausübenden Musikers aus dem Plebejertum in der aristokratisch feudalen Hierarchie zu einer Spitzenposition der bürgerlichen Gesellschaft humanisiert hatte: die sozialpolitische Lebensaufgabe, die Mozart revolutionär experimentell zu lösen versucht hatte und an der er in seinem Leben gescheitert war. Haydn aber schafft aus der Kraft seiner gewaltlosen Persönlichkeit jene Basis der Humanität für den Musiker, die es einem Beethoven und noch einem Brahms in Gnadenstunden der Blütezeit bürgerlicher Lebenskraft ermöglichte, ein Leben, ganz frei von jeder Bindung, dem eigenen Schaffen zu widmen, frei vom Auftrag eines Berufes, ja schließlich sogar frei von der Fessel beruflicher Musikübung. Händels und Haydns Werk haben bis heute kaum an Lebenskraft eingebüßt. Neben der dauernden gesellschaftsformenden Wirkung der Oratorien und Instrumentalwerke Händels hat gerade unsere Generation die eindrucksvolle Renaissance seines Opernschaffens erleben können. Haydns Werk nimmt in ungebrochener Lebendigkeit noch immer in unseren Programmen der Kammermusik und vielfach auch des Orchesterkonzerts einen breiten Raum ein. Subtileres Liebhabertum des Musizierens ist ohne seine Trios und Streichquartette nicht denkbar. Mendelssohns Werk hat sich aus der
Verfemung durch die Gewalt neu erhoben. Vielleicht nie ist die Sinnlosigkeit der Gewalttat am Geiste sinnfälliger geworden als in dem Versuch des geistigen Totschlags an einem Schaffen so kultivierter Liebenswürdigkeit, so edler Klarheit wie dem dieses frühen Romantikers, das so ganz ohne Aggressivität, so ganz ohne Anklage und so ganz ohne Penetranz der Absicht ist. Mendelssohns Schaffen ist uns die Repräsentation der liebenswerten Zeit der Frühromantik mit dem Werke Webers und Marschners, und unserer Zeit ist es noch Vorbehalten, manchen vergessenen Schatz aus dem Schaffen dieser Meister und ihrer Jünger, vor allem auf dem Gebiet des intimen Musizierens, zu heben.
Auf ein Gemeinsames im Werk der drei Großen sei kurz hingewiesen. Sie sind alle drei nicht nur große Künstler gewesen, einmalig profilierte Persönlichkeiten, mit der Begabung, ihre Einmaligkeit in gültige Gestalt zu fassen, sondern sie waren alle drei auch Großmeister ihres Handwerks. Was ihre Werke noch uns so ergreifend lebendig macht, ist ja vor allem aber doch nicht nur das Persönliche, ist ja nicht nur der barocke Affekt der Tonsprache Händels, ist ja nicht nur die erdnahe Einfachheit und schlackenlose Menschlichkeit der Musik Joseph Haydns, ist ja nicht nur die nervös empfindsame Subtilität der Klangkunst Felix Mendelssohns. Es ist auch die nahtlose Vollendung tönender Architekturen, welche die bannende Voraus-
setzung schafft, die Inhalte zu erhören. Händel hat in seinem Schaffen eine Universalität erwiesen, wie sie neben ihm nur sein Zeitgenosse Joh. Seb, Bach gewonnen hat. Händels Ton-., spräche ist extensiv und dekorativ, weltoffen und monumental in der Gebärde, wie Bachs Tonsprache vergrübelt und verinnerlicht, transzendental und monumental im Geiste ist. Beiden gemeinsam aber ist die Intensität der Aussage und der Triumph bis ins letzte vollendet ausgeformter Gestalt. Fast unvorstellbar der geistige Reichtum einer Zeit, die zwei solche Mächte nebeneinander wie selbstverständlich ertragen hat.
Auf einer neuen Ebene gesellschaftlicher Voraussetzung hat Haydns Tonsprache gleiche Universalität erreicht. Sie erwächst aus der Begegnung eines empfindsamen Herzens mit den jungen Kräften einer aus Krisen und Erschütterungen sich emporringenden Umwelt. Ihr fehlt die revolutionäre Dämonie des jungen Beethoven und ihr fehlt das abgründig hintergründige Leid, aus dem die todesnahe Anmut Mozartscher Musik erwächst. Die natürliche Menschlichkeit und Einfachheit, die Erdnähe des zur Aussage höchster Humanität bestimmten Kleinbauernsohnes, hat den Wesenswert des Werkes bestimmt. Gegenüber Händel und Mendelssohn bietet ja Haydn das soziologische
Phänomen des aus sozialer Tiefe emporsteigenden schaffenden Künstlers. Sein Weg zur Vollendung ist sicher der längste und schwerste gewesen, und gleichermaßen die arglose Helle seines tief menschlichen Temperaments wie die Zähigkeit des Bauernsamens, dem es entsprang, haben ihn diesen Weg gehen lassen.
Anders ist das Schaffen Mendelssohns bestimmt. Es hat nicht die Universalität des Werks Händels und Haydns, es ist nicht so einmalig bedeutend im Verlauf der Musikgeschichte, aber in ihm mischen sich Empfindsamkeit und inspirierte Freude der Aussage mit dem intellektuell beschatteten Distanzgefühl des Romantikers dem Phänomen des Lebens gegenüber. Und weil diese romantische Grundstellung in ihm viel stärker neben der impulsiven Naivität des Formungsbedürfnisses ausgebildet ist als etwa bei Carl Maria v. Weber, gewinnt seine Musik ihre einzigartige Qualität: Das Landschaftliche an ihr, ihre feenhafte Beweglichkeit sind immer wieder überschattet von schmerzlicher Resignation des intellektuell gebundenen Städters, und die Haltung der Gebildeten und Wissenden läßt den Ansturm des Gefühls in die kühle Glätte gemeisterter Form binden.
Aber all dies ist nur möglich auf Grund einer Beherrschung des Stoffes, der geformt wird, einer Klarheit der Vorstellung von den Notwendigkeiten des Gestaltens, die eben höchste Meisterschaft bedingen. Schlecht konstruierte Musik kann einstürzen wie ein schlecht kon struiertes Haus. Wenn wir schon rückschauen und gedenken, dann sollten wir an der Haltbarkeit des Werkes der vergangenen Großen die Richtigkeit dieses Satzes erkennen in einer Zeit, die einerseits die kompliziertesten Voraussetzungen hinsichtlich des Schaffensmaterials ihre Menschen ersinnen ließ und sich anderseits mit einer oft unbeschreiblich primitiven Dürftigkeit der Faktur auch in schwierigsten Techniken, deren mißverstandene Grundsätze sich ein Stümpertum als anspruchsvolle Attrappe vorhält, zu begnügen bereit scheint. Gepfuschte Architekturen aber sind nicht haltbar, schon rieselt’s im Gemäuer, und sehr vieles wird stürzen, was sich großartig gebärdet, ehe der Tag um ist.
In dem Zufall, daß in ein Jahr das Gedenken an drei Großmeister der Musik fällt, deren Leben voneinander je um ein Halbjahrhundert geschieden sind und deren Lebenswerke jeweils Markierungspunkte einer gewaltigen Straße großartiger Landschaften und grandioser Fernblicke abendländischer Kultur bedeuten, offenbart sich jene Gesetzlichkeit des Werdens und Lebens der Kultur, deren Träger ihre schöpferischen Kräfte sind. Dieses Gesetz ist als Ganzes undurchschaubar und undeutbar. Es ist unheimlich dem Lebenden, weil es in seinen Maßen die Maße der Generationen überschreitet. Immer wieder glaubten die Lebenden, am Ende der Bindungen zu stehen, die es dem Geschehen als ordnende Macht auferlegt, immer schauderten sie vor diesem Ende als vor dem Chaos, und immer noch dauert das Gesetz. In der Beglückung seines Dauerns liegt etwas wie Hohn für den kleinen Menschengeist, der diese Dauer ebenso will, wie er an sie zu glauben nicht vermag. Durch Jahrhunderte geht die Klage über das Ende der Musik, über das Finis musicae, ein Joh. Jos. Fux stimmte sie an und vor ihm schon andere, ein Joh. Seb. Bach kämpfte mit Verzweiflung um Werte der Gestalt, für die er das Verständnis bei seinen Zeitgenossen schwinden fühlte, und versank schon in der Generation, der seine Söhne angehörten, in Vergessenheit, ein Grillparzer behauptete von Beethoven, daß sein Weg ins Niemandsland führe, und sah an der Musik des jungen Carl Maria v. Weber das Stigma des Chaotischen und Unsittlichen, und ein Hans Pfitzner wähnte gut hundert Jahre später mit dem Ende der Romantik das Ende der Musik und das Ende des Abendlandes gekommen.
Aber Joh. Seb. Bach ist in der ehrfürchtigen Rückschau der dritten Generation nach seinem Tode wiedergefunden worden, Felix Mendelssohn war der Pionier, dessen romantisches Fernweh über die Zeit hin den Großen und sein Werk wieder erschloß, und seiner Wirkung seither ist kein Ende. Beethoven ließ sich noch auf dem Sterbebette das Studium der ersten Bände der Gesamtausgabe der Werke Händels eine wesentliche Angelegenheit sein, und der Wunsch selbstbewußter junger Bürgerschaft, die Chorwerke J. Haydns allerorten zu musizieren, war der Anlaß der Gesellschaftsgründungen, denen wir in Oesterreich ebenso den Musikverein für Steiermark, wie die Wiener Philharmoniker und die Musikakademie, die Konservatorien, die großen Chorvereinigungen und das musikalische Selbstbewußtsein der Nation verdanken.
Alles, was wir seither an Katastrophalem geschichtlichen Irrwegs erlebt haben, hat aber eher dazu beigetragen, uns Heutige gleichmütiger zu machen und uns die Einsicht zu lehren, daß eine Epoche der Geschichte nicht gleichzusetzen sei mit der Geschichte selbst. Wenn auch die glanzvolle Epoche, die etwa zu Lebzeiten Händels begann und mit den Katastrophen, die ein Hans Pfitzner als alter Mann erleben mußte, im Wesen zu Ende gegangen sein mag und in der die Todestage der Meister Händel (1759), Haydn (1809) und der Geburtstag Mendelssohns (1809) Marksteine der Musik bedeuten, Wesentliches umfaßt, was wir uns an Traditionswerten des Gestalthaften und Geistigen vorzustellen vermögen, so ist doch deshalb das Werden und das Leben nicht zu Ende.
Deshalb sei die Mahnung gestattet, im G e- denken des Lebens nicht zu vergessen und in der Rückschau nicht des Mögliche?! der Zukunft. Wir sollten uns am Ende dieses Jahres überall dort, wo wir jetzt im ernsten Gedenken verweilen und in Ehrfurcht und Liebe das große Leben in den Gestaltungen der vergangenen Meister fühlen, versammeln zum tatfrohen Fest der Lebenden, zur gewissenhaften Auseinandersetzung aus aufgeschlossenem Geist mit Neuem, mit Gegenwärtigem und Kommendem. Denn das glaube ich als eine der Normen des großen Gesetzes, nach welchem sich geistiges und gestalterisches Leben vollzieht, erkannt zu haben neben so vielem, was unerkennbar und undeutbar ist: Nur solange wir selbst unser Leben gestaltend leben, vermag das Werk der Vergangenen lebendig zu dauern. Wenn wir erst unser Unvermögen eingestünden, ihnen nachzufolgen, wenn uns erst die Fähigkeit verlorenginge, im Leben zu gestalten und aus unserem Leben Gestaltetes zu empfangen, dann verlören wir damit die Fähigkeit des Lebens anders als in trockenen Oekonomien des ameisenhaft Zweckmäßigen überhaupt. Wenn w i r es nicht mehr könnten, dann könnte n i e- m a n d die Frage auf halten, warum es jene konnten und was für einen Sinn es hatte, daß sie es konnten. Echte, durch Wollen und Können bestimmte Kunst ist unteilbar; so befremdlich von der Nähe aus empfangen manches an ihr sein mag, es ist, aus genügender Distanz gesehen, kein Fremdkörper in ihr. Kunst sollte — und auch dies auszusprechen scheint mir ein Gedenken an große Künstler der geeignete Anlaß — in ihren inneren Bereichen vor allzu großer Neugier der Wissenschaft und vor allzu unverfrorenen Zugriffen des Vorurteils bewahrt bleiben. Eine umfassende, ökonomisch rational faßbare Sinngebung für Kunst gibt es nicht, und jeder Versuch, Kunst in eine solche einzuordnen, reißt ein Stück aus ihrem Wesen und verzerrt ihren Geist. Sie ist nicht zu etwas da. Sie ist da, und weil sie da ist, ist menschliches Leben menschlich. Gerade wir, die so viel an Gewalt am Geist erlebt haben und erleben, sollten es wissen und sollten daraus lernen.