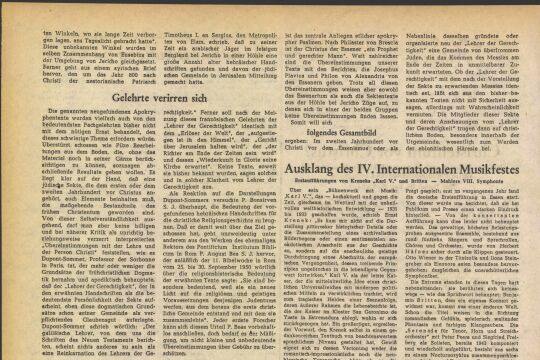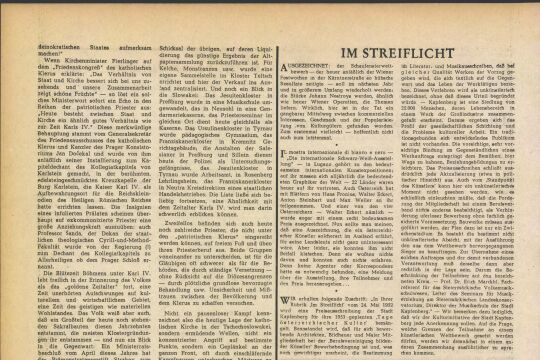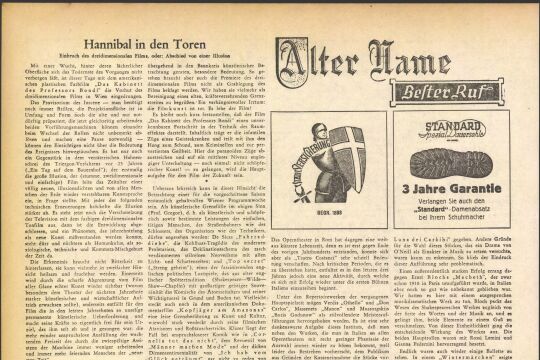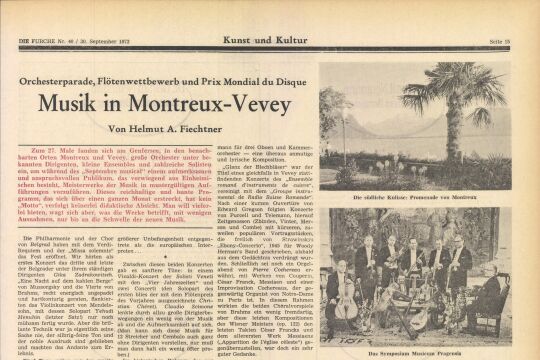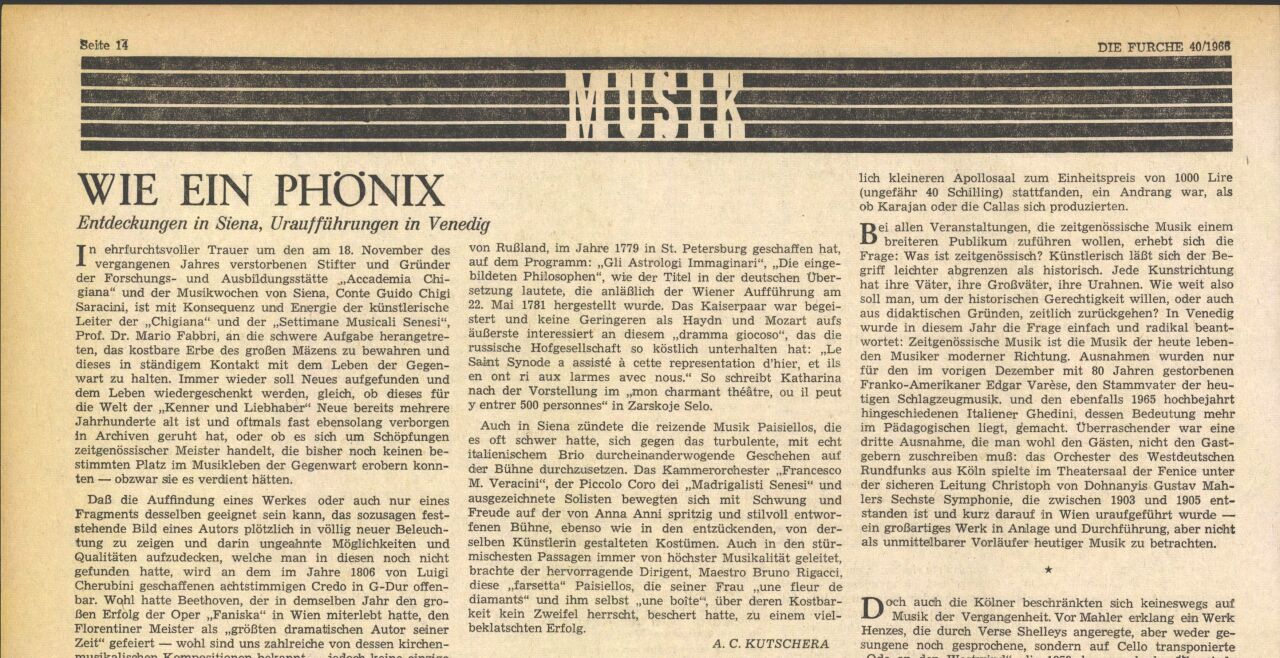
In ehrfurchtsvoller Trauer um den am 18. November des vergangenen Jahres verstorbenen Stifter und Gründer der Forschungs- und Ausbildungsstätte „Accademia Chi- giana“ und der Musikwochen von Siena, Conte Guido Chigi Saracini, ist mit Konsequenz und Energie der künstlerische Leiter der „Chigiana“ und der „Settimane Musicali Senesi“, Prof. Dr. Mario Fabbri, an die schwere Aufgabe herangetreten, das kostbare Erbe des großen Mäzens zu bewahren und dieses in ständigem Kontakt mit dem Leben der Gegenwart zu halten. Immer wieder soll Neues aufgefunden und dem Leben wiedergeschenkt werden, gleich, ob dieses für die Welt der „Kenner und Liebhaber“ Neue bereits mehrere Jahrhunderte alt ist und oftmals fast ebensolang verborgen in Archiven geruht hat, oder ob es sich um Schöpfungen zeitgenössischer Meister handelt, die bisher noch keinen bestimmten Platz im Musikleben der Gegenwart erobern konnten — obzwar säe es verdient hätten.
Daß die Auffindung eines Werkes oder auch nur eines Fragments desselben geeignet sein kann, das sozusagen feststehende Bild eines Autors plötzlich in völlig neuer Beleuchtung zu zeigen und darin ungeahnte Möglichkeiten und Qualitäten aufzudecken, welche man in diesen noch nicht gefunden hatte, wird an dem im Jahre 1806 von Luigi Cherubini geschaffenen achtstimmigen Credo in G-Dur offenbar. Wohl hatte Beethoven, der in demselben Jahr den großen Erfolg der Oper „Faniska“ in Wien miterlebt hatte, den Florentiner Meister als „größten dramatischen Autor seiner Zeit“ gefeiert — wohl sind uns zahlreiche von dessen kirchenmusikalischen Kompositionen bekannt — jedoch keine einzige erreicht den großartigen Aufbau, die Tiefe und hinreißende Kraft dieses Credo, das von dem „Complesso Polifonico Vocale della Radio-Televisione Italiana“ unter der Leitung von Nino Antonellini eine hervorragende und auch für Italien erstmalige Aufführung erlebte. Außer den beiden konzertanten Wiedergaben im Berliner Dom in den Jahren 1855 und 1873 sind uns keine weiteren Daten bekannt, wohl aber das Urteil der „Niederrheinischen Musik Zeitung“ über dieses einzigartige Fragment einer wohl nie vollendeten „Missa cantata“: „Cherubinis Credo gehört zu den größten Schöpfungen auf dem Gebiet der reinen Vokalmusik.“
Daß in dieser, der 23. „Settimana Musdcale Senese“, Ferruccio Busoni an erster Stelle stand, war bereits bei der feierlichen Eröffnung derselben damit dokumentiert, daß der traditionelle Vortrag, der dieses Musikfest von Siena einleitet, der außerordentlichen Persönlichkeit galt, deren 100. Geburtstag auch in seinem Geburtsort, dem benachbarten Empoli, feierlich begangen wurde. Professor Luigi Rognoni, Ordinarius für Musikgeschichte an der Universität von Palermo, hat ein lebendiges Bild des als Theoretiker, ausübender Künstler und Virtuose, Pädagoge und, was wohl das Wesentlichste an dieser faszinierenden, an Liszt gemahnenden Erscheinung ist, als Bahnbrecher neuer Formen auf neuen Wegen noch viel zu wenig gewürdigten toskanischen Meisters vorgeführt, das ein Konzert mit Werke Busonis ergänzen sollte.
Im Bewußtsein der breiteren Schichten des musikliebenden und musikverständigen Publikums lebt Ferruccio Busoni als „Patron“ eines vielumkämpften Preises für junge Pianisten, vorwiegend aber durch seine berühmten Transkriptionen der Orgelwerke von J. S. Bach, an denen kein Klavierschüler höherer Stufen Vorbeigehen darf. Merkwürdigerweise wurde ein so wichtiges Moment, welches den Weltruf dieser unendlich vielseitigen Künstlerpersönlichkeit begründet hat, nicht sonderlich beachtet; es wurde vielmehr Wert darauf gelegt, eine Auswahl seiner auch in Italien kaum bekannten Originalkompositionen zu bieten. Es waren diese das Violinkonzert op. 35 in D-Dur, entstanden in den Jahren 1896/97, dem Franco Gulli seine stupende Virtuosität lieh, ferner die hauchzarte „Berceuse elegiaque“ op. 42 für Orchester (1910), der „Tanzwalzer“ op. 53, 1920 „in memoria di J. Strauss“ ebenfalls für Orchester allein geschrieben und die „Indianische Phantasie“' für Klavier und Orchester (op. 44) aus dem Jahre 1913. Mit feinster Differenzierung phantasierte Pietro Scarpini die „Fantasia“, ließ das Klavier die „Canzone“ singen und im „Finale“ ein wahres Feuerwerk abbrennen, das man unwillkürlich, aber unabweislich, als den Göttern gestohlen empfinden mußte. Im „Tanzwalzer“ hingegen geisterte inmitten anderer Aspekte und Akzente immer wieder Johann Strauß — und da weiß man, was Götter schenken können!
Hatte Rognoni in seiner sehr ausführlichen und gründlichen Untersuchung über das Phänomen Busoni den deutschen Einfluß, der seiner Meinung nach dessen Werk in hohem Maße bestimmte, besonders hervorgehoben, so war diese Auswahl eher dazu geeignet, Anklänge sowohl an
Satie, Debussy und Ravel als auch an den Formen- und
Melodienschatz des östlichen Europa zu erspüren; trotzdem erschien jedoch die These der Festredner von Empoli, G. M. Gatti und P. Rattolini, erhärtet, in welcher die Betonung auf der absoluten Eigenständigkeit der Musik Busonis lag, den Wladimir Vogel als echten Humanisten erkannt und damit wohl den richtigen Schlüssel zu dessen Wesen und
Wert gefunden hat. Piero Bellugi an der Spitze des, wie immer, brillant musizierenden Orchesters des „Maggio Musi- cale Fiorentino“, war mit Liebe und Sorgfalt bemüht, den Komponisten Busoni neben den Propheten der künftigen Entwicklungen, die das 20. Jahrhundert beherrschen, zu stellen, als welcher der Meister aus Empoli bereits in die Musikgeschichte eingegangen ist.
Die Reihe der Konzerte, welche viel Interessantes als Ur-, Erst- und Wiederaufführung und immer in erstklassiger Besetzung brachte, wurde mit der bereits zur Tradition gewordenen „Serata Operistica“ beschlossen. Diesmal stand Giovanni Paisiellos Opera Buffa, welche der Meister aus Taranto, seit 1776 im Dienste der Kaiserin Katharina II.
von Rußland, im Jahre 1779 in St. Petersburg geschaffen hat, auf dem Programm: „Gli Astrologi Immaginari“, „Die eingebildeten Philosophen“, wie der Titel in der deutschen Übersetzung lautete, die anläßlich der Wiener Aufführung am 22. Mai 1781 hergestellt wurde. Das Kaiserpaar war begeistert und keine Geringeren als Haydn und Mozart aufs äußerste interessiert an diesem „dramma giocoso“, das die russische Hofgesellschaft so köstlich unterhalten hat: „Le Saint Synode a assistė ä cette representation d’hier, et ils en ont ri aux larmes avec nous.“ So schreibt Katharina nach der Vorstellung im „mon charmant theatre, ou il peut y entrer 500 personnes“ in Zarskoje Selo.
Auch in Siena zündete die reizende Musik Paisiellos, die es oft schwer hatte, sich gegen das turbulente, mit echt italienischem Brio durcheinanderwogende Geschehen auf der Bühne durchzusetzen. Das Kammerorchester „Francesco M. Veracini“, der Piccolo Coro dei „Madrigalisti Senesi“ und ausgezeichnete Solisten bewegten sich mit Schwung und Freude auf der von Anna Anni spritzig und stilvoll entworfenen Bühne, ebenso wie in den entzückenden, von derselben Künstlerin gestalteten Kostümen. Auch in den stürmischesten Passagen immer von höchster Musikalität geleitet, brachte der hervorragende Dirigent, Maestro Bruno Rigacci, diese „farsetta“ Paisiellos, die seiner Frau „une fleur de diamants“ und ihm selbst „une boite“', über deren Kostbarkeit kein Zweifel herrscht, beschert hatte, zü einem vielbeklatschten Erfolg.
Nach Jahren der Krise, die das schon zur Institution gewordene Internationale Festival der Zeitgenössischen Musik in Venedig ernsthaft zu bedrohen schien, hat sich der Phönix, das Wahrzeichen der venezianischen Musik, zu einem neuen Höhenflug erhoben. Das XXIX. Herbstfestival, das in dem unvergleichlich schönen Teatro La Fenice vonstatten ging, reihte sich in bester Form den anderen großen Musikfestspielen dieser Sommersaison an. Gerade weil die aufs Klassische und Romantische gerichteten Festspiele in Edinburgh und Salzburg immer mehr mit einem festen Repertoire arbeiten, dem nur in bescheidenem Umfang etwas Neues und noch seltener etwas Zeitgenössisches hinzugefügt wird, weil man dort Neuinszenierungen von Werken berühmter Komponisten dem Experiment heutiger Kunst vorzieht, ist es erfor derlich, daß auch dieses einen Rahmen findet, der über die engeren Veranstaltungen für Berufsmusiker, wie Donau- eschingen, hinausgeht.
Daß in solch einem Festival nicht nur Meisterwerke vorgeführt werden, daß in manchen Sektoren sogar die Nieten die bleibenden Gewinne übersteigen, ist nicht verwunderlich. Ebensowenig kann man erwarten, daß in einem fünftrangigen, mehr als 2000 Personen fassenden Theatersaal allabendlich jeder Platz besetzt ist, zumal die Organisatoren des Festivals an den Mammutpreisen der italienischen Operntheater festhalten. Immerhin ist es ermutigend, daß zu den Kammermusikkonzerten, die am Vor- oder Nachmittag in dem wesent lich kleineren Apollosaal zum Einheitspreis von 1000 Lire (ungefähr 40 Schilling) stattfanden, ein Andrang war, als ob Karajan oder die Callas sich produzierten.
Bei allen Veranstaltungen, die zeitgenössische Musik einem breiteren Publikum zuführen wollen, erhebt sich die Frage: Was ist zeitgenössisch? Künstlerisch läßt sich der Begriff leichter abgrenzen als historisch. Jede Kunstrichtung hat ihre Väter, ihre Großväter, ihre Urahnen. Wie weit also soll man, um der historischen Gerechtigkeit willen, oder auch aus didaktischen Gründen, zeitlich zurückgehen? In Venedig wurde in diesem Jahr die Frage einfach und radikal beantwortet: Zeitgenössische Musik ist die Musik der heute lebenden Musiker moderner Richtung. Ausnahmen wurden nur für den im vorigen Dezember mit 80 Jahren gestorbenen Franko-Amerikaner Edgar Varėse, den Stammvater der heutigen Schlagzeugmusik, und den ebenfalls 1965 hochbejahrt hingeschiedenen Italiener Ghedini, dessen Bedeutung mehr im Pädagogischen liegt, gemacht. Überraschender war eine dritte Ausnahme, die man wohl den Gästen, nicht den Gastgebern zuschreiben muß: das Orchester des Westdeutschen Rundfunks aus Köln spielte im Theatersaal der Fenice unter der sicheren Leitung Christoph von Dohnanyis Gustav Mahlers Sechste Symphonie, die zwischen 1903 und 1905 entstanden ist und kurz darauf in Wien uraufgeführt wurde — ein großartiges Werk in Anlage und Durchführung, aber nicht als unmittelbarer Vorläufer heutiger Musik zu betrachten.
Doch auch die Kölner beschränkten sich keineswegs auf Musik der Vergangenheit. Vor Mahler erklang ein Werk Henzes, die durch Verse Shelleys angeregte, aber weder gesungene noch gesprochene, sondern auf Cello transponierte „Ode an den Westwind“, die 1953, kurz nach der Übersiedlung des Komponisten nach Italien entstanden ist. Mehr Beachtung noch fand ein Auftragswerk des Westdeutschen Rundfunks an den dreiunddreißigjährigen polnischen Komponisten Krzysztof Penderecki: die „Passion nach dem Lukas- Evangelium“, ein kühnes, wedtausholendes Chorwerk, ohne geschlossene Choräle im Bach-Stil. Aber Penderecki, der als Kompositionslehrer an der Krakauer Hochschule für Musik tätig ist, erweist dem Thomas-Kantor seine Reverenz, indem er, was schon etliche Vorgänger getan haben, die vier Notenbezeichnungen B, A, C, H als Hauptthema verwendet. Das abendfüllendes Werk, unter der Leitung des polnischen Dirigenten Henryk Czyz und Mitwirkung polnischer Solisten in der Kirche San Giorgio Maggiore, hinterließ einen tiefen Eindruck und beschloß vorwärtsschauend die Dekade zeitgenössischer Tonkunst.
An künstlerischem Gehalt und Ernst ließ sich damit nur ein ideologisch ganz anders gerichtetes Opus des zweiund- vierzigjährigen Venezianers Luigi Nono vergleichen, das den portugiesischen Titel führt: „A floresta ė jovem e cheia de vida“ („Der Wald ist jung und voll Leben“), aber alles andere als ein lyrisches Waldieben sein will. Es beginnt mit den Worten: „Wie Marx sagte, stehen wir in der Vorgeschichte.“ In sechs Sprachen wird, auf einen Text des Mailänders Giovanni Pirelli, der Vietnamkrieg mit allen seinen Greueln beschrieben. Wo die menschliche Stimme nicht mehr ausreicht, die Schrecken des Krieges wiederzugeben, kommt eine umfangreiche elektronische Apparatur zu Hilfe. Das dreiviertelstundenlange Werk mündet in einem Bombardement der Städte, einer Apokalypse zeitgenössischen Grauens.
Neben diesen Monumentalwerken nahmen sich die beiden Opern, die bei diesem Festival uraufgeführt wurden, etwas schmächtig aus. Das letzte Bühnenwerk des vierund- achtzigjährigen Gian Francesco Malipierö, „Le Metamorfosi di Bonaventūra“, ist eine ziemlich konventionelle Veroperung der 1804 in Deutschland erschienenen „Nachtwachen des Bonaventūra“, deren Urheberschaft noch immer nicht ganz klargestellt ist. Malipierö, der langjährige Leiter des venezianischen Konservatoriums, gilt gegenwärtig als der „grand old man“ der italienischen Musik. Seine Bemühungen um die Verbannung des Verismus waren wohl auch mehr als die künstlerischen Qualitäten der düsteren, in Goya-Farben gehaltenen musikalischen Nachtstücke, der Grund, daß man sie in Venedig als repräsentatives Werk der modernen Oper zu Gehör brachte. Mehr Beifall als die Musik fand die in expressionistischer Tradition gehaltene Inszenierung Adolf Rotts und die Bühnenausstattung von Fritz Butz.
Weit unter Malipieros Nachtwächter-Oper stand jedoch die zweite Uraufführung: die musikalische Farce „Tutti la vogliono“ („Alle begehren sie“) von Angelo Paccagnini, die das Ensemble der Prager Kammeroper in Venedig zum besten gab. Schwer zu sagen, was dilettantischer war, der Text und die Musik Paccagninis, die eine Satire auf das faschistische Regime sein sollten, oder die Interpretation im Stil von Kunstgewerbesälen der zwanziger Jahre. Ein kleiner Skandal, der von der Galerie her von einigen Neofaschisten vorbereitet war, wurde von der Polizei im Keim erstickt, so daß selbst auf diese Weise kein Sensationserfolg zu erzielen war.
Die Fülle der Instrumentalmusik, an der außer dem eigenen Orchester des Fenice und den Kölnern das hervorragende Römische Symphonieorchester des Italienischen Rundfunks und Fernsehens teilhatte, gab einen guten Überblick über die bei den zeitgenössischen Autoren vorherrschenden Tendenzen. Die Vorliebe für die Zwölftonmusik gehört, namentlich in Italien, nun schon den Sechzigjährigen, mit Petrassi und Dallapiccola als Protagonisten. Für die Jüngeren ist die Dodekaphonie eine Selbstverständlichkeit, die sie auf den Konservatorien erlernen, aber immer häufiger abstreifen, um sich der elektronischen Musik zu widmen. Freilich sind deren Fortschritte recht spärlich, und gerade die begabtesten unter den früheren Elektronikern, wie Stockhausen und Berio, ziehen es vor, Wirkungen der elektronischen Technik durch konventionelle Instrumente, vor allem auch durch die menschliche Stimme, zu imitieren, wofür in Venedig eine darauf spezialisierte außerordentliche Koloratursängerin, Cathy Berberian, zur Verfügung stand. Es ist nicht das erstemal, daß solche Umwege in der Kunst gemacht werden. Schon gegen Ende des vorigen Jahrhunderts prägte Oscar Wilde das Bonmot: „Die Natur ahmt die Kunst nach.“
RICHARD LEWINSOHN