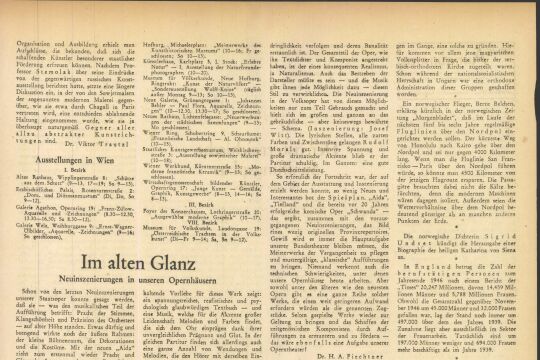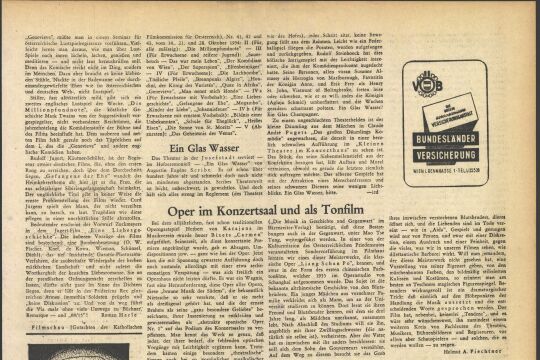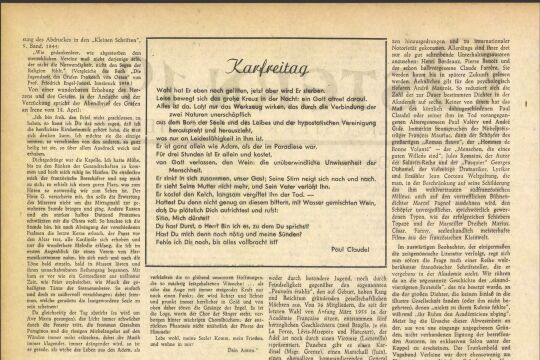Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Eine Pariser Operawoche
„Von außen Gare d’Orlėans, von innen bain turque“, so hat Debussy das mächtige, auf einem Areal von
11.000 Quadratmetern am Schnittpunkt von fünf Avenuen liegende Prunkgebäude beschrieben. Aber das größte Opernhaus der Welt ist nicht nur durch die Inschrift „Academie Nationale de Musique et de Danse“ kenntlich gemacht. Heute wissen wir auch seinen Stil und seine Besonderheit zu schätzen. Es wurde in den Jahren 1862 bis 1875 von Charles Garnier erbaut, der im Auftrag Napoleons III. und der Kaiserin Eugėnie das prunkvollste Theater, das man je gesehen hat, zu errichten hatte und dem hierfür unbeschränkte Mittel und Arbeitskräfte zur Verfügung standen. Während des Krieges 1870/71 wurde der Bau eingestellt, unter der Kommune wiederaufgenommen und schließlich von Marschall Mac Mahon, dem ersten Präsidenten der Dritten Republik, eingeweiht. Die Tradition des Hauses geht auf die 1669 gegründete „Aca- dėmile Royale“ zurück, der die „Academie Imperiale“ folgte, die schließlich von der „Academie Nationale“ abgelöst wurde.
Die Pariser Oper war immer ein Hof- und Repräsentationstheater. Sie ist es auch heute noch, obwohl es, wie schon vor zehn Jahren der Historiker Pierre Gaxotte von der Akademie der 40 Unsterblichen erklärte, keinen Hof mehr gibt und auch keine „gute Gesellschaft“, die den Hof ersetzen könnte Die von Crapeaux geschmückte Prunkfassade mit dem 69 Meter hohen Giebel, der „Notre-Dame“ überragt, die majestätische zehn Mieter breite Freitreppe, das von Paul Baudry gestaltete „Große Foyier“ mdit seinen Malereien und Skulpturen, Kaminen und Karyatiden, erstrahlend in Gold und Kristall, schließlich der ungeheure fünfstöckige Zuschauerraum in Rot und Gold: dias alias i’sit Ausdruck der Prunkliebe des Seconde Empire und wirkt wie von Meyerbeer inszeniert.
Der Riesensaal bietet nur 2158 Personen Platz (gegenüber 2209 der wesentlich kleineren Wiener Staatsoper). Die Raumverschwendung ist ohne Beispiel und Nachfolge. Die Pariser Oper war eben vor allem ein gesellschaftlicher Treffpunkt der oberen Zweitausend. Aus der Blütezeit jener Gesellschaft stammt die Schilderung eines Galaabends, die Marcel Proust in der „Welt der Guermantes“ gegeben hat. Die Abonnenten, die Menschen der großen Welt, „schweben in ihren Logen hinter dem in Stufen aufsteigenden ersten Rang wie in kleinen hängenden Salons, von denen nur die Vorderwand weggenommen scheint“, und die Logen der oberen Ränge wirken „wie riesige mit menschlicher Flora bestandene Körbe, die durch die roten Bänder der mit Plüsch verkleideten Zwischenwände an die Wölbung des Zuschauerraumes angeheftet sind“.
Für ein konservatives Publikum und die Fremden während der Saison wird gespielt. Nach ihnen richtet sich der Spielplan und der Inszenierungsstil. Ein jugendliches Stammpublikum gibt es kaum, jedenfalls fällt es nicht ins Gewicht. Das wird sich vielleicht schon in den nächsten Jahren ändern. Doch hierüber später.
Am ersten Abend gab’s ein fröhliches Wiedersehen mit der überaus natürlichen, quicklebendigen und temperamentvoll-dynamischen „Carmen“ -Inszenierung von Raymond Rouleau, die schon mehr als zehn Jahre alt ist und sich glänzend konserviert hat. Auch die realistischen Bühnenbilder Lilo de Nobilis wirken keineswegs verstaubt. Statt der krähenden Knabenstimmen hört man im ersten Akt einen anmutigen Mäd- ohenohor, Pferdefuhrwerke, Lastesel und einzelne Rösser traben über die Bühne, Carmen wird mit einem langen Strick an einen Tischfuß gebunden, kurzum: es gibt stets etwas zu sehen und zu bestaunen; im ganzen: ein wohlgelungenes Spektakel. Carmen ist Lyene Dourian, die mehr als Sängerin denn als Darstellerin überzeugt. Das gleiche gilt von Paul Finel als Don Jose. Bei Jean-Pierre L aff age als Escamillo ist es umgekehrt. Die schönste Stimme des Ensembles besitzt Andrėe Esposito, der wir in „Mireille“ noch einmal begegnen werden. — Das Orchester unter Louis Fourestier spielt korrekt, ohne besonderen Einsatz.
Die in französischer Sprache gesungene „Traviata“ erfreute durch gleichmäßig gute Besetzung aller Hauptpartien, angeführt von Monique de Pondeau, Andrė Turp, Louis Quilico und anderen. Die Inszenierung von Max de Rieux leidet unter den unmöglichen, einem falschen Modernismus huldigenden Dekorationen eines auf dem Programmzettel nicht vermerkten Nichtkünstlers. Ständig werden irgendwelche die Wände ersetzende
Vorhänge heruntergelassen oder hinaufgezogen, deren Farben grell und unharmonisch sind. Die Kostüme wirken konventionell, in der Ausführung eher dürftig. Dagegen brilliert das Orchester unter Robert Benedetti durch Wohllaut, Dezenz und Akkuratesse, wodurch besonders die Streicherpassagen dieser intimsten und nobelsten Partitur Verdis zu Kostbarkeiten werden.
Auf dem Programm der „Opera comique“ steht am nächsten Tag
„Mireille“ von Gounod, und zwar als 1050. Aufführung in diesem Haus. Hier gilt es, für den Zugereisten eine Bildungslücke zu schließen, zumal es sich um ein nationales Lieblingswerk der Franzosen handelt. Diese Wertschätzung besteht zu Recht, wenn man die Kriterien einer echten Volksoper gelten läßt. Indem er Michel Carres Libretto nach Frederic Mistrals Poem vertonte, fand Gounod Gelegenheit, sein schönes Talent voll zu entfalten, ohne auch nur für Sekunden dessen Grenzen zu überschreiten. Der einfachen Geschichte (unglückliche Liebe zwischen einem Burschen aus armem zu einem Mädchen aus reichem Haus) entspricht die reizvolle, zart-sentimentale Musik, deren Partitur man das Prädikat „meisterhaft“ ohne Zögern zuerkennt. Trotz beachtlicher männlicher Partner (Mallabrera, Julien Haas, Basset und anderen) ist die Mile. Esposito als Titelheldin die wirkliche Heldin des Abends. — Die schönen und harmonischen Bühnenbilder von Gabriel Couret, den pro- venzalischen Schauplätzen der Handlung naturgetreu nachgebildet, mögen bei der Premiere vor mehr als 100 Jahren nicht viel anders ausgesehen haben. Das Orchester, für das diese Musik offensichtlich das tägliche Brot ist, spielte unter Richard Blareau besonders klangschön.
Sämtliche Haupt- und Nebenrollen waren mit hauseigenen Kräften besetzt, weil Gäste nur ausnahmsweise engagiert werden dürfen. Da fast alle Sänger überdies Franzosen sind und ein sehr ähnliches Timbre haben, kommt ein überaus einheitlicher Gesamteindiruck zustande, als Kompensation für gelegentlich fehlende fulminante Höchstleistungen. Aber das scheint ganz nach dem Geschmack des Publikums zu sein, zumal ausschließlich in seiner eigenen Sprache gesungen wird.
Das Beste zum Schluß: Ein Ballettabend in der Großen Oper mit einer der schönsten Produktionen, die es gegenwärtig zu sehen gibt: „Daphnis et Chloė" von Ravel in der Chore- graphie George Skibines mit Dekorationen und Kostümen von Marc Chagall. Dieses Ballett wurde 1912 im Theatre du Chatelet von Diaghi- lews „Balletts Russes“ uraufgeführt, befindet sich seit 1921 im Repertoire der Pariser Oper und erhielt vor genau zehn Jahren durch Chagall eine traumhaft schöne Ausstattung. Christiane Vlasi und Attilio Labis sowie das gesamte Corps de ballet waren die Ausführenden; das Orchester und den in vier Proszeniumlogen untergebrachten großen Chor leitete Manuel Rosenthal.
„Zyklus“ nach Musik von Karlheinz Stockhausen für einen Schlagwerker (Silvio Gualda), von Michel Descombey für fünf Solisten und zehn weitere Tänzer choreographiert, wirkte darnach — nicht nur auf das konservative Pariser Ballett- Publikum — wie ein Schock: häßlich und jeder höheren künstlerischen Notwendigkeit entbehrend. Zum Ausklang und zur Versöhnung aller: Serge Lifars gelungenste
Choreographie „Suite en Blanc“ zu 5 er anmutigen, hispanisierenden Musik Lalos. Ein gutes Dutzend Solisten wäre hier zu nennen, doch seien nur die Interpreten des Adagios, Yvette Chauvirė und J. P. Bonr aefous hervorgehoben.
Während des Stockhausen-Balletts kam es zu recht sanften Protesten, und von den oberen Rängen wurden weiße Zettelchen gestreut, äuf denen gegen die Neuerungen von Monsieur Descombey Stellung ge nommen wird. Das bot Gelegenheit, wieder einmal den Blick zu dem von Chagall neu ausgemalten Deckengewölbe zu erheben. Natürlich kontrastiert es zum barbarischen Goldprunk des übrigen Interieurs, abei auf eine sehr reizvolle Weise und indem es den ganzen Raum gleichsam „aufhellt“, was besonders schön bei halber Beleuchtung geschieht. — Dieses neue Deckengemälde ist Symbol für eine versuchte Synthese zwischen alt und neu. Doch wird es bei dieser Verschönerung sein Bewenden nicht mehr lange haben. Man bereitet sich in Paris auf ein großes Experiment vor, an dessen Beginn ein Gutachten von Jean Vilar steht, der von Minister Malraux hierzu beauftragt wurde. — Das Unbehagen an der Administration und der Struktur seiner Oper beziehungsweise seiner beiden Opernhäuser, die mit 40 Millionen NF im Jahr subventioniert werden (was von den meisten Franzosen als zu hoch empfunden wird), hat auch Paris nicht verschont. Man will ein moderneres Repertoire, modernere Inszenierungen — und braucht hierfür besser ausgestattete Bühnen. Deren Technik ist angeblich so veraltet, daß die Erneuerung mindestens ein Tahr wahrscheinlich eineinhalb Jahre in Anspruch nehmen wird. Nachdem alle Verträge (routinemäßig) gekündigt wurden, wird man unter der alten Direktion — Auric, Chabaud, Bondeville, Germain — nur noch bis zum Ende dieser Saison spielen. Darnach sollen beide Häuser geschlossen werden. Was darnach kommen wird, weiß noch niemand. Allenfalls ein neues Regime. Vielleicht auch ein neues Publikum In Paris, vor allem aber im Ausland, hört man immer wieder die Namen Vilar- Bėjart-Boulez, die als Triumvirat zur Leitung der reformierten Pariser Oper berufen werden sollen. Aber von Fachleuten und Pariser Kritikern wird diese Kombination als „unrealistisch“ bezeichnet.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!