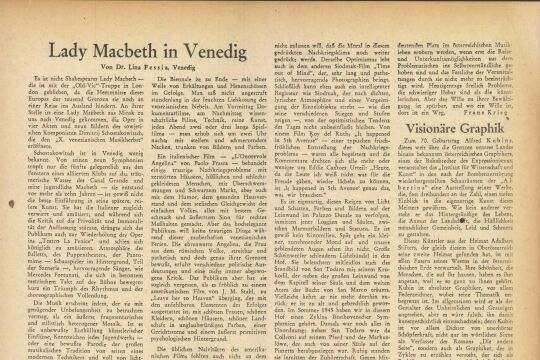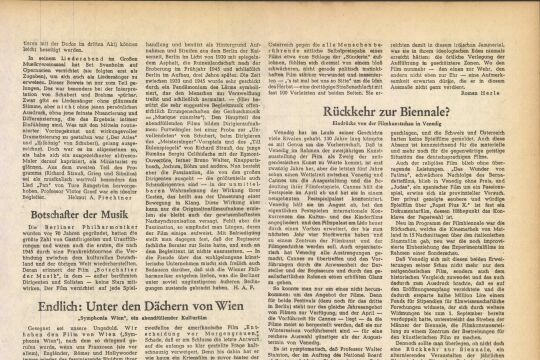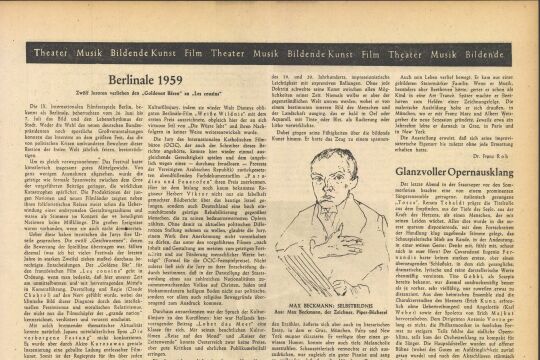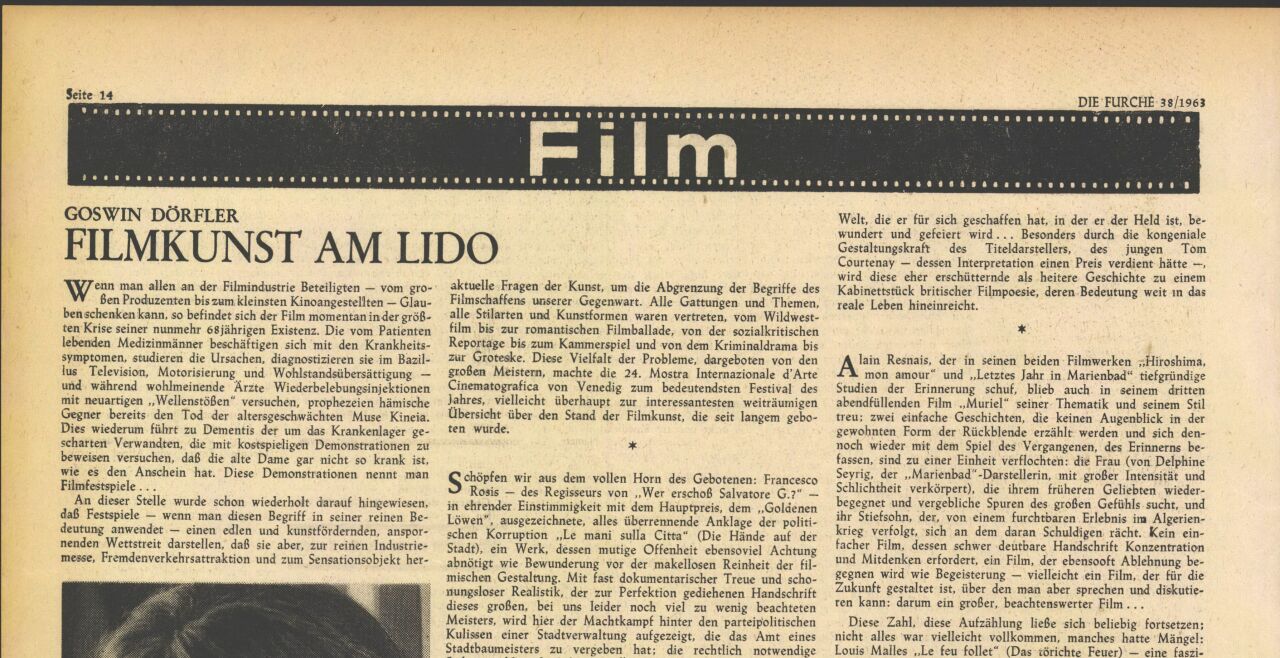
Wenn man allen an der Filmindustrie Beteiligten — vom großen Produzenten bis zum kleinsten Kinoangestellten — Glauben schenken kann, so befindet sich der Film momentan in der größten Krise seiner nunmehr 68jährigen Existenz. Die vom Patienten lebenden Medizinmänner beschäftigen sich mit den Krankheitssymptomen, studieren die Ursachen, diagnostizieren sie im Bazillus Television, Motorisierung und Wohlstandsübersättigung — und während wohlmeinende Ärzte Wiederbelebungsinjektionen mit neuartigen „Wellenstößen“ versuchen, prophezeien hämische Gegner bereits den Tod der altersgeschwächten Muse Kineia. Dies wiederum führt zu Dementis der um das Krankenlager gescharten Verwandten, die mit kostspieligen Demonstrationen zu beweisen versuchen, daß die alte Dame gar nicht so krank ist, wie es den Anschein hat. Diese Demonstrationen nennt man Filmfestspiele…
An dieser Stelle wurde schon wiederholt darauf hingewiesen, daß Festspiele — wenn man diesen Begriff in seiner reinen Bedeutung anwendet — einen edlen und kunstfördernden, anspornenden Wettstreit darstellen, daß sie aber, zur reinen Industriemesse, Fremdenverkehrsattraktion und zum Sensationsobjekt herabgewürdigt, weder ihren Zweck erfüllen, noch der guten Sache dienlich sind. Diese Feststellung steht besonders im Zusammenhang mit dem seit Jahren immer mehr und mehr auftretenden Zug eines Überangebotes an Filmfestivals, von dessen devisenbringender Wirksamkeit sich die landschaftlich reizvoll gelegenen oder politisch interessanten Kurorte und Hauptstädte und von deren umsatzfördernder, messeähnlicher Handelsbedeutung sich die Filmkaufleute viel versprechen. Das führte logischerweise weiter dazu, daß die rund 50, nunmehr alljährlich an den verschiedensten Punkten unserer Weltkugel abgehaltenen Filmmusterschauen mit ihren zahlreichen Preisen, deren Verleihung unumgänglich scheint, als Filmfestspiele abgewertet sind und nur noch die Bedeutung großer Rummelplätze besitzen.
Wer dieses Jahr an der Internationalen Filmkunstschau in Venedig teilnahm, konnte ein erstaunliches Phänomen beobachten, das wohl einzigartig in der Geschichte aller Filmfestspiele des letzten Jahrzehnts dasteht: Je weiter das Festival fortschritt, um so leerer wurde es auf der breiten, sonnenüberfluteten, vom goldgelben Badestrand des Lido begrenzten Prachtstraße. die sich von der flaggengeschmückten modernen Fassade des Palazzo de] Cinema zum pseudomaurischen Alptraum des Luxushotels Excelsior hinzieht. Wo noch im Vorjahr tagsüber Scharen von filmbegeisterten Zuschauern den in neuesten Strandmodellen gekleideten Stars auflauerten, Photoreporter und Kameramänner elegante und korpulent-bedeutsam aussehende Herren mit dicken Sonnenbrillen umdrängten, wo des Abends Karabinieri in Paradeuniform den Andrang der Neugierigen mühsam von den in gewagteste Abendtoiletten gekleideten Festgästen abschirmen mußten und gleißende Scheinwerferstraßen Wege der Ehrfurcht und Bewunderung zeichneten, da war es heuer fast ruhig und leer geworden. Die Eleganz war verschwunden, der Rummel fand nicht statt, die Atmosphäre war verändert: aus dem Spiel war Ernst geworden — und ernste Arbeit verträgt sich nicht mit Sensation und Oberflächlichkeit. Das Wort „Filmkunst“ war auf das Panier geschrieben, das die diesjährige Biennale der Kinematographie am Lido aufgesteckt hatte — und damit war auch jeder Geschäftsgeist geflohen, getreu dem bereits geflügelten Wort eines (ehrlichen) deutschen Verleihers, der den bezeichnenden Ausspruch tat: „Wenn ich beim Film das Wort Kunst höre, mache ich einen Bogen An die Stelle der Stars waren die Filmschöpfer getreten; man machte nicht mit Namen Reklame, die die Klatschspalten der Sensationspresse füllen, sondern man sprach von den Männern, die als Faktoren in das Buch der Filmgeschichte eingegangen sind: von Akira Kurosawa, von Alain Resnais, von Juan Antonio Bardem und von Renato Castellani. Von ihnen gab es keine pikanten Anekdoten zu erwarten und keine Skandal- geschichtchen; in den Pressekonferenzen und zufälligen oder herbeigeführten Gesprächen und Diskussionen ging es um brennende, aktuelle Fragen der Kunst, um die Abgrenzung der Begriffe des Filmschaffens unserer Gegenwart. Alle Gattungen und Themen, alle Stilarten und Kunstformen waren vertreten, vom Wildwestfilm bis zur romantischen Filmballade, von der sozialkritischen Reportage bis zum Kammerspiel und von dem Kriminaldrama bis zur Groteske. Diese Vielfalt der Probleme, dargeboten von den großen Meistern, machte die 24. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica von Venedig zum bedeutendsten Festival des Jahres, vielleicht überhaupt zur interessantesten weiträumigen Übersicht über den Stand der Filmkunst, die seit langem geboten wurde.
Schöpfen wir aus dem vollen Horn des Gebotenen: Francesco Rosis — des Regisseurs von „Wer erschoß Salvatore G.?“ — in ehrender Einstimmigkeit mit dem Hauptpreis, dem „Goldenen Löwen“, ausgezeichnete, alles überrennende Anklage der politischen Korruption „Le mani sulla Citta“ (Die Hände auf der Stadt), ein Werk, dessen mutige Offenheit ebensoviel Achtung abnötigt wie Bewunderung vor der makellosen Reinheit der filmischen Gestaltung. Mit fast dokumentarischer Treue und schonungsloser Realistik, der zur Perfektion gediehenen Handschrift dieses großen, bei uns leider noch viel zu wenig beachteten Meisters, wird hier der Machtkampf hinter den parteipolitischen Kulissen einer Stadtverwaltung aufgezeigt, die das Amt eines Stadtbaumeisters zu vergeben hat; die rechtlich notwendige Sicherungsklausel, daß „jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Begebenheiten unbeabsichtigt sei“, steht als ironisches Ausrufungszeichen in dicken Lettern am Ende des Films — werden wir ihn wohl je in Wien zu sehen bekommen?
Oder aber greifen wir ins Gebiet der Satire: hier war Luis Garcia Berlangas — erinnern wir uns an seine köstlichen Komödien „Willkommen, Mr. Marshall" oder „Calabuig“ — makabersatirische Farce „El Verdugo“ (Der Henker) das bittere Trumpf- As, das in grausiger Schärfe, gemildert — oder auch kontrastierend doppelt verschärft — durch einen grotesken Humor, den Kampf gegen die Unmenschlichkeit der Todesstrafe (insbesondere der noch heute in Spanien üblichen barbarischen Form des Garottierens) aufnahm: um eine Wohnung zu bekommen, übernimmt ein junger Mann das Amt seines Schwiegervaters, der Scharfrichter ist; er kann lange seine erste Amtshandlung hinauszögern — doch einmal ist es soweit: er wird von den Polizisten, fast mit Gewalt, zu seiner ersten Hinrichtung geschleppt (während der Delinquent gefaßt und aufrecht dem Tode entgegengeht!). Am Ende, völlig gebrochen, erfährt er vom Schwiegervater: „Auch mir ist es beim erstenmal so gegangen — aber man gewöhnt sich an alles…" An den staatlich lizenzierten Mord genauso wie an eine diktatorische Staatsform…
Einen Kriminalfilm ungewöhnlichen Formats präsentierte Japans großer Filmregisseur Akira Kurosawa, der Schöpfer des unvergeßlichen „Rashomon“ und zahlreicher Samurai-Filme: „Tengoku-to Jogoku“ (Zwischen Himmel und Hölle). Einem Großindustriellen, Millionär und in enorme Spekulationen verstrickt, wird sein Sohn entführt — doch es stellt sich heraus, daß als Opfer einer Verwechslung das Kind seines Chauffeurs in die Hände der Verbrecher gefallen ist. Nach langen Gewissenszweifeln stellt der Mann die riesige Summe des Lösegeldes zur Verfügung — was ihn in den Bankrott treibt, obwohl die Polizei schließlich den Entführer stellt. Gleich mehrere Themen sind hier zu einem meisterhaften Werk verworben, dessen geniale Bildkunst (Kurosawa scheut sich nicht, in dem Schwarzweißfilm eine einzige, winzige, doch optisch bedeutsame Sequenz in Farben zu zeigen) mit ungeheurer Präzision im Handlungsablauf und atemberaubender Spannung gepaart sind.
Englands „Billy Liar“ (Billy, der Lügner) von John Schlesinger, dessen „Nur ein Hauch Glückseligkeit“ einen der schönsten Filme des Vorjahres darstellte, ist die Tragikomödie eines jugendlichen Träumers, eines Schwächlings, der vor der Realität in die Welt seiner Illusionen flüchtet; ein Mädchen, das ihn liebt und an ihn glaubt, will ihn in die Wirklichkeit führen, es sitzt bereits mit ihm im Zug — da steigt er mit einer Ausrede noch im letzten Augenblick aus: er ist der Wirklichkeit nicht gewachsen, er flieht zurück in die Geborgenheit seines Elternhauses und einer Welt, die er für sich geschaffen hat, in der er der Held ist, bewundert und gefeiert wird… Besonders durch die kongeniale Gestaltungskraft des Titeldarstellers, des jungen Tom Courtenay — dessen Interpretation einen Preis verdient hätte —, wird diese eher erschütternde als heitere Geschichte zu einem Kabinettstück britischer Filmpoesie, deren Bedeutung weit in das reale Leben hineinreicht.
Alain Resnais, der in seinen beiden Filmwerken „Hiroshima, mon amour“ und „Letztes Jahr in Marienbad“ tiefgründige Studien der Erinnerung schuf, blieb auch in seinem dritten abendfüllenden Film „Muriel" seiner Thematik und seinem Stil treu; zwei einfache Geschichten, die keinen Augenblick in der gewohnten Form der Rückblende erzählt werden und sich dennoch wieder mit dem Spiel des Vergangenen, des Erinnerns befassen, sind zu einer Einheit verflochten: die Frau (von Delphine Seyrig, der „Marienbad"-Darstellerin, mit großer Intensität und Schlichtheit verkörpert), die ihrem früheren Geliebten wiederbegegnet und vergebliche Spuren des großen Gefühls sucht, und ihr Stiefsohn, der, von einem furchtbaren Erlebnis im Algerienkrieg verfolgt, sich an dem daran Schuldigen rächt. Kein einfacher Film, dessen schwer deutbare Handschrift Konzentration und Mitdenken erfordert, ein Film, der ebensooft Ablehnung begegnen wird wie Begeisterung — vielleicht ein Film, der für die Zukunft gestaltet ist, über den man aber sprechen und diskutieren kann: darum ein großer, beachtenswerter Film…
Diese Zahl, diese Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen; nicht alles war vielleicht vollkommen, manches hatte Mängel; Louis Malles „Le feu follet" (Das törichte Feuer) — eine faszinierende Tragödie eines vom Leben enttäuschten, zum Selbstmord getriebenen ehemaligen Trinkers: prachtvoll in der formalen Gestaltung, in der psychologischen Durchdringung und der darstellerischen Interpretation — doch von einem Pessimismus, einer Lebensverneinung, einer geistigen Haltlosigkeit, die erschreckt und abzulehnen ist. Oder Jiri Weiss’ romantische Bildballade „Zlate Kapradi“ (Der goldene Farn), ein stellenweise überaus poetisches Märchen mit starken, realistischen Momenten und einer unfroh stimmenden Klassenkampftendenz — seltsam bezaubernd und dennoch nicht geglückt. Und erst „Die große Straße" (Bolschaja Doroga) von Juri Oserow als Beitrag der Sowjetunion, der historisch völlig verzeichnete Kriegsabschnitt im Leben von Jaroslav Hašek (dem Autor des „Schwejk“), der den antimilitaristischen und pazifistischen Schriftsteller in einen Vorkämpfer des Kommunismus umdeutet!
Makellos und von höchster künstlerischer Bedeutung, eine wahre Quelle für historische Filmerkenntnisse, war wie immer die Vormittagsretrospektive (die am Lido anwesenden österreichischen Journalisten und Kritiker fanden den Besuch der Vorführungen nįcht notwendig nows „Aelita“, Wertows „Mann mit der Kamera“, Dowschenkos „Svenigora" und so weiter) Vorbehalten war, während die zweite Woche eine fast vollständige Übersicht über das Stummfilmschaffen Buster Keatons („The three Ages“, „Seven Chances“, „Our Hospitality“, „Sherlock Jr.“, „The Navigator“, „Go West“, „The Cameraman“, „The General“ und „Steamboat Bill Jr.“) bot — hinreißende Werke voll Experimentierkunst, vollkommener filmischer Gestaltung und meisterhafter Beherrschung der Mittel der Groteske. Bei allem Respekt vor dem gegenwärtigen Stand der Filmkunst: die große Zeit war jene, als man mit dem Bild allein, mit der Verwendung des Bildes in Montage und Rhythmus sich auszudrücken verstand, und des Wortes nicht bedurfte. Wir suchen heute neue Formen und Wege — damals hatte man sie bereits gefunden und zur Vollkommenheit gebracht…
Luigi Chiarini, der neue Leiter der Filmfestspiele in Venedig, hat es verstanden, aus dem Festival am Lido einen Angelpunkt in der Bewertung des Mediums Film als Kunstwerk zu schaffen; es sei ihm hierfür gedankt. Und er möge sich nicht von Vorwürfen abhalten lassen, daß das Echo so gering, daß der Besuch so mäßig war: Diejenigen, die an den Film als Kunst glauben, werden ihm zur Seite stehen — und diejenigen, für die das Wunder der Kinematographie nur ein Objekt für Spekulation und Sensation darstellt, mögen den Filmfestspielen auch in Zukunft fernbleiben — es wird sie niemand vermissen: Honi soit qui mal y pense!