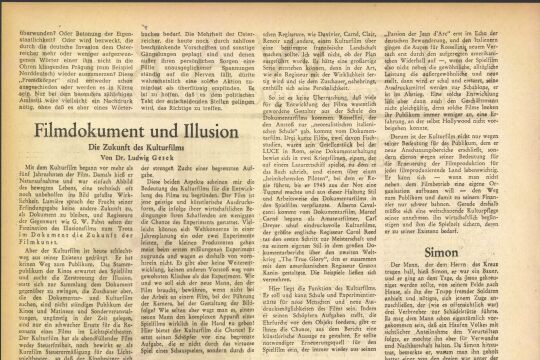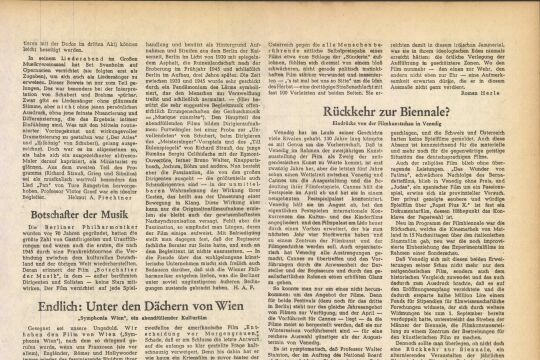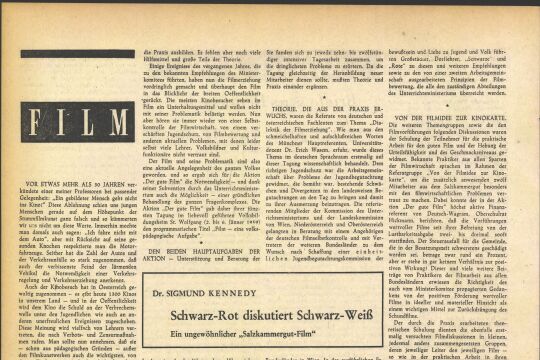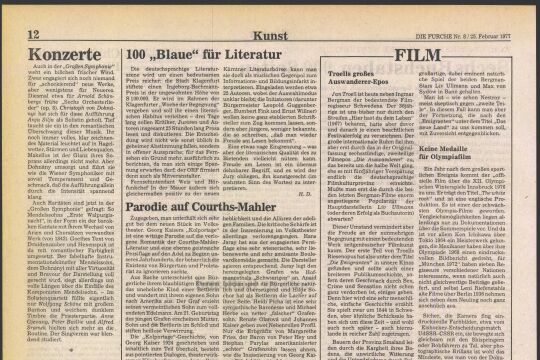Gibt es überhaupt ein Filmfestival, über das ein nach Hause zurüokgekehrter Filmjoumalist oder -kritiker nachher jemals gesagt hätte oder sagen würde: „Es waren zwar nicht lauter Filmkunstwerke, aber im großen und ganzen habe ich doch viel Interessantes und Neues gesehen. Es tut mir nicht leid, dort gewesen zu sein... ?“ Mir ist keines bekannt — dafür lese oder höre ich immer nur, daß dies Festival wieder einmal das Letzte war, jenes eine unglaubliche Zumutung und schließlich und endlich alle Filmfestspiele zum endgültigen Begräbnis der Filmkunst beitragen würden. Doch fahren dieselben Kritiker regelmäßig immer wieder an alle jene Orte und Stätten, von denen sie dann maßlos enttäuscht zurückkehren (was sie vorher bereits gewußt haben). Zur Krise der Filmfestspiele, die mit aus der Krise des Films entstanden ist, gesellt sich langsam eine neue dazu: nämlich die Krise der Filmkritik, deren fachliche Grundlagenforderung immer mehr einer laienhaft-snobistischen Besserwisserei (kein Wunder, wenn schon hauptberufliche Versicherungsangestellte neben sonderbaren „Studenten“ einen Großteil der Festivaljoumalistik ausmadhen!) und geschäftsmäßigen Berufsausübung zu weichen beginnt.
Daher ist es auch kein Wunder, wenn sich schnellstens die Meinung verbreitet hat, auch die heurigen Filmfestspiele in Venedig, die bereits zum siebenundzwanzigstenmal stattfindende „Mostra Internazionale d’arte cinematografica“ am Lido, waren eine Riesenenttäuschung, sie bedeuteten das Ende der Filmkunst und es ginge nicht mehr so weiter mit ihnen ... Abgesehen von der politischen Gegnerschaft zur augenblicklichen Leitung dieser Filmmostra (auch hier, selbst bei der Filmkunst, spielt die Parteipolitik eine überaus große Rolle — und das nicht nur in Wien, wie bereits zur Genüge bekannt, sondern auch in Venedig!) gehört es zum guten Ton — siehe oben —, heute im Film alles schlecht zu finden, was entweder verständlich gemacht ist oder nicht schon in gewissen ausländischen Filmzeitschriften als „gut und groß“ befunden wurde. Man muß um jeden Preis originell sein, selbst bei der Kritik, und es gibt nichts schlimmeres, als zuzugeben, man hat etwas nicht verstanden! Daher ist alles Unverständliche irgendwie großartig, zumindest voll tiefster Bedeutung — alles andere banal und unwert. (Peinlich ist es bei Erstlingswerken eines bisher unbekannten Filmschöpfers, über den es noch keine Unterlagen und daher Richtlinien gibt; hier kann man sich leicht blamieren — was im Laufe der Jahre dann allerdings großzügig übergangen und vergessen wird!) Es tut mir leid, bestreiten zu müssen, daß die venezianischen Filmfestspiele in diesem Jahr so abgrundtief schlecht und enttäuschend waren; ich fand sie im Gegenteil durchaus interessant und diskussionswürdig. Natürlich — wenn man sie mit der Mostra von 1956 vergleicht, der Filmkunstschau vor zehn Jahren, in deren Rahmen „Hauptstraße“, „Calabuig“, „Die Harfe von Burma“, „Die Straße der Schande“, „Gervaise“ usw. gezeigt wurden, muß das XXVII. Festival entschieden als niveaumäßig schwächer bezeichnet werden; freilich ist die Ursache daran nicht nur im Versagen der Auswahlkommission zu entdecken, sondern in der schon genannten Krise des künstlerischen Films überhaupt — und auch in einer merkwürdig teils kommerziellen, teils politischen Einstellung der verschiedenen Produktionsländer, die den einen angeforderten Film aus finanziellen Gründen („Wenn er bei einem Festival einen Preis erhält, gilt er als zu künstlerisch und kein Kino will ihn dann spielen“), den anderen aus Renommė („Dieser Film wird erst im nächsten Jahr auf unserem Festival laufen, damit unser heimischer Film den großen Preis davonträgt“), den dritten wieder aus Bedenklichkeitsgründen (wie bei einem angeforderten Film aus der CSSR) verweigern. Alle drei genannten Fälle sind in diesem Jahr bei der Vorauswahl der Filme für Venedig tatsächlich vorgekommen!
Professor Chiarini mußte sich daher entschließen, einen vollkommen neuen und anderen Weg zu gehen als früher (schon im Vorjahr wurde er wegen seiner Bemühungen, sich allein auf „Filmkunst“ zu beschränken, was sich natürlich im Ergebnis als unmöglich erwies, heftig angegriffen); er verlegte sich also auf das Experiment, auf vollkommen unbekannte Filme von nicht weniger unbekannten Regisseuren (Angelino Rons, Conrad Rooks, Tapan Sinha), stellte daneben das erwartungsgemäß vielversprechende Werk von Filmschöpfern mit bereits anerkannten Namen (Bresson, Truffaut, Varda) und versäumte auch nicht als Würze den etwas anrüchigen, skandalumwitterten Film (einen von Roger Vadim, einen vom Horrorspezialisten Roger Corman und schließlich den neuesten schwedischen Sexfilm Mai Zetterlings) — eine überaus originelle Mischung, die man an strengsten Maßstäben gemessen als vielleicht nicht ganz „filmkunstwürdiig“, jedenfalls als durchaus interessant und reizvoll bezeichnen muß.
Schon aus dieser bunten Mischung, die bei näherer Überlegung keinesfalls als konzeptlos anzusehen ist, war das Endergebnis klar von Beginn an herauszulesen. Wer sich von den anwesenden Kritikern und Journalisten nicht von vornherein darauf einstellte, mußte vom Lidofestival enttäuscht sein; wer aber mit unbefangenem Interesse (und Kenntnis der Qualitätsgrade der vertretenen bekannten Filmschöpfer) nach Venedig kam, dem wurde genau das geboten, was das Programm versprach: eine Übersicht, einen Querschnitt durch das gegenwärtige Filmschaffen mit sowohl kommerziell anspruchsvollen wie künstlerischen Werken. Wen wunderte es, daß Roger Cormans Thrillerschilderung über die Spezialgruppe der amerikanischen „Leather-Boys“, jene sozial abseits stehende Clique von unzufriedenen jungen Leuten in Los Angeles, die sich selbst „The Wild Angels“ („Die wilden Engel“) — noch richtiger wäre der Titel „Hell’s Angels“ gewesen — nennen, denen ihre Motorräder, ihr Kampf gegen die Bourgeoisie und ihre sexuelle Freiheit, gemischt mit faschistischen sadomasochistischen Elementen alles bedeuten, nicht über ein gewisses technisch-perfektes Raffinement hinauskam und weder die Urgründe noch psychologische Entwicklung dieses rauschbesessenen Häufleins zu schildern vermochte (und dies auch gar nicht beabsichtigte)? Wer hatte das Recht, sich darüber zu verwun dern, daß Roger Vadams mit faszinierendem Aufwand gestaltete Eifersuchts-Dreiecks-Tragödie „La Curėe“ („Die Beute“) nicht mehr darstellte als eine überaus raffinierte Neumischung der bei diesem Spezialisten für Erotik stets verwendeten Ingredienzien, die — von der Meisterhand des Kameramannes Claude Renoir in berückend schönen, impressionistisch angehauchten Bildpassagen eingehüllt — in ihrer fast schon ästhetisch schön zu nennenden Perfektion fast das Maß von Filmkunst erreicht? Und wer hatte erwartet, daß Mai Zetterlings neueste Produktion „Nattlek“ („Nachtspiele“) — wegen ihrer wohl schon übertrieben freien Darstellung erotischer Aberrationen nicht dem öffentlichen Venedig- Publikum zugänglich, sondern nur in einer Sondervorführung den Kritikern gezeigt — echte Filmkunst bieten würde und nicht nur kommerzielle Spekulation auf die seit Bergmans „Schweigen“ immer neuere und größere sexuelle Sensationen erwartende Konsumentenmasse?
Man muß diesen Sonderfall — für dessen Aufführung ohne Zensurschnitte man der Mostra dennoch dankbar sein sollte — näher beleuchten: hier wird die Grenze des Möglichen im Film eindeutig überschritten (was viele nach Bergman prophetisch befürchteten); am Sonderfall eines jungen Mannes, dessen Kindheit von einer sexuell überaus freizügigen Mutter beschattet und beherrscht war, ergibt sich die Gelegenheit, das ganze Vokabularium eines Sexuallexikons aufzuzeigen — natürlich als „Abschreckung“ und „Warnung“, denn das gute Ende am Schluß fehlt ja nicht. Nach seiner Hochzeit verbrennt der Gatte das üppige Schloß seiner verruchten Kindheit, worauf er ein braver Ehemann sein wird (will uns zumindest die Regisseuse, der es laut Aussage auf der Pressekonferenz „durchaus ernst mit diesem Thema gemeint war“, einreden); hier wird Freuds Erkenntnistherapie zu einer Groteske verwendet, die nur den Sinn hat, das vorhergegangene „Böse“ genügend breit aufzuzeigen. Diese Verdummung des Publikums, diese unfaßbare Spekulation mit den Erkenntnissen der Tiefenpsychologie zur Ausnützung augenblicklicher freizügiger Tendenzen übersteigt bereits alle Normen des Zumutbaren. Hier hat der Film eindeutig bereits jene Grenzlinie überschritten, die ein öffentliches Medium von dem Eindringen in die Intimsphäre trennt. Vor einer Weiterentwicklung in diesem Sinn muß gewarnt werden — sie bedeutet nämlich das Ende des Films selbst, auch wenn er dabei besondere künstlerische Höhen erklimmen sollte (was bei dieser Kopierung der großen Filme Sjöbergs und Bergmans nicht einmal der Fall ist),,,
Der Film hat überhaupt bereits eine Ausnahmesituation erreicht, wie der schließlich mit dem „Goldenen Löwen“ ausgezeichnete Dokumentarspielftlm Gillo Pontecorvos „La Battaglia di Atgeri“ („Die Schlacht um Algier“) eindeutig beweist. Hier wird in exaktester Wochenschaumanier (mit verwackelter, teils unscharfer Kamera, auf hartem, körnigem Aktualitätenmaterial aufgenommen) ein Dokument fabriziert, dessen Authentizität unanzweifelbar wirkt. Ist dies noch Filmkunst, diese nachgestellte vollkommene Wirklichkeit? Hier wird die Lüge zur Wahrheit und die Wahrheit zur Lüge: kann man nach diesem so vollendeten Film noch an das glauben, was man in der Wochenschau aus Vietnam oder vom Kongo zu sehen bekommt? An diesem Beispiel hat die Filmmostra am Lido ein anderes Extrem, ein weiteres Nonplusultra des gegenwärtigen Films verdeutlicht — und man muß ihr ebenfalls dafür dankbar sein...
Schließlich Conrad Rooks Studie der (vergeblichen?) Heilung eines Rauschgiftsüchtigen „Chappaqua“, der mit Pfiffen anläßlich der Verteilung eines Spezialpreises der Jury aufgenommene Beitrag aus den USA: die Herstellung des Films klingt selbst wie ein Märchen: ein millionenschwerer filmbegeisterter junger Amerikaner dreht aus dem Nichts, mit Hilfe seiner Beziehungen, seines Geldes und seiner Bekanntschaft mit allen möglichen prominenten Künstlern Dichtem und Malern, eine Experimentalstudie über die Visionen eines alle Stationen des Rauschgiftes absolvierenden Mannes; Geld spielt keine Rolle — und so ist das Ergebnis wie ein Lehrbuch für die technischen Möglichkeiten des Farbfilms, für Überblendungen, Virageneffekte und unerhört optisch reizvolle Doppel-Color-Tricks.
Aus diesen Streiflichtern mag die Bedeutung der XXVII. Internationalen Filmkunstschau zu erkennen sein. Sie hat dem aufgeschlossenen Betrachter ihren Sinn eindeutig zu demonstrieren vermocht, nämlich die Situation — oder wenn man will, die Grenzsituation —, in der sich der Film der Gegenwart, 71 Jahre nach seiner Geburt, befindet. Aus ihr zu lernen und die Konsequenzen zu ziehen, ist die Aufgabe der Kritik, in vielleicht noch stärkerem Maße als die der Produktion. Denn die Kritik hat die Aufgabe, dem Filmbesucher die Zusammenhänge klarzumachen, die er in der Fülle des Gebotenen nicht erkennen kann und die von der Produktion — bewußt oder unbewußt, das ist eine andere Frage — nicht erkannt werden wollen, solange nur die Kasse stimmt. Und in diesem Sinne war heuer Venedig ein unerhört aufschlußreiches und wertvolles Festival. — In Summa: „Es waren zwar nicht lauter Filmkunstwerke, aber im großen und ganzen habe ich doch recht viel Interessantes und Neues gesehen. Es tut mir nicht leid, dort gewesen zu sein..