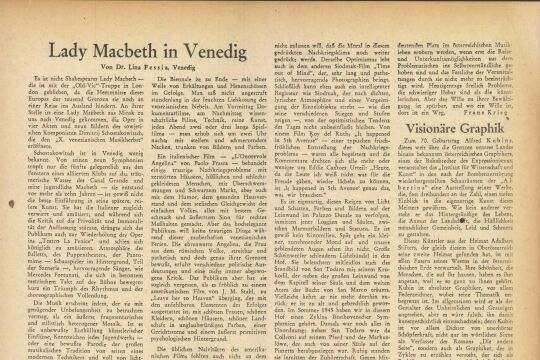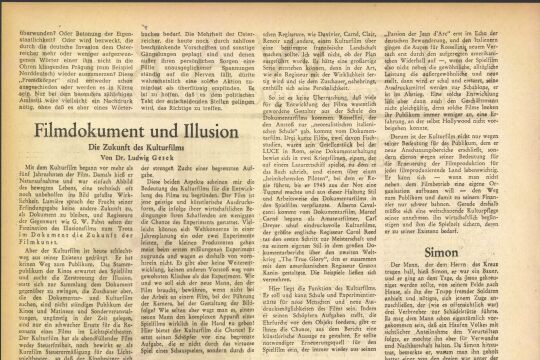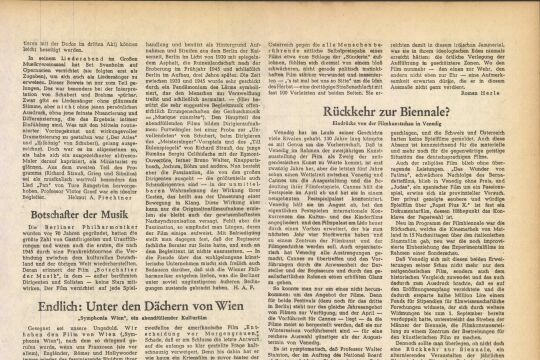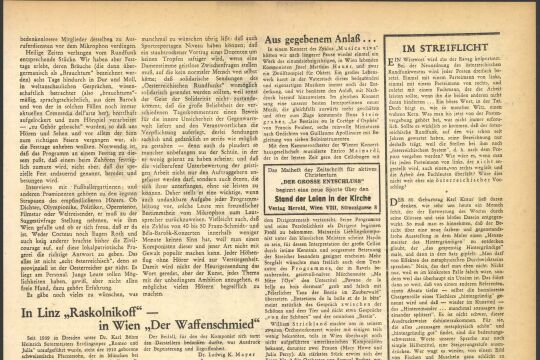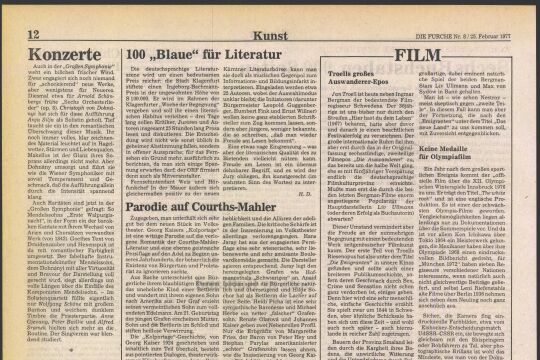VENEDIG — Königin der Meere und Doyenne der Filmfestspiele … Selbst mehr einer Filmkulisse als einer lebendigen Stadt gleichend, verspürt der Reisende, zwischen engfinsteren Häuserfronten wandelnd oder zierlich-kunstvollen Prunkfassaden stolzer Renaissancepaläste treibend, gleiche Gefühle wie vor der Kinoleinwand: Träume von zärtlichen Liebesromanzen steigen auf, Florettspitzen klirren aneinander und aus einer Gondel plätschert leise süßschwermütiger Klang einer Barcarole… Mondschein und Mandolinen, unentbehrliches Requisit aller Zelluloidträume, hier in Venedig scheinen sie alle Realität zu verdrängen und Wirklichkeit zu sein. Gibt es eine idealere Stätte auf der ganzen Welt, einen sinnvolleren Tempel, der betörenden Muse Kineia geweiht, um alljährlich ihr zu Ehren Festspiele abzuhalten als die Lagunenstadt? Wohl kaum…
1932 fand hier im Rahmen einer Internationalen Kunstbiennale die erste „Filmausstellung“ statt, die — zuerst in zweijährigem Rhythmus geplant (daher der noch heute gebräuchliche Ausdruck „Filmbiennale“) — in ihrer erfolgreichen Auswirkung nicht nur überall in der Welt, Cannes, Locarno, Berlin, Karlsbad, Moskau usw., Nachahmer fand, sondern auch mit immer größerem Rahmengepränge bis in die Gegenwart fortgesetzt wurde. Aus der bescheidenen Ausstellung wurde seit 1936 eine „internationale Filmkunstschau“, an der noch bis 1938 die später „alliierten“ westlichen Länder teilnahmen. Mit Anbruch des zweiten Weltkrieges verschwanden die USA, Frankreich und England aus dem Programm, und die Filmfestspiele in Venedig blieben bis 1942 nur den Ländern der „Achse“ und einigen wenigen „Neutralen“ Vorbehalten. Nach dem kriegsbedingten Intervall stieg dann 1946 wie der Vogel Phönix die Filmkunstschau in neuem Glanz aus der Asche zerstörter Barbarei und Größenwahns — und Italien präsentierte zugleich einen neuen Filmstil: der „Neoverismo“ wurde mit Filmen Rossellinis und Verganos der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Italien hatte den Faschismus in der Politik und die „Ära der weißen Telephone“ im Film überwunden und bereitete sich auf den Weg zur Weltgeltung auf dem Gebiet der Kinematographie vor…
Im gegenwärtigen Augenblick steht das Filmland Italien auf dem Höhepunkt seiner künstlerischen Bedeutung; Rossellini, Visconti und de Sica waren die Wegbereiter, Fellini, Antonioni und Pasolini sind die Pfeiler, um die sich ein fast unerschöpfliches Reservoir junger Talente schart, deren erstaunliche Begabung stets von neuem verblüfft und überrascht: Germi, Rosi, Ferreri — um nur die Wichtigsten zu nennen. Und um diesen Triumph zu dokumentieren, lud die Filmkunstschau in Venedig zu ihrer bisher größten Manifestation ein, zur „25. Mostra internazionale d’Arte Cinematografica“— um ein Jubiläum.-au feiern, das ih'seiner Art einmalig ist, und auch . die Bedeutung Venedigs als Stätte der Filmkunst vor aller Neider und Nachahmer Äugen “zu besiegeln. Die wichtigsten Namen des Films unserer Zeit waren vertreten: Bergman, Antonioni und Kosinzew, die „drei Meister“, Losey, Pasolini und Godard, „drei Arrivierte“, und Donner, Jessua und Roemer — drei „Junge“. Dazu eine Retrospektive über den skandinavischen Film, die alles bisher auf diesem Gebiet Gezeigte in den Schatten stellen sollte und die wichtigsten Filme Schwedens, Dänemarks, Norwegens und Finnlands von 1907 bis 1954 vorzuführen versprach — insgesamt 75 Filme (!), von denen allerdings 25 nur auszugsweise zu sehen waren. Die wenigen freien Nachmittage wurden dann noch mit Vorführungen der Preisträger von Cannes, Berlin, Lorcarno und Karlsbad ausgefüllt, mit preisgekrönten Dokumentar- und Kinderfilmen: mit einem Wort, ein gigantisches Programm, das ebenso große Erwartungen hervorrief wie in seiner Konzeption schon Nörglern Gelegenheit zu Warnungen und unsachlicher Vorkritik gab.
Das Endergebnis dieser Jubiläumsfilmkunstschau am Lido scheint allerdings diesen Kritiken Berechtigung verliehen zu haben; in seltener Einmütigkeit wurde festgestellt — und nicht nur im deutschsprachigen Raum —, daß in keinem vorangegangenen Jahr eine solche Planlosigkeit geherrscht habe wie heuer, eine solche Desorganisation und ein Mangel an wirklichen „besonderen“ Ereignissen, jenen „Sternstunden der Filmkunst“ etwa, wie sie das Festival in Venedig im Jahre 1951 mit der Entdeckung des japanischen Films durch „Rashomon“ zustandebrachte. Doch ist dies die Schuld Venedigs, der Auswahlkommission, des Leiters der Festspiele? Ein allgemeiner Überblick über die augenblickliche Situation des Films in allen Ländern beweist, daß die siebente Kunst sich momentan in einer Krise befindet (über deren Ursachen zu sprechen hier nicht der Platz ist). Kein Festival dieses Jahres ergab die künstlerische „Sensation“ — warum setzt man dies also unbedingt von Venedig voraus? Unter den 12 im Wettbewerb gezeigten Filmwerken (der Eröffnungs- und der Abschlußfilm wurden außer Konkurrenz vorgeführt) befand sich kein einziges, das nicht in irgendeinem Sinne „festivalwürdig“ war — und sei es auch nur, um einen Überblick über das nationale Filmschaffen zu geben, den Stand der Filmkunst in den einzelnen Ländern zu dokumentieren. Daß zum Beispiel Japan in dem Reigen gefehlt hat, ist ein Vorwurf, den zu erklären wohl nur die Leitung der venezianischen Festspiele in der Lage ist. Doch wer ein Haar in einer Suppe finden will, wird es immer und überall zu entdecken imstande sein — das beste Beispiel hierfür ist Berlin.
Und wer findet, daß der historischen Rückschau zu großer Platz eingeräumt wurde (der Vorwurf, sie habe keine Beziehungen zum Filmschaffen der Gegenwart ergeben, ist lächerlich), möge bedenken, daß gerade in einer solchen Besinnung auf eine große Ära des künstlerischen Films ihre Aussage liegt: gerade im Vergleich mit dem augenblicklichen Stand der Kinematographie erweist sich ihre eminente Bedeutung. Daß der Film — gestern ebenso wie heute und in aller Zukunft — Bildsprache ist, stellt keine überholte Maxime von einst dar, sondern ist Urgrund dieses Mediums, schon in seiner Bezeichnung verankert: Kinematographie ist die Aufzeichnung bewegter Bilder, wohlgemerkt, Bilder, nicht Worte. Und wie einfach, klar und sauber die einstigeBildsprache im Verhältnis zu unserer zeitgenössischen Geschwätzigkeit, snobistischen Intellektualität und krankhaften Überbewertung sexueller, psychologischer und schon anormaler Reizeffekte war, hat gerade diese — in ihrer Überfülle zweifellos überfordernde — Beschwörung der Filmvergangenheit ergeben. Von der Fundgrube für Historiker, jenem verlachten, armselig-grauen Völkchen, verloren in der Menge tüchtig-moderner „Filmjournalisten“, denen diese Retrospektive reichstes Material bot, soll hier ganz geschwiegen werden…
Drei große, wenn auch umstrittene Begegnungen mit der Filmkunst waren die heurigen Lidofestspiele immerhin zu bieten imstande: den kühnsten europäischen Farbfilm („Deserto rosso“ von Antonioni), eine Shakespeare-Verfilmung aus östlicher Sicht („Hamlet“ von Kosinzew) und das Experiment einer Verfilmung des Matthäus-Evangeliumsdurch einen bekannten Marxisten („II Vangelo secondo Matteo“ von Pasolini). Auf diese drei Werke soll noch näher eingegangen werden, nachdem alles übrige kurz mit einem Satz umrissen ist.
Die erste Farbkomödie Bergmans, die auch in Kürze in Wien anlaufen soll, enttäuschte alle, die von Bergman eine Fortführung der bisherigen Linie erwarteten. Um sie ganz würdigen zu können, muß wohl die deutsch-synchronisierte Fassung abgewartet werden — und auch die Ruhe einer Vorführung, die nicht durch eine Anreise von 12 Stunden Nachtfahrt in der Aufnahmefähigkeit behindert ist. Der Rassenproblemfilm Michael Roemers „Nothing but a Man“ ist eine saubere, aber etwas konventionelle Erstlingsarbeit eines vielversprechenden Talentes — eine Kritik, die sich genauso auf den Film des nächsten Abends, den bulgarischen „Pfirsichdieb“ von Veulo Radev, bezieht. Jorn Donners „Att Alska“ (Lieben), der zweite Film des jungen schwedischen Regisseurs, stellt die eher peinliche als originelle Beziehung einer jungen Witwe zu ihrem Jugendfreund dar, eine „Erotologie“, die vom Publikum auch entsprechend vermerkt wurde und zu enttäuschten Äußerungen Anlaß gab, wenn das junge Paar sich einmal nicht innerhalb der vier Wände ihres Schlafzimmers befand (was selten genug vorkam). Als Geschäftserfolg dürfte der Film größte Aussicht besitzen… „Tonio Kröger“ von Rolf Thiele ist indessen in Wien bereits öffentlich zu sehen, der englische Beitrag „The Girl with green Eyes“ („In wilder Ehe“), ein in keiner Hinsicht besonders erregendes Erstlingswerk von Desmond Davis, gestaltet im augenblicklich modernen realistischen Filmstil Großbritanniens, ist bereits ebenfalls für Österreich im Verleih vorgemerkt.
Die drei französischen Beiträge fielen etwas aus dem Rahmen; sowohl Jeah Delännoys dfttähzierte find krfstall-’ klare Verfilmung von Peyrefittes „Heimlichen Freundschaften“ („Les amitiės partičuliėrešft) — leidenschaftslos, ästhetisierend und filmisch einheitlich — als auch Alain Jessuas „La vie ä l’envers“, die Studie eines Schizophrenen, aus dessen Sicht gesehen, bewiesen beachtliches Niveau. Jean-Luc Godards Spielerei „La femme mariė“ („Die verheiratete Frau“) ist eine ebenso unnötige wie maniriert- schlampige Variation heute bereits mit Langeweile notierter „Nouvelle-vague“-Effekte, mit denen der erstarrte Regisseur nur noch einige wenige Snobs „außer Atem“ zu bringen imstande ist. Die Amoral dieses Streifens ist symptomatisch für eine ganze Richtung.
Antonionis „Rote Wüste“ bringt die Steigerung eines Themas, das nach „L’eclisse“ nicht mehr steigerungsfähig erschien: die Einsamkeit und Verlorenheit in unserer Zeit — wobei allerdings der Regisseur bereits zur Darstellung eines klinischen Falles griff. Was durch diesen Sonderfall an Allgemeingültigkeit verlorenging, macht die Einbeziehung der Farbe als bilddramaturgisches Element wett. Wie hier Antonioni in grauen, melancholischen Zwischentönen seelischen Zuständen Ausdruck verleiht, gleicht der Entdeckung einer neuen Sprache im Film. Es bedarf nicht der Riesenleinwand oder einer Verstiegenheit in abseitige literarische Experimente, um der Filmkunst neue Wege zu weisen — für den großen Künstler bietet der Film der Gegenwart genug Neuland, wie dieses Werk, das in die Filmgeschichte eingehen wird, beweist.
Grigori Kosinzew, seit den Anfängen sowjetischen Filmschaffens als kühner Experimentator und meisterlicher Regisseur bekannt, schuf nach siebenjähriger Vorarbeit und Planung eine neue Variation des Shakespearschen „Hamlet“. Ein sichtlich von östlicher Lebensart beeinflußter Dänenprinz, der von keines Gedankens Blässe angekränkelt tüchtig im Leben seinen Mann und Rächer steht. Dieser Hamlet zaudert nicht, sondern handelt; er spricht auch nicht Verse, sondern eine allgemein verständliche Sprache des Volkes. Doch warum nicht? Im großen Pathos faszinierender Bildkunst, die von der Welles’ absolut verschieden ist, dennoch mit ihr ursächliche Ähnlichkeit hat, besitzt auch das Werk Gültigkeit und den Atem jenes eminent „Filmischen“, das den Wert des r Kunstwerkes letztlich ausmacht, siu TS as größte Problem ist die Pasolini-Verfilmung des „Mat- -L thäus-Evangeliums“. Es sei vorausgeschickt, daß seine Gestaltung eine der wenigen ist, die ohne kitschiggeschmacklose Peinlichkeit der Figur Christi auf der Filmleinwand gerecht wird; nicht des Gottessohnes, des göttlichen Heilandes — sondern eines revolutionären Erlösers (im urchristlichen Sinn), menschlich, doch von seiner Sendung überzeugt. Formal überragt dieses Werk alle derartigen bisherigen Versuche in solchem Maß, daß die Zuerkennung des OCIC-Preises als gerechte Würdigung erscheint. Doch erhebt diese Auszeichnung den Film auf eine Ebene, die ihn jeder laienhaften kritischen Betrachtung entzieht. Einwände außerhalb theologischer Kenntnis können nur subjektiver Art sein, deren Gültigkeit anzweifelbar ist.
Die Krise des Films im Jahre 1964 ist zugleich die Krise der venezianischen Filmfestspiele. Man kann keine Höchstleistung von einer Ausstellung verlangen, wenn das ausgestellte Objekt keine klare Linie erkennen läßt. Doch auch zur Dokumentation einer solchen Situation beigetragen zu haben, stellt bereits die Erfüllung einer Aufgabe dar, die ihren Zweck rechtfertigt.