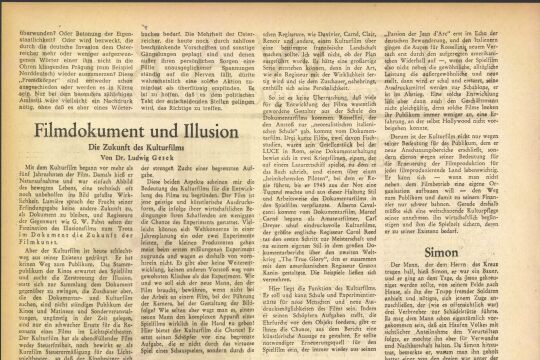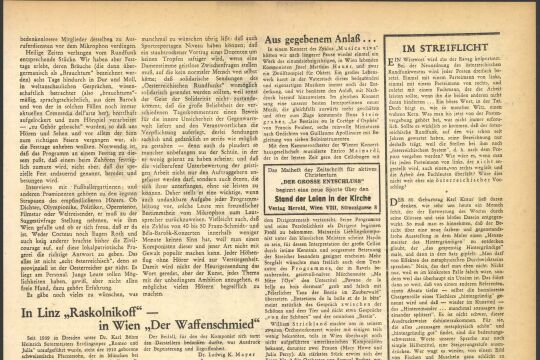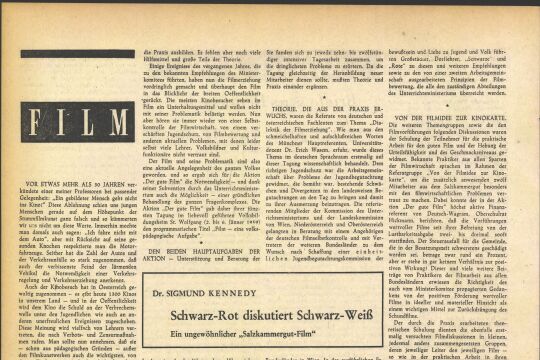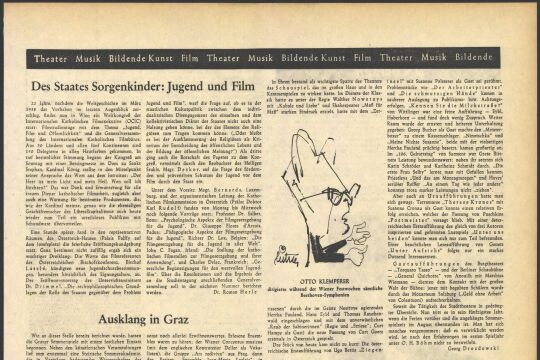Tedes Jahr schien die Berlinale dem fllmkritischen Besucher ein vielstimmiger Akkord von Film und Kunst und Mensch und Begegnung mit Berlin, dessen Dominante als ein Horn-ruf oder Trompetenstoß, für jedes gute Ohr vernehmbar, mit allen Ober- und Untertönen nach Freiheit und Weite rief.
Heuer mischte sich in den gewohnten Klang eine schrille Dissonanz, die von neuen Mitspielern, der erweiterten Filmauswahlkommission, harmonieverderblich beigebracht wurde.
Die Berliner Filmfestspiele, das gilt auch für die XV. vom 25. Juni bis 6. Juli 1965, bestanden ja nicht allein aus einem Zusammentreffen von Filmen und Filmleuten, die mehr oder minder eine halbe oder dreiviertel Welt repräsentieren, dazu gehören viele Fakten und Phänomene. Einem Teil der Berlinale-Besucher mag der Tanz um das Goldene Kalb aus Mammon und Eitelkeit das Wichtigste sein; andere — und es sind nicht wenige — sammeln sich beim Filmgottesdienst um das zarte Lamm, die Mittelgestalt auf dem großen Wandbild in der Kirche Regina Martyrum, in der das Wort Gottes für die Filmleute aus aller Welt in vier Sprachen verkündet wird und heuer Bischof Leiprecht von Rottenburg, der Filmreferent der Fuldaer Bischofskonferenz, das Pontiflkalamt zelebrierte. Anderen ist der tägliche Kontakt mit Fachleuten aus vielen Ländern das Herzensanliegen und den unermüdlichen Festivaliers unter den ehrlichen Kritikern laufen die Filme davon, sosehr sie ihnen auch nachlaufen in den Veranstaltungen des Wettbewerbes, der Informationsschau, der Retrospektive, der Repräsentationsschau der Länder und des Filmmarktes. Selbst der Unersättlichste erlahmt und kapituliert vor der Unmöglichkeit, alles zu sehen.
Daß neben den Kinostunden auch noch Freizeit oder Verpflichtungsbesuch von Empfängen möglich sein muß, gehört in die Berlinale der mathematischen Gleichungen mit einem schwer zu findenden X. Zu jedem Film lockte heuer als bedeutende Ergänzung, eine Pressekonferenz mit dem Regisseur und den Darstellern, mit schlichten und „schöpferischen“ Produzenten. Das Unbehagen der Festspielbesucher kam aber nicht aus dem Getriebe der Anforderungen, das durch das öl einer nur in Berlin so erfahrbaren Gastlichkeit und Hilfsbereitschaft in allen kulturellen und wirtschaftlichen Anliegen lautlos und glatt durch die Tage läuft, sondern strömte von der Leinwand her und machte sich in Ablehnung und Entsetzensrufen Luft, wenn wieder und wieder der Filminhalt dem Trend nach totaler Abkehr von der sauberen Leinwand frönte. In der offiziellen Festspielzeitschrift wurde die in Deutschland auch von der Filmwirtschaft begrüßte Bemühung um die saubere Leinwand lächerlich gemacht. Filmfestspiele sind kein Tummelplatz für Partisanen der „sauberen Leinwand“, heißt es da bündig.
*
Die Unfreiheit der Berlinale 1965 begann vor einem Jahr: in dem Nachgeben und Zurückweichen vor dem frechen, ungerechtfertigten Geschimpfe einzelner deutscher Kritiker, die im Gegensatz zu den Cineasten anderer Länder mit Lust und gespitzter Feder die eigene Kultur zerfasern und nichts von dem gelten lassen, was einer Bejahung von Herkommen und Sitte zu nahe kommt. Man nahm sie zur Belohnung für ihre grobe Negation in das Auswahlkomitee auf, das über die
Annahme der Filme für den Wettbewerb und die Informationsschau entscheidet und schickte sie als Sucher in die Welt. Sie brachten nicht mehr heim, als in früheren Jahren geboten wurde; sie wollten ja nur Spitzenwerke. Aber das Gesicht der Berlinale haben sie nicht glänzender gemacht, sondern Schatten hineingegraben, voll abgründigen Dunkels und häßlichen Schorfes. Ob die besten Filme, die erfreulichsten zumal, durch sie herbeikamen oder gegen sie, wurde nicht bekannt.
*
Im Gesamteindruck bilden diese Filme den erfreulich hellen Fleck im Mosaik der klinischen Dunkelheiten und grau-tönigen Lebensirrwege zwischen menschlich weiten Horizonten und sachlich verbauten Stilunstimmigkeiten. Der fröhlichste Film stand am Schluß. Es war die israelische Produktion „Sallah“, mit sicherem Geschmack und leiohter Satire inszeniert von Ephraim Kishon. Menschen und Dinge im Fall der Einwanderer aus orientalischen Zonen in Lrael durchdringen und verdichten sich in der Gestalt des Hauptdarstellers, seiner Gerissenheit und Widerspenstigkeit gegenüber behördlichem Ordnungszwang, zu einem vielbejubelten Charakter- und Zustandsbild von selten erreichbarer Fülle und Tiefe.
Befreiend nicht nur durch seine filmische Perfektion, sondern auch durch die stilistisch prächtige Mischung kauziger Wildwestgestalten und ihrer Handlungen im Kanpf gegen Gewalt mit Humor und Moritatensongs, wirkte der amerikanische Beitrag „Cat Ballon“ von Silverstein mit Lern preisgekrönten Darsteller Lee Marvin und Jane Fonda. In dem kanadischen Film „Amanita Pestilens“ (Der verflixte Rasen) war der Humor hingegen zu dünn und zu zäh, v el-leicht auch zu versteckt und verdeckt für unsere Filmgewöhnung.
Ein Drittel des heuer auf 24 Filme für Wettbewerb md Information herabgesetzten Programmes muß inhaltlich \nd darstellungsmäßig psychiatrischen, psychoanalytischen oder psychologisch klinischen Komplexen zugerechnet werden, um die es offen oder gewunden kreiste wie die lichtkranke Motte um den vernichtenden Strahl. Der Argentinier Adolfo Kuhn enthüllt in seinem Film „Pajarito Gomez“ (Der Abgott) den Einfluß der Werbung und die Manipulation des Menschen bis zur Massensuggestion am Fall eines Schallplattenstars, bei dessen Begräbniszeremonie alle Twist tanzen. Im dänischen Beitrag „To“ (Zwei) streicht die Gestalt eines jungen Mannes, der sich nicht einfügen kann oder will, durch das Labyrinth von Isoliertheit, Lebensleichtsinn, Arbeitsscheu, unbekümmerten Diebstahl an den Ersparnissen der verständigen Freundin, ohne den rettenden Ausgang ::u finden.
Der spanische Beitrag „El Arte de Vivir“ (Das Leben geht weiter) von Julio Diamante greift zum mehrfach behandelten Problem der Charakterstörung und -Wandlung durch Umweltseinflüsse, die bis zu Lebensvernichtung am Mitmenschen führen. Im schwedischen Farbfilm „Kungsieden“ (In einer langen Sommernacht) erlebt der junge Mensch zehn Jahre nach der Begegnung mit einem geliebten und wieder verlorenen Mädchen Visionen, die zwischen Wirklichkeit und krankhafter Einbildung in den Stationen einer langen Wanderung auf ihn eindringen und zum mörderischen Ende führen. Der Brasilianer Anselmo Duarte, schon vorgebildet durch seinen ersten Spielfilm „50 Stufen zur Gerechtigkeit“ auf dem Boden der Darstellung von Fanatismus und Hysterie, treibt diesen Komplex in seinem neuen Film „Vereda da Salvacao“ (Die Besessenen von Catule) in einem klinischen Fall von religiöser Sektenhysterie bis zur Tötung unschuldiger Kinder vor, ohne ihn anders beenden zu können als mit der Brachialgewalt der Ordnungsmacht, mit Feuer und Gewehren.
Im englischen Film „Repulsion“ (Ekel), den der polnische Regisseur Roman Polanski in einer kaum erträglichen Mischung von krauser Realität, Schock und zäher Unterbewußtseinspsychologie drehte, weitab von seinem letzten kühnen gesellschaftsproblematischen Zugriff „Das Messer im Wasser“, verdichtet sich in Umstand und Zustand der tragische Fall eines sensiblen Mädchens zum reinen klinischen Problem, das nach Mord und Selbstvernichtung rätselhaft ungelöst bleibt. Der Inzestfall eines snobistischen Geschwisterpaares wird in Rolf Thieles deutschem Festspielbeitrag „Wälsungenblut“ aus der literarischen Angriffsform von Thomas Mann durch Dekorbeherrschung, darstellerischen Schliff und Problemdurchdringung in angreifende optische Form mit Wagner-Musik-Verbrämung gebracht. Der noch nie erreichte Abrutsch in bewußte und berechnete Scheußlichkeit war der japanische eingeladene Film „Geschichten hinter Wänden“, dessentwegen Japan laut einer Meldung, weil seine Beschwerde gegen die Auswahl dieses Films von Berlin ignoriert wurde, die Berlinale in Hinkunft nicht mehr anerkennen und beschicken will. Bezeichnend an diesem Werk war nicht nur der künstlerische Tiefpunkt und die Darstellung von Bettszenen und Sexualmord, sondern die Rechtfertigung seiner Einladung mit dem Hinweis, man wolle in Berlin kein Kinderprogramm, sondern Diskussionsfilme. Und weiter ist der Film symptomatisch für die Nachwirkung der Tabu-Zerstörung durch schwedische und andere Produktionen, die eben in aller Welt zu neuen geschäftlichen Epigonen herausfordern.
★
Das Gegengewicht gegen dieses Inferno aus Japan bildete der indische Beitrag von dem schon mehrmals preisgekrönten Regisseur Satyajit Ray „Charulata“ (Die einsame Frau), in dem es ausgewogen und abgestimmt um die Nachzeichnung jener Periode im indischen Leben geht, als die Männer sich der Politik zuzuwenden begannen und das Familienleben in eine Krise geriet. „Am Beispiel der Ehekrise eines indischen Paares Ende des 19. Jahrhunderts entwirft der Film ein Bild des erwachenden politischen Bewußtseins und der beginnenden Emanzipation der Frau. Geprägt von einem Bekenntnis zu Wahrheit, Redlichkeit und gegenseitigem Vertrauen vermittelt er eine gültige Aussage über die menschlichen Beziehungen, ohne sich mit einer bequemen Lösung zufrieden zu geben“, heißt es in der Begründung der Jury des Internationalen Filmbüros, die diesem
Film den OCIC-Preis verliehen hat. Dem gleichen Film wurde auch ein Silberner Bär der Festspieljury zuerkannt. Der Goldene Bär, die höchste in Berlin vergebene Auszeichnung, fiel auf den französischen Beitrag „Alphaville“ (Lemmy Caution gegen Alpha 60), den Godard in einer merkwürdigen teils subtilen, teils skurrillen Stilart inszenierte. Der Normalbesucher wird sich bei diesem Film zwar an utopische Vorbilder wie „1984“ erinnern, deren klare Linie aber begreiflicher finden als die Hereinnahme des sehr strapazierten Eddie Constantine, der einfach pistolenschießend wie in einem üblichen Reißer alle Hemmnisse zur Erledigung seines Auftrages überwindet.
Preiszuerkennungen sind beinahe immer anfechtbar, die Urteile mancher Jury undurchschaubar in ihrem Zustandekommen, weil man die Quellen nicht kennt, aus denen Wellen der Sympathie strömen, Steine auf dem Weg glatt reiben oder beiseiteschieben und munter zum Ziel kommen.
*
Den 25 Langfllmen des Wettbewerbes und der Information aus 15 Ländern standen 31 Kurzfilme aus ebenfalls 15 Ländern gegenüber, der größte Teil davon thematisch und optisch über Land und Leute informierend. Einer aus dieser Gruppe „Die Heimat des Dichters Yeats“, ein ansprechender Beitrag aus Irland, fand die höchste Auszeichnung der Festspieljury. Der niederländische Film „Ein Sonntag auf der Insel der Grande Jatte“, ein köstlicher Beitrag zum Thema „Sieben Autoren suchen einen Leser“, erhielt wegen seiner phantasievollen Variationen in diesem Spiel einen Silbernen Bären. Einfallsreich, überraschend in seinen Gags ohne Uber-treibung und ganz auf den Darsteller abgestimmt, erwies sich der kanadische Film mit Buster Keaton „The RaUroader“. Auch der deutsche Kurzfilm von Peter Schamoni „Im Zwinger“ mit seiner sehr fein dosierten Würze in der Beobachtung von Besuchern und Erklärern im Zwinger von Dresden hätte eine Auszeichnung verdient. Desgleichen gefiel der Kurzfilm „Ein Tag in Berlin“, weil er die reiche Bildauswahl und Abfolge des Geschehens mit echt berlinischem Humor kommentierte. Das aber, was uns bestimmend für Anlage und Leistung des Kurzfilms zu sein scheint, jener Gebrauch kühner Wendungen von filmischen Mitteln, durchdrungen vom Wollen, die Wahrheit in knapper Form zu sagen und zu zeichnen, war heuer in Berlin außer in den angedeuteten Fällen nicht zu finden. Vielleicht überläßt Berlin in kameradschaftlicher Zurückhaltung dieses Feld den Veranstaltungen in Mannheim und Oberhausen.
Berlin feierte heuer das Gedenken an 70 Jahre Film <— und es hat mehr Berechtigung dazu als andere Städte. Eine erfreulich reich beschickte Retrospektive mit beglückenden Eindrücken und Erinnerungen an Glanzzeiten des Films stellte sich in Gegensatz zur filmischen Perspektive bis auf den Schlammgrund im Hauptprogramm. Diese Filme der zwanziger und dreißiger Jahre begleiten eine harte Zeit mit viel menschlichem und sozialem Elend, sie sind Spiegelbild und Mentor zugleich, sie kannten keine Scheuklappen, aber sie wußten noch nichts von den Sirenenphrasen unserer Tage, die von Generationswechsel im Film schwärmen und damit neue Formen und Gesinnungen preisen, im Film jedoch bis zur Gesinnungslosigkeit vordringen. Und die weiter mit ihren Lockrufen von der totalen Freiheit jeder Kunst den Film in den Abgrund ziehen, weil er außerhalb und oberhalb der nur mit ästhetischen Maßstäben zu richtenden Kunstgebilde steht. Der Film war und bleibt, trotz des Geschreis einseitiger und halbgebildeter Kritiker, mehr als nach Punkten subjektiver Kritik, meßbares Kunstwerk, ein Wirkungs- und Darstellungsmittel des ganzen Kraftfeldes bekannter und unbekannter Ströme, vom Innersten des menschlichen Raumes bis an die äußersten Horizonte, wo das Lichtspiel hinüberweist zum Schöpfer des Lichtes.