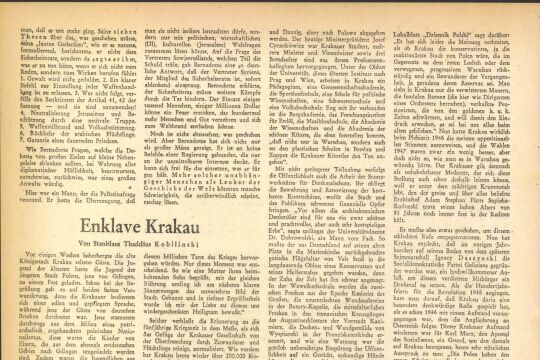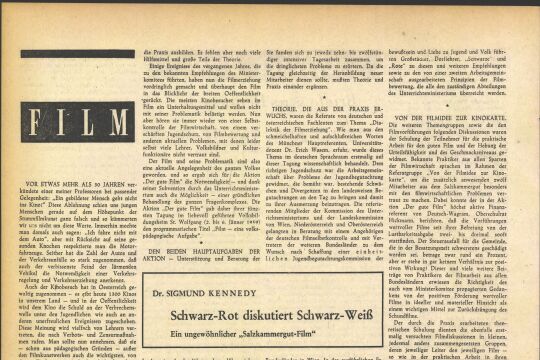Es gehört heute schon fast zum guten Ton, über die allgemeine Filmmisere in der Welt zu wehklagen. Dies ist in Deutschland genau so wie in anderen Ländern. Wenn hier trotzdem' die allgemeine Filmmisere zuweilen besonders triste Formen angenommen hat, dann vielleicht deshalb, weil sich der deutsche Film in den letzten Jahren mehr als der anderer Länder von der Wirklichkeit entfernt hat. Er bediente sein Publikum besonders reichlich mit der gefühlvollen Trivialität der Heimatfilme, mit der faden Banalität der Heide-, Wald- und Wiesenschnulzen, mit der gefährlichen Heroisierung des Kriegsgeschehens, mit der autoritätsgläubigen Stilisierung „großer“ Persönlichkeiten. Die Wirklichkeit war von den Leinwänden verbannt worden und fristete in gutgemeinten „Anklagefilmen“ ein kümmerliches Dasein. Filme, wie „Weil du arm bist, mußt du früher sterben“, spielten das vorausgesagte Defizit denn auch prompt ein und lieferten der Filmwirtschaft einen weiteren „Beweis“, daß mit „Filmkunst“ eben kein Geld zu verdienen sei.
Es wäre falsch, wollte man die Flucht des deutschen Films vor der Realität einfach mit dem von jeher gespannten Verhältnis der Deutschen zur Wirklichkeit erklären. Schließlich sind in den vergangenen Jahren einige ernsthafte realistische Arbeiten aus dern Bereich der EpiK und der Dramatik zu verzeichnen. Statt sich ihrer zu bedienen, griffen die deutschen Filmproduzenten jedoch auf die handlichere und (wie sie meinen) gängigere Ware der Unterhaltungsliteratur, der Tatsachenberichte und der 50-Pfennig-Romane zurück. Furcht vor der Wirklichkeit? Eher doch die einfache Unfähigkeit, diese Wirklichkeit zu begreifen, zu erkennen und zu gestalten! Neben geistigen hat der Mangel an realistischen Filmen in Deutschland vor allem ökonomische Ursachen. Die steigenden Auflagen der Illustrierten sind ja eben gerade jenen „Tatsachenberichten und „Geellschafts“romanen zu danken, welche immer noch der deutschen Familie liebste Lektüre zu sein scheinen. Das haben natürlich auch die Filmproduzenten begriffen.
Glücklicherweise sind nicht alle diese Tatsachenberichte der Illustrierten schlecht. In der Form zwar meist der reduzierten Aufnahmefähigkeit des modernen Durchschnittslesers angepaßt, bringen sie im Inhalt häufig ernsthafte Auseinandersetzung mit Zeitproblemen oder Problemen des Dritten Reiches. Eine beachtliche Frucht dieser ursprünglich nur kommerziellen Verbindung von Film und Illustrierter war Robert Siodmaks „Nachts, wenn der Teufel kam“, dessen Drehbuch Werner Jörg Lüddecke nach einem Tatsachenbericht in der „Münchner Illustrierten“ schrieb. Die Geschichte des Frauenmörders Bruno Lüdtke diente dazu, den historischen Hintergrund, vor dem sie sich abspielte, die Hitler-Zeit, hart und wahrhaftig ins Bild zu setzen. Siodmak traf das Zeitkolorit genau. Er verzichtete auf Beschönigung und bequeme Ausreden. So wurde dieser Film ein ernsthafter Beitrag zur Auseinandersetzung mit der braunen Vergangenheit.
Nun mehren sich in jüngster Zeit die Filme, die den Sprung in diese Vergangenheit machen. Darin jedoch bereits ein Zeichen für wirkliche Besinnung und ehrliche Auseinandersetzung sehen zu wollen, wäre verfrühter Optimismus. Diese Filme bedienen sich des Krieges nur als Kulisse. Sie tun so, als hätten der Krieg und das Regime nichts miteinander zu tun. Sie stellen forsche „Helden“ in den Mittelpunkt des Geschehens, die wacker gegen „den“ Feind kämpfen, wofür, wissen sie ebensowenig wie es die Zuschauer wissen sollen, denen das Ganze angeboten wird.
Fast scheint es, als müsse man wirklich mehr als zehn Jahre zurückgehen, um deutsche Filme zu finden, die sich ernsthaft mit der Realität des Lebens unter dem Hitler-Regime beschäftigten, als hätte der deutsche Film seit Wolf gang Staudtes „Rotation“ und „Die Mörder sind unter uns“, seit R. A. Stemmles „Berliner Ballade“ und Wolfgang Liebeneiners „Liebe 47“ (nach dem Stück von Wolfgang Borchert) dieses Thema und das der Gegenwart ängstlich gemieden. Die Entwicklung des Regisseurs Staudte ist von symptomatischer Bedeutung für den Wandel des deutschen Films in den letzten zehn Jahren. Gewiß, Staudte hat Zeitprobleme nie gemieden, wofür sein Algerienfilm „Madeleine und der Legionär“ als Beispiel dienen kann, oder einige Hiebe gegen die geplante „Lex Soraya“, eine bedenkliche Einengung der Pressefreiheit, in seinem letzten Film „Der Maulkorb“, der im übrigen in der guten, alten Zeit des Kaisers Wilhelm spielt. Und doch ist die Art und Weise, wie er die heißen Eisen anfaßt (wenn er sie anfaßt), anders geworden, milder, versöhnlicher, lauer. Seine „Kanonenserenade“ präsentierte sich als (mäßig) lustiger Schwank mit einigen zeitkritischen Nadelstichen. Eher behaglich als erbittert mokierte er sich über den Mythos der Uniform und den Größenwahnsinn des wild gewordenen Kleinbürgers im Kriege. Aber das Ganze blieb trotzdem ein harmloses italienisches Lustspielchen, denn der Krieg wurde nicht sichtbar und der Faschismus wurde ungebührlich verharmlost. Der ganze Film hatte nichts mehr von jener bitteren leidenschaftlichen Anklage, die Staudtes frühere Produktion auszeichnete. Dort, wo er sein Publikum schockieren sollte, unterhielt er es, wo er warnen und mahnen sollte, versöhnte er und ließ lächelnd — vergessen;
Wolfgang Liebeneiners Entwicklung ist in gewisser Hinsicht ähnlich verlaufen, nur mit dem Unterschied, daß er (von dem bereits erwähnten Film „Liebe 47“ abgesehen) nie so konsequente realistische und zeitkritische Filme geschaffen hat wie Staudte und deshalb mit anderen Maßstäben gemessen werden muß. Er hat es freilich stets verstanden, geschickte Unterhaltung mit gerade herrschenden Zeittendenzen zu verbinden. Gegen den Strom ist er dabei nie geschwommen. Seine historischen Filme „Bismarck“ (1940) und „Die Entlassung“ (1942), mit Emil Jannings in der Hauptrolle, sind bei aller formalen Brillanz Musterbeispiele autoritätsgläubiger Geschichtsklitterung gewesen. 1949 erkannte er die Konjunktur für „Trümmerfilme“, wie man das damals nannte, und vermochte dank seiner formalen Fertigkeit einen der bedeutendsten und erschütterndsten Nachkriegsfilme zu schaffen. Ein Blick auf die große Zahl seiner folgenden Produktionen macht deutlich, daß ihm die Auseinandersetzung mit der unseligen Vergangenheit keineswegs ernst war. „Wenn eine Frau liebt“, heißt es da 1950, „1. April 2000“ (1952), „Der Weibsteufel“ (1953), „Die schöne Müllerin“, „Die heilige Lüge“, „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ (1954). Wieder hatte Liebeneiner die Zeichen der Zeit begriffen und drehte 1955, als in Deutschland die Frage der Wiederbewaffnung akut wurde, „Urlaub auf Ehrenwort“, ein Remake, dessen erste Fassung er 1937, kurz nach Einführung der Wehrpflicht, Goebbels geliefert hatte. Es folgte die Blütezeit der Gesellschaftsschnulzen und er drehte „Königin Luise“, „Die Trapp-Familie“ (dessen Fortsetzung gerade jetzt in der Bundesrepublik anläuft) und „Waldwinter“. Mit „Taiga“ schließlich nahm er sich wieder ein ernsthaftes Thema vor, Kriegsgefangenschaft in Sibirien. Wiewohl man dem Film eine starke menschliche Wirkung nicht absprechen will, muß man doch feststellen, daß Liebeneiner nicht, auf recht billige Propagandamätzchen verzichtete und den historischen Hintergrund, vor dem allein das Schicksal der
Kriegsgefangenschaft begriffen werden kann, nämlich den Nationalsozialismus, den Krieg und die deutsche Schuld, völlig außer acht ließ. Im übrigen folgte auch dieser Film einem Zug der Zeit. Das Thema der Kriegsgefangenschaft war wieder modern geworden — es sei nur an Rad-vanyis zur gleichen Zeit gedrehten Film „Der Arzt von Stalingrad“ erinnert.
Mit der Gegenwart und der zeitgenössischen Gesellschaft beschäftigte sich nur sehr selten ein Film. Geschah es wirklich einmal, wie in einigen Filmen Harald Brauns, so hütete er sich sorgfältig, offenkundige Tabus anzutasten. Brauns „Gläserner Turm“ bewegte sich in den Niederungen der gängigen Klischees, die dieses Genre hervorgebracht hat. Ganz abgesehen von dem
üblichen psychologisierenden Dreieckskonflikt konstruierte Braun Gestalten, die gepflegtes Papier redeten und sich in der geschmacklosen Umgebung neudeutscher Prosperität bewegten. Brauns Filme hatten alles, was den heutigen deutschen Gesellschaftsfilm so flach und unbedeutend macht: die gepflegte Langeweile, die schwatzhafte Unverbindlichkeit, das konstruierte Milieu einer nicht existenten „besseren“ Gesellschaft, Scheinprobleme und dramaturgische Klischees, wie zum Beispiel das des Arztes, der im Mittelpunkt jedes besseren deutschen Gesellschaftsfilmes zu stehen hat.
An Versuchen, das Antlitz des Menschen unserer Zeit im Film zu zeigen, hat es insbesondere in der jüngeren Generation nicht gefehlt. Einer der ersten Regisseure, die nach dem Krieg ernsthaft nach neuen Wegen suchten, wurde der junge Wiener Herbert Vesely. Seine psychoanalytische Studie „Nicht mehr fliehen“ war ein interessanter Versuch, filmisches Neuland zu gewinnen. Leider war der Weg, den er eingeschlagen hatte, nicht gangbar. Trotzdem beschritten ihn Regisseure wie Ottomar Domnick mit „Jonas“ und Haro Senft mit seinen Kurzfilmen.
Erfolgreicher und für die Entwicklung eines realistischen und wahrhaftigen deutschen Filmstils wichtiger waren die Filme des Regisseurs Georg Tressler. In seinen „Halbstarken“ griff er mitten hinein in die Fülle der Gegenwartsprobleme und bekam eines der brennendsten in den Griff. Er verzichtete auf billige Effekte und zeigte die Not der modernen Jugend in harten Bildern. Konsequent ging er auf dem eingeschlagenen Weg weiter. Sein Film „Endstation Liebe“ wurde denn auch einer der ehrlichsten und sympathischsten, welche uns die deutsche Produktion in der vergangenen Saison anzubieten hatte. In diesen Tagen überraschte Tressler mit einem realistischen modernen Märchen. „Ein wunderbarer Sommer“ erzählt die rührende (nicht rührselige!) Geschichte von der Kuh Ludmila, die ihren armen Besitzern großen Kummer bereitet hatte und die plötzlich, wie durch ein Wunder, wieder Milch zu spenden beginnt. Georg Tressler ist eine Hoffnung für den deutschen Film.
Welchen Anteil der Mangel an fähigen Drehbuchautoren an der deutschen Filmmisere hat, bewies der vielberedete Film „Das Mädchen Rosemarie“ von Rolf Thiele. Thieles Kriminal-und Gesellschaftsfilme hatten sich bislang kaum über das übliche Niveau erhoben. Nun lieferte ihm der bekannte Journalist Erich Kuby („Was ist des Deutschen Vaterland?“) ein brauchbares Drehbuch oder hatte doch zumindest wesentlichen Anteil an der Herstellung eines solchen, und es entstand ein gesellschaftskritisches Kabinettstückchen, das trotz seiner kabarettistischen Töne besser ins Schwarze trifft als manch pseudorealistisches Drama zuvor. Dieser Film leistete etwas, das in der deutschen Filmgeschichte, ungewöhnlich rar ist/ er vetstarii::e“si eine ;,riefifige“, ' förderliche, ehrliche Absicht glänzend zu verkaufen. Er zeigte nicht, wie böse Zungen zuvor behauptet hatten, Zweideutigkeiten aus dem Leben der Frankfurter Lebedame Rosemarie Nitribitt, sondern nahm die D-Markschwere Kundschaft besagter Dame Unter die Lupe. Hier wurde sie einmal offenbar, die Hohlheit der „guten Gesellschaft“, die trübsinnigverkrampften Spaße, mit denen sie ihre tristen Parties aufzuheitern sucht, ihre Vergötzung des Geldes und der Irrglaube, Vertrauen und Zuverlässigkeit seien käuflich wie so vieles andere. Frisch und munter hieb und stach der Film so ziemlich alle Tabus an, die für den deutschen Film bisher gültig waren. Und den Leuten gefiel es. Sie füllen seit Wochen sämtliche Vorstellungen des Films bis zum letzten Platz im Rang und unterhalten sich vorzüglich.
Bonns Demarche war nicht der einzige Widerstand, den dieser Film zu überwinden hatte. Zuerst hatte der Wirtschaftsverband der Filmtheater Nordrhein-Westfalens „energisch protestiert“, sodann hatten die bayrischen Kinobesitzer feierlich verkündet: „Einen Film, der den Namen Nitribitt im Titel trägt, werden wir nicht zeigen.“ Als der Film abgedreht war, erhob eine Minderheit in der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) Einspruch: Der Film vermittle den Eindruck, so heißt es in der Begründung des Einspruchs, „als seien die gezeigten Mißstände in hohem Maße typisch und allgemein gültig für diese Gesellschaftskreise“ und unterlasse, zu zeigen, „daß es auch andere und positiv zu wertende Persönlichkeiten gerade in den Kreisen der Unternehmer gibt“. Eine Szene, in der die Bundeswehr durch die Straßen zog, mußte geschnitten werden. (Sie lief in Oesterreich ungeschnitten. — Die Redaktion.) Aus dem Vorspann mußten die Sätze gestrichen werden: „Was der Film schildert, ist unsere bundesdeutsche Wirklichkeit. Er übertreibt nicht, er untertreibt...“
Wie man aus diesem Beispiel ersehen kann, hat es ein gesellschaftskritischer Film nicht leicht in Deutschland, und man muß den Produzenten einräumen, daß sie derartigen Projekten Skepsis entgegenbringen. Immerhin kann man hoffen, daß der geschäftliche Erfolg von „Rosemarie“ in absehbarer Zeit eine ganze nonkonformistische „Schule“ im deutschen Film begründen möge. Es wäre ja denkbar, daß er wirklich den Verantwortlichen bewiesen hätte, daß gute Filme nicht eine Sache hoher Produktionskosten sind, sondern eine Sache guter Ideen, eines ehrlichen Anliegens und des Mutes zum Ungewöhnlichen.