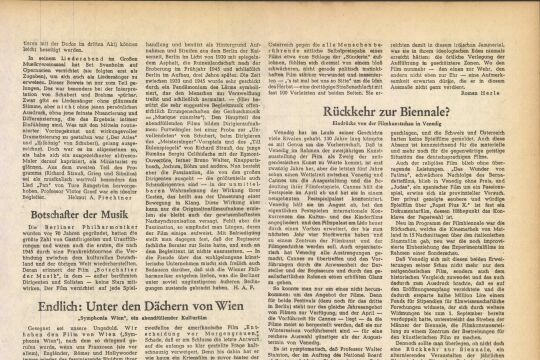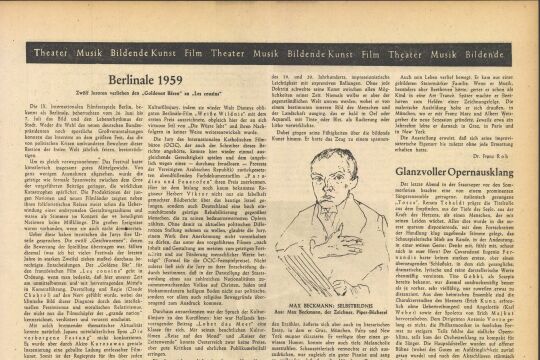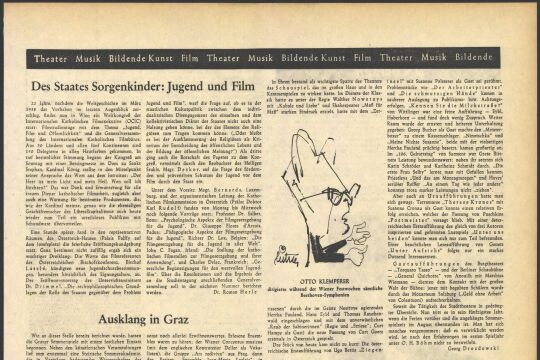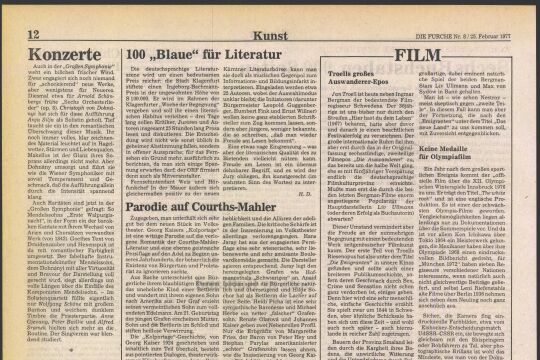Könnte dieser Bericht erfreulicher sein, so wäre man leicht versucht, anzunehmen, die Leitung des heurigen Filmfestivals von Cannes hätte glänzende Regie geführt und sich die Knalleffekte für den Anfang und das Ende ihrer Veranstaltung Vorbehalten. So neigt man aber fast zur Meinung, die Verantwortlichen seien sich nicht ganz bewußt gewesen, mit welch diabolischem Zündstoff sie ihr Festival aufluden.
Im Falle des polnischen Beitrages „Mutter Johanna von den Engeln“, der den Reigen der 31 in Konkurrenz laufenden Langfilme eröffnete, könnte sie nur ihr rein auf liberale Ästhetik ausgerichtetes Gewissen rechtfertigen Denn der polnische Episkopat hatte gegen die Aufführung dieses künstlerisch raffinierten, aber provokant antireligiösen Pamphlets ebenso protestiert wie die Katholische Filmzentrale Frankreichs. Davon unbehelligt, fand die teuflische, an Dreyer und Bergman geschulte Regiekunst von Kawalerowicz die fast einhellige Begeisterung der internationalen, speziell der französischen Kritik. So galt der Streifen auch bis zum letzten Tag als hoher Favorit für die „Goldene Palme“. Bis Bunuel mit dem spanischen Film „Viri- diana“ alle Berechnungen über den Haufen warf. Ich vermag nicht’ zu entscheiden, ob es die Angst vor der eigenen Courage oder die Anerkennung des Werkes Bunuels war, welche die Jury (in der die Darsteller Liselotte Pulver und Pedro Armen- dariz, die Regisseure Fred Zinnemann, Sergej Jutkewitsch, Edouard Molinaro und weitere fünf Mitglieder unter dem Vorsitz von Jean Giono vereint waren) letzten Endes bestimmte, zumindest einen halben ersten Preis diesem westlichen Parteigänger des Ostblocks für die unverkennbaren formalen Vorzüge seiner antikirchlichen Blasphemie zuzusprechen und den Polen mit einem Spezialpreis abzufinden.
Diese preisgekrönte Doppelattacke materialistisch-atheistischen Ungeistes mußte sogar das päpstliche Organ „Osservatore Romano“ zu einer scharfen Stellungnahme veranlassen. Ist es heute schon des höchsten Lobes würdig, wenn Gefühle von Millionen gläubiger Menschen in so eklatanter Weise verletzt werden? Wir erinnern uns anderseits sehr wohl, daß gerade in Cannes vor Jahren Filme nicht zur Konkurrenz zugelassen wurden, weil die Veranstalter fürchteten, damit das Mißfallen der Oststaaten zu erregen. Weiter als diesmal kann man — natürlich immer unter dem Deckmantel der demokratischen Meinungs- und Kunstfreiheit! — die Selbstaufgabe des Westens wohl nicht mehr treiben. An der Perle der Cöte d’Azur hat jedenfalls die kommunistische Ideologie heute einen festen, geistigen Stützpunkt.
Leider entzündete der von Dämonen, Teufeln und Lastern freie Mensch die Filmschaffenden nicht zu artistischen Höchstleistungen. Der Krone am nächsten kam wohl der französische Film „Noch nach Jahr und Tag“ („Une aussi longue. absence"), das Erstlingswerk des bisher nur als Filmschriftsteller und Cutter hervorgetretenen Henri Colpi, der den leisen,- seelischen Schwingungen seiner Drehbuchautorin Marguerite Duras („Hiroshima — mon amour“, „Moderato cantabile“) mit behutsamer Einfühlung folgte und seine Darsteller, Alida Valli und Georges Wilson, ebenso wie seinen Kameramann zu Glanzleistungen führte. So konnte sich Colpi immerhin mit Bunuel die „Goldene Palme“ teilen.
Der menschliche Reichtum, die echte Alltagsproblematik und das christliche Ethos einer Negerfamilie in dem amerikanischen ■Streifen „A raisin in the sun“ blieb leider völlig im Theaterhaften eines erfolgreichen Broadway-Stückes haften, entschädigte aber formal durch glänzende schauspielerische Leistungen eines Negerensembles, in dem allein der einzige Star Sidney Poitier abfiel. Wegen seiner menschlichen Werte erhielt der Film auch den neugeschaffenen — und beim Schlußabend noch mehr als die Auszeichnungen für Kawalerowicz und Bunuel akklamier- ten — Gary-Cooper-Preis.
Auch die Jury des „Internationalen Katholischen Filmbüros“ (OCIC), der der Schreiber dieser Zeilen angehörte, mußte den genannten Streifen in ernste Erwägung ziehen, verlieh ihren Preis jedoch dann mit knapper Mehrheit an einen anderen USA-Beitrag, „Der werfe den ersten Stein“ („The hoodlum priest“), der dem Wirken des Jesuitenpaters Clark gewidmet ist, mit folgender Argumentation: „Dieser Film stellt, auf wahren Begebenheiten beruhend, in dramatischer Form das Ringen eines Priesters um die Resozialisierung junger Sträflinge nach ihrer
Gefängnisentlassung dar. In wirkungsvoller Bildsprache trägt er zum Verständnis leidvoller Probleme in aller Welt bei und veranschaulicht ein Beispiel tätiger Nächstenliebe.“
Nach fünfjähriger Regiepause zeigte Vittorio de Sica — im Verein mit seinem ständigen Buchautor Cesare Zavattini — nur im Schlußdrittel seines Films „La Ciociara“ die erschütternde Kraft seiner neoveristischen Meisterwerke. Daneben gab aber dieses Drama einer Frau in den letzten Kriegstagen in Italien, die das grausame Geschehen um sie erst richtig begreift, als sie es am eigenen Leibe bitter verspüren muß, Sophia Loren, die Möglichkeit, in den Rang einer Tragödin von höchstem Format aufzusteigen. Mit Mißbehagen registrierte man in diesem Film aber die gemeinen Seitenhiebe auf Papst Pius XII.
Guy Green, der Regisseur von „Zorniges Schweigen", erwies sich auch in dem psychoanalytischen Drama „The mark“ (England) als ein Regisseur der Diskretion und Perfektion, der sogar die schauspielerischen Unmanieren von Maria Schell beträchtlich milderte und Stuart Whitman ebenso wie Rod Steiger Leistungen höchster Konzentration abverlangte, die — da offensichtlich gegen den Typ der beiden erreicht — mir mehr
preiswürdig Schienen als jene von Anthony Perkins.
Eine gelinde Enttäuschung bot Kon Ichikawa, der Schöpfer des Meisterwerkes „Die Harfe von Burma“. Die gegen Schluß an weiser Lebenserkenntnis und edlen Gefühlen wohl reiche Familiengeschichte „Ihr Bruder" hatte insgesamt einen mehr langen als heißen Atem. Noch größer war die Ernüchterung, die Lima Barreto, der Regisseur von „O Cangaceiro", mit der brasilianischen Produktion „Die erste Messe“ bot, in der das Thema einer Priesterberufung in ganz oberflächlicher und konventioneller Manier vertan wurde. Er gewann, wie auch einige andere wenig glückliche Regisseure, immerhin mit einem begabten Kind einige Sympathien.
Jenen Filmschöpfern, die sich Sigmund Freud als geistige Triebfeder erkoren hatten, gelang dies weniger. Mit ihm blieben der Schwede Alf Sjöberg zur Hälfte, der diesmal unter der
Flagge Zyperns mit internationaler Besetzung aufkreuzende Grieche Michel Cacoyannis zu drei Vierteln sowie ein norwegischer Kollege ganz auf der Strecke.
Da von Haus aus in Cannes jedes Land nur einen abendfüllenden Film nominieren kann, die Festivaldirektion aber die Möglichkeit hat, daneben Filme einzuladen, kam Italien wieder — unverdientermaßen, wie auch im Vorjahr in Venedig — zu vier Beiträgen, von denen der schon zitierte „La Ciociara“ immerhin der stärkste war. An den übrigen sind nur Bologninis
atmosphärische Regiekunst an dem thematisch untauglichen
Objekt „La Viaccia“, die erstaunliche schauspielerische Entwicklung Claudia Cardinales in „Das Mädchen mit dem Koffer“ sowie René Clements leider bald verpuffendes Brillantfeuerwerk auf dem ihm ungewohnten Gebiet einer politischen Satire („Che gioia vivere!“) positiv erwähnenswert, in negativer Hinsicht noch die antiklerikalen Affekte, mit denen die beiden letztgenannten Filme den östlich infizierten, glücklicheren Konkurrenten Schützenhilfe leisteten.
Amerika hatte als dritten Vertreter noch die François-Sagan- Verfilmung „Lieben Sie Brahms?“ vorzuweisen, und darin neben dem bereits erwähnten Anthony Perkins immerhin Schauspieler wie Ingrid Bergman und Yves Montand, die unter Anatol Litvaks glatter Regie virtuos durch die Untiefen der Modeautorin segelten. Immerhin schien die amerikanische Gesamtauswahl eher einer Auszeichnung wert als die italienische.
Warum Frankreichs zweiter Beitrag, der zwar farbenschöne, aber sonst recht herkömmliche und langweilige, daneben oft ungustiöse Neuguinea-Expeditionsfilm „Himmel und Schlamm“ war, schien nicht nur mir unverständlich; in den zahlreichen Vorführungen des „Internationalen Filmmarktes" in der Rue ä’Äntibes, wohin sich" das künstlerische Schwergewicht des Festivals immer mehr verlagerte, gab es, zumindest vier Filme des Gastgeberlandes, die eher Festspielehren verdient hätten.
Nicht minder schleierhaft erscheint, warum Rußland und Argentinien mit je zwei Beiträgen aufkreuzen konnten. Wie sehr politische Momente in Cannes immer die Juryurteile beeinflussen, zeigt die Verleihung des Regiepreises an die Witwe Alexander Dowschenkows für eine bis zur Lächerlichkeit verstümmelte, bis auf die Optik indiskutable Blut-und-Boden-Schwarte, mit viel primitiver Rhetorik über den „Vaterländischen Krieg“; einen Sonderpreis für die ausgezeichnete Farbphotographie hätte man allenfalls erwartet. — Der eigenwillige argentinische Außenseiter Leopoldo Torre-Nilsson erhielt den FIPRESCI-Preis; anscheinend ist er ein ähnliches Liebkind der Kritiker wie Ingmar Bergman oder Juan Antonio Bardem.
Was sonst noch an Langfilmen aus der freien Welt (Belgien, Griechenland, Israel, Holland) oder aus dem Ostblock (Ungarn, CSSR, Rumänien, Jugoslawien) kam. dürfte uns nie erreichen und war auch so unbedeutend, daß sich sogar die Anführung der Titel erübrigt. Zu ergänzen wäre noch, daß Deutschlands Festivalfilm „Der letzte Zeuge", in Österreich ja bereits bekannt, ein gelinder Durchfall wurde.
Auch das Niveau der Kurzfilme war insgesamt eher traurig. Die dafür zuständige Jury hatte es bestimmt nicht leicht, einem französischen Streifen den ersten und einem ungarischen einen Spezialpreis zuzusprechen.
Nicht einmal hier hatte Österreich etwas aufzuweisen. Immerhin konnte es an einer Nebenfront einen unerwarteten Erfolg erzielen. In einem gleichzeitig ablaufenden Wettbewerb der Eurovision wurde dem Streifen „Simplizissimus“ aus der Produktion von Rudolf Kammei (Drehbuch: Jörg Mauthe, Regie: Walter Davy) eine ehrenvolle Erwähnung zugedacht.
Als symptomatisch für die künstlerische Armut des heurigen Festivals galt die Tatsache, daß für die Abschlußveranstaltung ein Ballett an Stelle eines Films herangezogen wurde. Den Eröffnungsabend hatte — außer Konkurrenz — Otto Premingers Dreieinhalbstundenepos „Exodus“, auf das erst bei seiner Wiener Premiere näher eingegangen werden soll, ausgefüllt. Der anschließende Empfang, der dem Ex-Wiener vier Millionen alte Francs kostete, bewies ebenso wie die Fülle der folgenden Dejeuners, Cocktailparties und Mitternachtsempfänge, daß man jeden Gedanken an die schwere politische Krise Frankreichs verbannen wollte. Das Volk von Cannes und Umgebung feierte zumindest die Loren und die Lollobrigida heftig mit, sonst wurde ihm an Stars und vor allem an Starlets diesmal weniger geboten. Es hatte jedoch erstmalig die Möglichkeit, die Filme des Festivals jeweils am folgenden Tag in einem Kino der Stadt zu zivilen Preisen zu sehen.
„Das war das schlechteste Festival, das ich jemals erlebt habe!“ äußerten gegen Ende viele Kollegen, die Jahr für Jahr kaum eines versäumen. Für mich war es „erst“ das zehnte, aber dieses kleine Jubiläum war durchaus kein Grund zu freudigem Feiern. Das einbrechende Schlechtwetter, der Streik der Eisenbahn, der Gas- und Elektrizitätswerke machten einem den Abschied von Cannes noch leichter.
Berlins verdienstvoller Festspielleiter Dr. Bauer erzählte mir in Cannes, daß er für sein Festival bessere Filme hätte. Er wird es nicht schwer haben, diese Prognose wahrzumachen.