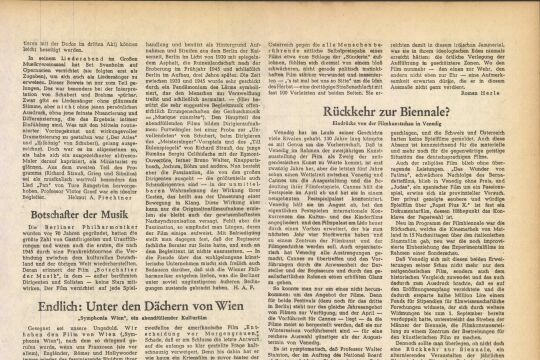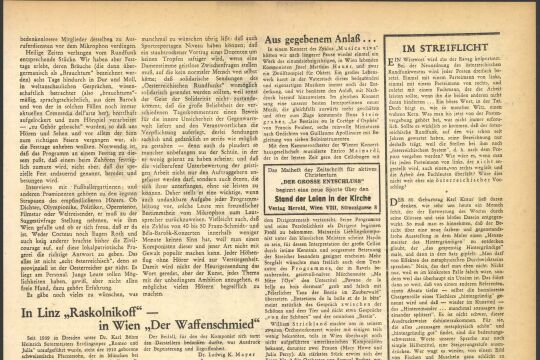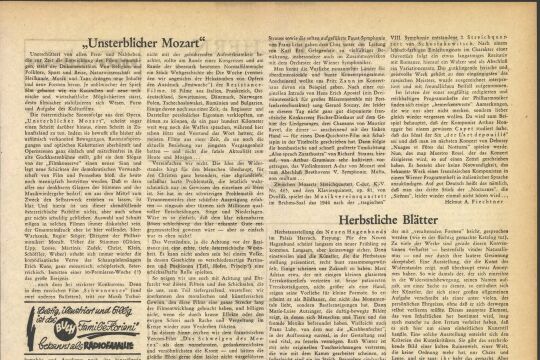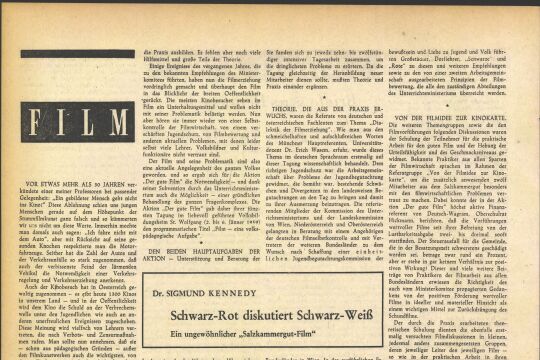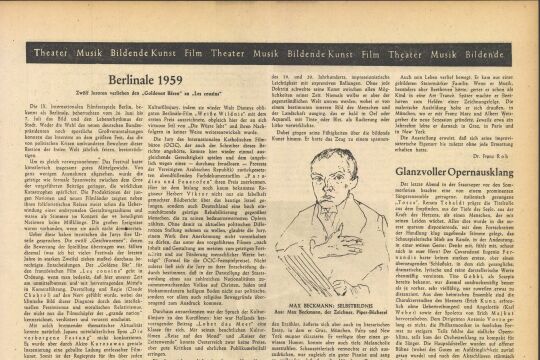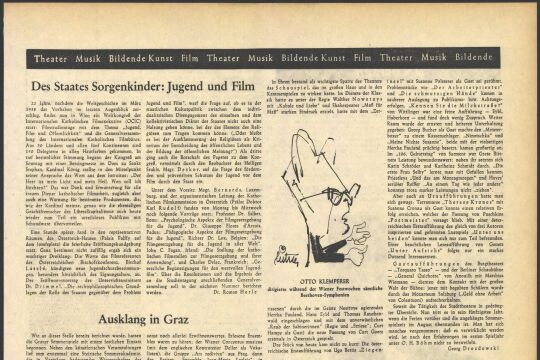Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
IM ZEICHEN DER MAUER
Mit gleichbleibender Herzlichkeit werden alljährlich Hunderte von ausländischen Journalisten und prominenten Filmschaffenden an die vielzitierten Gestade der Spree zu einem Festival der siebenten Kunst eingeladen, das für die Veranstalter und Millionen von Berlinern mehr ist als nur eines der üblichen Treffen der internationalen Repräsentanten der Leinwandkunst.
Und es zeugt schon von einer großen Portion. Unverständnis gegenüber der besonderen Situation der Berliner Filmfestspiele, daß viele dieser prominenten Gäste sich immer wieder darüber mokieren, wenn zu Beginn oder Abschluß dieser Veranstaltungen der Regierende Bürgermeister oder sein Stellvertreter eine mit politischen Schlaglichtern durchsetzte Rede hält. Für die Menschen, die mit einem bewundernswerten Maß von Optimismus und Selbstvertrauen in dieser täglich an ihrer Freiheit bedrohten Enklave leben, vollziehen sich eben alle Äußerungen ihres Daseins, mögen es Feste oder ernste Anlässe sein, stets nur unter dem Aspekt dieser widernatürlichen Trennung einer Stadt und ihrer Bewohner. Kein Wunder also, daß diese Menschen bei einer solchen Gelegenheit, da ein so internationales Forum in ihren Mauern weilt und Augenzeuge dieser unvorstellbaren Zustände ist, auch davon reden, was sie bedrückt. Gerade Gäste, die aus der Freizügigkeit und Freiheit demokratisch regierter Länder kommen, sollten doch angesichts dieser mörderischen Mauer, die Millionen engster Familienbande zerstört, Verständnis dafür haben, daß es hier einiger Worte mehr bedarf als bei den Festivals in Cannes oder Venedig, wo das Spielen der Nationalhymnen und die traditionellen Ministerworte „Ich erkläre die Festspiele für eröffnet“ durchaus genügen. Zumal viele dieser Kritiker nichts dagegen einzuwenden haben, wenn ihnen bei harmlos getarnten Filmcocktails im ostzonalen Künstlenestaurant „Möwe“ viel weitergehende politische Injektionen verabreicht werden.
Das Jubiläum der XII. Filmfestspiele, das rund um die Gedächtniskirche zwischen Kurfürstendamm und Zoo abrollte, stand im Schatten dieser Mauer. Es fehlten die Besucher aus Ost-Berlin und der Zone, die in den vergangenen Jahren mit Freude diesen Anlaß genutzt hatten, um in ihren von Aufmärschen und politischen Kursen reglementierten trüben Alltag etwas von dem internationalen Glanz und dem freieren Atem dieser Festspielwochen hineinzutragen.
Dabei war heuer das Aufgebot an attraktiven Stars und Persönlichkeiten kaum geringer als in der Vergangenheit. Nur rollte diese Beteiligung von Künstlern, wie James Stewart, Dolores del Rio, Gina Lollobrigida, Sir Alec Guiness, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Cassel und Francois Truffaut, den profiliertesten Vertretern der französischen „nouvelle vague“, nicht als riesiger Publicityrummel ab, sondern präsentierte sich als seriöser Dekor, in den sich auch die heimischen Stars, wie Ruth Leuwerik, Maria Schell nebst Bruder Maximilian. Barbara Rülfing, Nadja Tiller und Walter Giller, mit dem erfolgreichen Nachwuchs einer Loni von Friedl und Vera Tschechowa dezent einordneten. Für den am Metier „Film“ ernsthaft Interessierten ist es jedenfalls erfreulich, zu konstatieren, daß die Filmfestivals allmählich von Skandalgeschichten jeglicher Art frei werden. Er wird es nur bedauern, daß leider das künstlerische Niveau der gebotenen Filme nicht im reziproken Maße zu diesem begrüßenswerten Rückgang emporschnellt.
Auch das Jubiläum in Berlin, das in offizieller Konkurrenz einen Querschnitt durch 62 Spiel- und Kurzfilme aus 36 Ländern ermöglichte, konnte den Eindruck einer international verbreiteten schleichenden Filmkrise in geistiger und wirtschaftlicher Hinsicht nicht auslöschen. Besonders deutlich wurde dies heuer bei den Filmen aus dem südamerikanischen Raum, der uns in der Vergangenheit manche beachtenswerte Überraschung bereitet hatte. Völlig indiskutabel vom Thema“und vor allem von ' der Gestaltung her war der brasilianische Beitrag „Die Skrupellosen“. Es ist eben ein gewaltiger Unterschied, wenn ein Ingmar Bergman aus seiner gesamten künstlerischen Konzeption heraus mit wilder Realität eine Vergewaltigungsszene zeigt, wie in seiner „Jungfrauenquelle“, oder nur mit dem Schielen auf die niedersten Instinkte und den damit erhofften finanziellen Profit ein solches Thema, noch dazu von einem dilettantischen Regisseur, angepackt wird.
Auch die beiden begabten argentinischen Schauspielerinnen Mirtha und Silvia Legrand konnten in dem Streifen „Die Schwestern“ die mit erhobenem moralischem Zeigefinger produzierte Langeweile keineswegs ausmerzen. Zudem ist diese mit einem Mord beginnende Lebensgeschichte von der Nonne Elisabeth und dem Mannequin Ines, diesen ungleichen Zwillingen, im Stil einer billigen Kolportage erzählt, die auf einem Festival wenig zu suchen hat.
Ein Vorwurf, den man leider auch dem deutschen Beitrag, „Die Rote“, unter der Regie von Helmut Käutner und mit Ruth Leuwerik, Rossano Brazzi, Giorgio Albertazzi und Gert Fröbe in den Hauptrollen, nicht ersparen kann. Doch ist dieses jüngste Werk Käutners nicht so sehr an seinem Thema, das dem gleichnamigen Roman von Alfred Andersch entnommen ist, gescheitert, sondern an der zuweilen haarsträubenden Banalität der Dialoge. Überdies wurde hier die neueste „Creation“ der Filmgestalter, die Handlung durch die „innere Stimme“ der einzelnen Figuren — also ihre geheimen Gedanken zu der jeweiligen Situation — voranzutreiben, zu Tode geritten.
Dagegen ließ ein Jean Renoir in seinem Film, „Le Caporal Epingle“, der fast zur Gänze in Wien entstanden ist, erfreulich die Pranke seiner alten Meisterschaft spüren. Diese von Dramatik und burleskem Humor erfüllten Gefangenenerlebnisse aus dem zweiten Weltkrieg, bei deren Wiedergabe sich vor allem Jean-Pierre Cassel, Claude Brasseur und Claude Rieh auszeichneten, waren erfüllt von der gleichen Realität und inneren Wahrhaftigkeit, die auch dem hervorragenden englischen Film „Nur ein Hauch Glückseligkeit“ mit Recht den Goldenen Bären als beste Leistung einbrachte. Daß damit zugleich auch bisher unbekannter Nachwuchs — sowohl der Regisseur John Schlesinger wie auch die Hauptdarsteller Alan Bates und June Ritchie machten ihren ersten Film — für eine aus Ambition und Können gewachsene Tat belohnt wurden, übergoß den Abschluß dieser Jubiläumsfestspiele mit einem Hoffnungsschimmer. Denn schon in Cannes hatten ähnliche junge Film-Briten mit „Bitterer Honig“ eine von ansprechendem poetischem Realismus erfüllte Visitenkarte abgegeben.
Osterreich, wenn auch nur mit einem Kurzfilm offiziell beteiligt, war diesmal verschiedentlich und erfolgreich im Munde der Festspielöffentlichkeit. Zum erstenmal seit der Verleihung der Bundesfilmpreise wurden auch die Verdienste prominenter Künstler um den deutschen Film gewürdigt. Hier waren es Hans Moser und Rudolf Forster, die zusammen mit Lil Dagover, Olga Tschechowa und Paul Henckels mit dem Filmband in Gold geehrt wurden. Aber auch unter den Trägern des Bundesfilmpreiaes 1962: war ein Österreicher. Der junge Wiener Filmarchitekt Otto Pischinger wurde für seine bührienbild-nerische Leistung in dem Film „Das Wunder des Malachias“ ebenfalls mit dem Filmband in Gold ausgezeichnet. Daß ferner der interessante Experimentalkurzfilm „Venedig“ von Kurt Steinwendner, der, von Walter Tuch ausgezeichnet Photographien, die Dogenstadt im farbigen Spiegel ihrer Kanäle zeigt, einen Silbernen Bären erhielt, war ein weiterer schöner Erfolg für die österreichischen Farben. Schließlich dokumentierte die schon zu einer kleinen Tradition der Berlinale gewordene österreichische Kulturfilmmatinee mit erfreulich starker Publikumsresonanz, daß Österreich auf dem Gebiet des Kultur- und Dokumentarfilms international Sehenswertes zu bieten hat. Wir können also diesmal über den Widerhall der mit sehr bescheidenen Mitteln durchgeführten Beteiligung Österreichs an diesem weltweiten Filmtreffen sehr zufrieden sein.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!