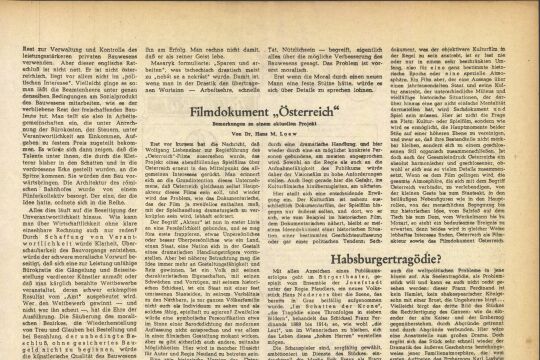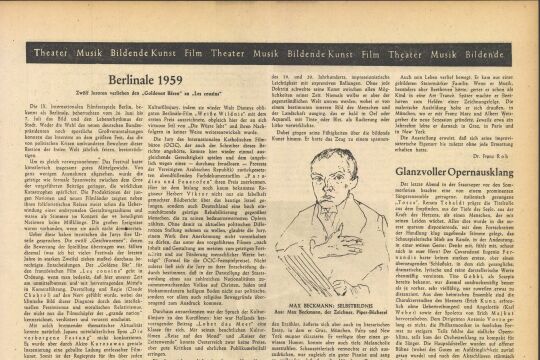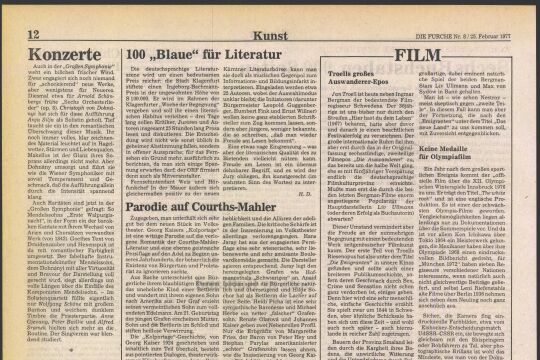Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Geschichte frontal
Es gehört beinahe schon zum guten Ton, bei wichtigen Filmfestivals neue Tendenzen der Filmkunst zu orten. Die 46. Internationalen Filmfestspiele von Berlin sind allerdings anders gewesen. Es gibt keine neuen Trends. Es gibt nur viele neue Filme. Und eine leicht verwirrte Kritikerschar.
Auch wenn mit Stars wie Julia Roberts oder Jack Lemmon das Festival seinen Glanz erhielt, war das US-amerikanische Kino nicht so dominierend vertreten wie die vergangenen Jahre. Diese Zurückhaltung dürfte wohl eine Folge jahrelanger, teils heftiger Kritik am auffallenden Naheverhältnis zum amerikanischen Filmmarkt sein. Und es gibt auch andere, neue Filmmärkte. Filme aus China, Taiwan, Hongkong oder Japan konnten sich in Europa - vornehmlich aus kommerziellen Gründen -bisher noch nicht durchsetzen. Wohl aber bei internationalen Festivals wie hier in Berlin. Diese asiatische Präsenz hat sich heuer noch verstärkt.
Eine weitere Erkenntnis, die man diesmal in Berlin gewinnen konnte: Um den europäischen Film ist es noch ruhiger geworden, sieht man von den nordischen Ländern, speziell von Dänemark ab. „Portland", ein Film des 35jährigen Dänen Niels Arden Oplev, war überhaupt eine der ganz wenigen jungen Stimmen im Wettbewerb, die auch präzise von der Gegenwart sprachen.
„Wir Europäer sind besessen davon, immer nur in die Vergangenheit zu schauen und schaffen es nicht, Filme über unsere Realität zu machen", sagte Regisseur Karl Francis bei der Pressekonferenz zu seinem neuen Film „Streetlife", einer aufwühlenden Geschichte über eine Frau, die wegen der Männer letztlich zur Mörderin ihres Babies wird.
Abgesehen von diesen beiden Beispielen hat es den Anschein, als ob sich die Filmkunst speziell in Europa nicht von einer vergangenheitsbesetzten Zeitgeschichtsbetrachtung lösen könne. Oder mit dieser kokettiert. Als gäbe es kein Bosnien, als hätte es den gesamten Balkankrieg nicht gegeben, der hier in Berlin so gut wie gar nicht zur Sprache kam. „Karwoche" nennt Andrzej Wajda seinen Film über das Schicksal der Jüdin Irina Lilien, die in der Karwoche unter dramatischen Umständen aus dem Warschauer Ghetto fliehen kann. Der Holocaust scheint Wajda mehr als Material für Manierismen zu dienen. Ein Vorwurf, den man übrigens auch Michael Ver-hoeven für seinen neuen Film „Mut-ters Courage" machen muß. Dieser Film, der mit österreichischer Unterstützung realisiert werden konnte, erzählt vom Schicksal Elsa Taboris. Ihr Sohn, George Tabori, wirkte bei diesem Film selber mit. Viel Beachtung fand Egon Humer für „Emigration, N. Y.", in dem zwölf Emigranten über ihre Kindheit in Österreich, über ihre Vertreibung aus der Heimat und die Suche nach einer neuen Identität sprechen.
Geschichtsunterricht der nicht ganz unbekannten Art vermittelte Oliver Stone mit „Nixon". Nicht, daß man Stone, der ja sein politisches Engagement bereits in Filmen wie „Born on the fourth of July" oder „JFK" bewiesen hat, nicht abnehmen würde. Die Frage ist nur, ob der manchmal doch plakativ geratene ci-neastische Frontalunterricht historische Tatsachen neu zu interpretieren imstande ist.
Bei einer Reihe von Filmen aus Asien macht sich eine gewisse Unsicherheit dem westlichen Publikum gegenüber bemerkbar. Nicht anders läßt sich das Schielen auf amerikanische Stereotypen des Filmemachers erklären. „Ri Guang Xia Gu" (Tal der Sonne) von He Ping beispielsweise ist ein von den Bildern her gesehen makelloser, beeindruckender Film. Er könnte allerdings auch ein Italowe-stern sein. Die Musik ist eindeutig auf dieses Genre hin komponiert, die Cowboys reiten wie in allen Paramo-unt-Produktionen durch die Prärie -allerdings in China. Oder „Tai Yank You Er" (Die Sonne kann hören) ist die chinesische Variante von „Ein unmoralisches Angebot". Die Frage stellt sich, ob es gerade die genannten Beispiele sind, die einem westlichen Publikum chinesische Originalität näherbringen.
Ein Höhepunkt des Wettbewerbes war Tim Robbins zweite Regiearbeit, „Dead Man Walking", kein Film gegen, sondern über die Todesstrafe. „Dead Man Walking" rufen die Gefängniswärter in den USA den Todeskandidaten auf ihrem letzten Weg zur Hinrichtung zu. Nüchtern distanziert wird der Täter (Sean Penn) geschildert und in Rückblenden seine Taten: Vergewaltigung eines Mädchens und das Abschlachten eines Pärchens. Angesichts seiner Hinrichtung wünscht sich der Täter noch das Gespräch mit einer katholischen Nonne (Susan Sa randon). Der Film nimmt keine Posi tion zur Todesstrafe ein, er erzählt aus einer Halbdistanz und hat es auch fast nie nötig, an Emotionen zu appellieren. Trotz der wichtigen Rolle der ka tholischen Nonne in diesem Film nimmt Tim Robbins keine christliche Position ein, viel lieber ist ihm der Be griff „Humanist".
In der Hand gehabt hätte es Ferid Boughedir mit „Un Ete ä la Goulet te" (Ein Sommer in la Goulette), das unproblematische Zusammenleben von Christen, Juden und Muslime in Tunesien zur Zeit des Sechstagekrie ges der Israelis zu zeigen. Leider ist die wunderschöne Geschichte der Liebe dreier Mädchen zu ihren Freunden ei ner vielleicht mißverstandenen Leichtigkeit zum Opfer gefallen.
Teilweise umstritten waren die Entscheidungen der internationalen Jury: Den Goldenen Bären errang „Sense and Sensibility" (nach Jane Austens Bomanvorlage), ein Silberner Bär ging an Andrzej Wajda für „Karwoche", als bester männlicher Hauptdarsteller wurde Sien Pen („Sense und Sensibility") ausgezeichnet. Der ökumenischen Jury dürfte die Wahl mit der Auszeichnung von „Dead Man Walking" nicht schwer gefallen sein.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!