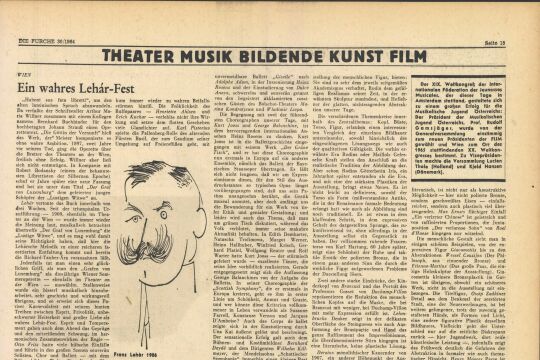Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Spitzenfilmer
Federico Fellini, Altmeister des Kinos, meinte einmal über die Intentionen seines Schaffens: „Ich mache Filme, weil es mir Spaß macht, Lügen zu erzählen und Märchen zu erfinden.“ Das Gesamtwerk des Regisseurs stand als eine vom österreichischen Filmmuseum veranstaltete und bis 4. April laufende Retrospektive am Programm der diesjährigen „Viennale“ (13. bis 25. März). Eigentlicher Schwerpunkt des Festivals war mit mehr als vierzig Beispielen „Made in Britain“ -der britische Film von 1985 bis heute, die bisher weltweit größte Schau dieser Art. Damit reagierte man — so „Viennale“-Chef Hel-muth Dimko - auf das hierzulande kaum bekannte, vielzitierte britische Filmwunder.
Fellinis Klassiker sind dagegen, wenn auch gern gesehen, hinlänglich bekannt, das Novum dabei war eine Ausstellung seiner Zeichnungen, eine Präsentation faszinierender Menschendarstellungen, nach denen der Maestro die Charaktere, die, wie er sagt, „menschliche Landschaft des Films“ auswählt.
Wenig Anlaß zur Freude bot im Rahmen der „Viennale“ das groß angekündigte „Konzert der italienischen Filmmusik““ mit einem schlecht disponierten ORF-Symphonieorchester unter Riz Orto-lani, der selbst ein hervorragender Filmkomponist ist. Ortolanis Frau, Katyna Ranieri, sang dabei unter anderem die Lieder Nino Rotas, der die Musik zu den meisten Fellini-Filmen schrieb, und machte aus berührenden Liedern kitschige Schnulzen. Das hinderte aber keineswegs die Selbstbeweihräucherung der Beteiligten — „Viennale“ und ORF - für das Zustandekommen des Konzertes.
Ehrlicher Respekt gebührt hingegen den Verantwortlichen für die Zusammenstellung der Filmschau „Made in Britain“ als Ge-
Spngewicht zu künstlerisch hochwertigen Produktionen aus konventionellen Filmländern wie den USA und Japan, das noch immer als Exote gilt. Wiewohl für Normalsterbliche diese unzähligen Kilometer Filmrollen nicht zu bewältigen waren, zumal neben dem Hauptprogramm in der Urania ein Uberblick amerikanischer Teenagerfilme unter dem beziehungsvollen Titel „Kids in America“, und im Movie-Kino als Rahmenprogramm nur Schottisches, nämlich die Filme des großartigen Komödienregisseurs Bill Forsyth, liefen.
Selbst beim Cineasten verursachte das katastrophal dicht gedrängte Programm Übermüdung, Lustlosigkeit und Augen wie Breitwand-Supercolor Filme. Erstrebenswert wäre, wenn die „Viennale“ in Hinkunft etwas länger dauern könnte, manche Vorführungen begannen erst gegen Mitternacht. Abgesehen von solchen organisatorischen Schwächen war das künstlerische Angebot äußerst vielfältig und hochwertig.
Die Vorgeschichte des Schwerpunkts „Britischer Film“ reicht bis in die englische Kino-Flaute der siebziger Jahre zurück. Erst Hugh Hudson leitete im Jahr 1982 mit dem mit vielen Oscars gekrönten Sportlerdrama „Die Stunde des Siegers“ eine Renaissance ein. Schon im Jahr darauf feierte Richard Attenboroughs Epos „Gandhi“ Erfolge bei Kritik und Publikum. Die Abhängigkeit der Briten vom US-Markt macht oft einen Vorverkauf der Rechte an US-Verleihfirmen notwendig. Im eigenen Land geht die neuerliche Blütezeit des britischen Films vor allem auf das Konto des vierten Fernsehkanals „Channel 4“ und des „British Film Institute“. Ersterer ermöglicht unabhängige Produktionen, da er Projektaufträge vergibt und somit aufstrebenden Talenten die Chance gibt, ihr Können zu beweisen.
„Made in Britain“ zeigte hauptsächlich Filme jüngerer Regisseure, die zum Teil mit geringen Budgetmitteln finanziert wurden. Sie sind sozial engagiert, kritisch, avantgardistisch und experimentell, aber auch „nur“ witzig und unterhaltsam. Sie befassen sich häufig mit dem Thema Jugend im Umfeld eines pessimistisch gezeichneten England. Der wohl am schwierigsten zu verstehende Regisseur dieser Generation ist Derek Jarman. Er erzählt oft keine Inhalte, sondern zeigt diffuse Bilder und experimentiert mit Video.
Stephen Frears, einer der wichtigsten britischen Regisseure, der etwa mit der amüsanten Homosexuellenkomödie „Prick Up Your Ears“ bei Cineasten reüssierte, zeigte seinen neuesten Film „Sammy And Rosie Get Laid“. Weder in der Gestaltung noch inhaltlich ein Meisterwerk, schwelgt er in stimmungsvollen und melancholischen Einstellungen. Frears kritisiert hier Margret Thatchers konservatives England voller sozialer Mißstände und Unruhen. Ganz anders bläst Peter Richardson mit seiner grotesk überzeichneten und makabren Farce „Eat the Rieh“ ins gleiche Horn. Als amüsante Karikatur gedacht, entpuppt sie sich letztlich als reichlich ungustiöser Aufruf zur Anarchie, da die Armen die Reichen verspeisen.
Soziale Mißstände schildert „Rita, Sue And Bob Too“ von Alan Clark besonders eindringlich, obwohl es vordergründig um die amüsant dargestellte sexuelle Beziehung eines biederen Ehemannes zu zwei pummeligen Teenagern geht. Probleme heranwachsender Jugendlicher zeigt auch der einfühlsame Streifen „Gregory's Girl“ von Bill Forsyth, und einer der besonders witzigen Filme des Festivals, „Withnail And I“ von Bruce Robinson, erzählt die Geschichte einer Freundschaft zweier junger arbeitsloser Schauspieler.
Alle diese Filme zeichnen sich auch durch geistreiche Dialoge aus. Darüber hinaus basieren auch kommerziell ausgerichtete Werke, wie der mitreißend spannende Agententhriller „Defense Of The Realm“ von David Drury und „Testimony“ von Tony Palmer, eine mit subtilen Bildern gestaltete Biographie des russischen Komponisten Dimitrrj Schostakowitsch (1906 bis 1975) auf geistreichen Drehbüchern.
Richard Attenboroughs „Cry Freedom“ prangert die Apartheid-in Südafrika an, ist zweifelsohne sehr dramatisch, bedient sich allerdings kassenträchtiger Versatzstücke einer für Südafrika unglaubwürdigen Romantik.
Die bittere Wirklichkeit einer Behinderten zeigte dagegen der US-Film „Gaby - A True Story“ von Luis Mandoki. Große schauspielerische Leistungen machen das sehr menschliche, berührende, aber nicht schmalzige Drama zu einem Ereignis, wie dies in ganz anderer Weise der Film „Anna“ von Yurek Bogayevicz ist — die Geschichte einer alternden Schauspielerin. Die Liste der sehenswerten nicht-britischen Filme ließe sich noch beliebig lang fortsetzen.
Ein äußerst trauriges Kapitel dieser Film-Festspiele stellte der österreichische Film dar, der nur einmal (!) im Programm vertreten war, und zwar mit Karin Brandauers „Einstweilen wird es mittag“, gedreht nach der sozialpsychologischen Studie ,-,Die Arbeitslosen von Marienthal“ aus dem Jahre 1933. Die Stillegung einer Fabrik macht ein ganzes Dorf betroffen und arbeitslos, weltfremde Wissenschafter untersuchen das Verhalten der Bevölkerung. Brandauers Film ist aktuell und realistisch, aber aufgrund eines zerdehnten Handlungsablaufes und schwacher Schauspieler eher enttäuschend. Zum Teil erschreckend laienhaft inszenierte Kurzfilme junger Österreicher im Vorprogramm runden das Bild vom künstlerischen Tief der heimischen Filmbranche ab.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!