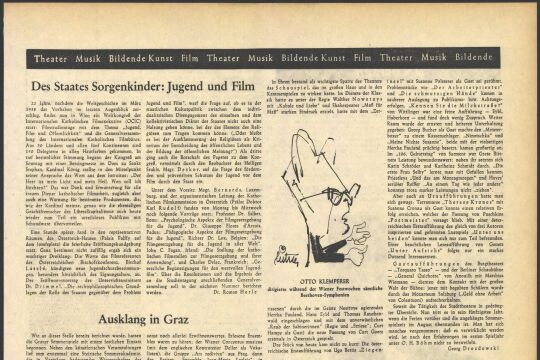Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Sex, wie sie ihn träumen
Berlin ist schon von jeher der Nährboden extremistischer Regungen verschiedenster Richtungen gewesen. Gerade die in jüngster Vergangenheit heftig aufflammenden Studenienunruhen waren auch nicht dazu angetan, die Verantwortlichen der XVIII. Internationalen Filmfestspiele an der Spree in eine Atmosphäre ungetrübter Sicherheit eines störungsfreien Verlaufs ihrer filmischen und gesellschaftlichen Veranstaltungen zu wiegen. Zudem deuteten der Abbruch des Festivals von Cannes sowie die leidenschaftlichen Auseinandersetzungen und Zusammenstöße in Oberhausen und Pesaro auf Sturmzeichen am internationalen Filmhimmel, die sich auch über Spree-Athen hätten zusammenballen und entladen könnten. So schwebte eigentlich von Anbeginn eine Art nervöser Hochspannung über diesem Rendezvous der internationalen Filmwelt, die erst dann einem befreiten Aufatmen wich, als der Vorhang nach dem letzten Festspielfilm — er stammte von Orson Weltes — gefallen war, ohne daß es besondere oder gar handgreifliche Eklats während dieser zwölf Tage gegeben hätte: Der Geruch der Stinkbombe von der Eröffnungsparty war inzwischen längst verflogen, und die paar faulen Eier, die anläßlich einer Diskussion zwischen deutschen Jungfilmern und Studenten statt konstruktiver Argumente durch die Luft schwirrten, waren gerne vergessen worden. Man schmunzelte höchstens darüber, daß gerade einer der heftigsten Verfechter eigenwillig-modernen Filmschaffens, Enno Patalas, von einem dieser Wurfgeschosse getroffen worden war.
Statt Tumulten, Schlägereien, Beschimpfungen aber gab es mehr denn je Diskussionen. Bald galten sie einer zukünftigen Umgestaltung des Festivals, bald hatten sie den Film selbst und seine Möglichkeiten zum Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Wobei sich zeigte, daß viele der jugendlichen Kritiker weniger über konstruktive Pläne und Konzepte verfügten, sondern viel eher um der Opposition selbst willen agierten und die'Gelegenheit benutzten, um ihren linksorientierten, zuweilen etwas unklaren politischen Standpunkt zu vertreten. So warfen sie zum Beispiel einer Gruppe von Münchener Jungfllmern, die man wahrlich nicht als reaktionär bezeichnen kann, ein „linkes Establishment“ vor und kreideten es ihnen an, daß sie sich „in die Abhängigkeit und die ideologische Umklammerung der Filmindustrie“ begeben hätten. Angeblich fehle ihnen jedes Verständnis für das radikaldemokratische, auf die gesellschaftliche Basis zielende Bewußtsein der Studenten. Es ginge ihnen nur um bessere Filme.
Angesichts solcher politisch gefärbter Phrasen, von denen «s noch viele während der Berlinale zu hören gab, kann man nur die Frage auf werf en: „Ja, worum geht es den Filmschaffenden der Welt?“ Doch nur darum, bessere Filme zu machen.
Das qualitativ unterschiedliche Programm der XVIII. Berlinale aber bot einen Querschnitt durch das internationale Filmschaffen, in dessen Thematik die Entschleierung des Sexuellen und die Schilderung der Gewalt einen immer breiteren Raumeinnehmen: Sex, wie sie ihn verstehen, Sex, wie sie ihn träumen…
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, waren es international kaum bekannte und zumeist junge Regisseure, deren Aussagen zwölf Tage lang die Leinwand des Zoo-Palastes und der anderen Festspielkinos rund um die Gedächtniskirche beherrschten. Den Anfang machte ein 35jähriger Kanadier, Don Owen, der sich thematisch eines menschlichen Sonderfalles bemächtigt hatte, um daran die innere Unsicherheit und seelische Zerrissenheit unserer Zeit zu zeigen. „Ernie, der Traumtänzer"ist ein aus einer Nervenheilanstalt entlassener Wirrkopf, der bei Frauen ebenso spielerisch sein Glück versucht wie im Beruf. Bald hält er sich für ein Genie, bald für einen Heiligen. Er lügt, stiehlt und baut sich eine Phantasiewelt, die mit der Ordnung und Gesetzmäßigkeit seiner normalen Umgebung permanent in Widerspruch gerät. Am Ende aber, da der negative Held im Selbstmord den Ausweg aus seinem Dilemma sucht, fragt man sich, welche Aussage dem Regisseur dieser teils grotesken, teils unheimlichen Phantasterei wohl vorschwebte.
Sexualität in vielen Abarten bis zur Darstellung sado-masochistischer Perversion bot der japanische Regisseur Susumi Hani mit seiner Gattin als Hauptakteurin in dem Film „Das Mädchen Nanami“. Er erzählt darin die Geschichte eines Photomodells in seiner Begegnung mit einem erotisch schon seit seiner Kindheit durch seinen Stiefvater verdorbenen jungen Mann. Dieser vielfältige Strauß sexueller Abreaktionen wird dann noch mit dem Schleier des angeblichen Erwachens einer ersten Liebe umhüllt.
Wenig zu überzeugen vermochte einen auch der polnische Regisseur Andrzej Wadja mit seinem ersten im Westen — in England — entstandenen Werk „Pforten zum Paradies“, bei dem er wieder, wie bei seinen enttäuschenden „Legionären“, zu einem historischen Stoff griff. Diesmal setzte er den Roman seines Landsmannes Jerzy Andre- zejewski über den Kinderkreuzzug aus dem 13. Jahrhundert mit großem Aufwand und theatralischem Pathos in Szene. Daß er die Ursachen für jenen hysterischen Massenwahn mit Minderjährigen-Sex und päde- rastischen Einflüssen der jugendlichen Anführer in Verbindung brachte, wirkte eher peinlich als verständlich. An diesem Empfinden änderte auch die Tatsache nichts, daß er schließlich diesen Kreuzzug als verantwortungslos und unmenschlich kennzeichnete.
Dagegen bannte der Franzose Alain Robbe-Grillet eine nicht leicht durchschaubare Parabel von der Austauschbarkeit der Schicksale in seinem Film „Der Mann, der lügt“ auf die Leinwand. Erinnerungen an Krieg und Resistance spielen in dem mit vielen Rückblenden durchsetzten Lebensbild aus einer wirren Zeit eine entscheidende Rolle. Man hielt sich vor allem auch an die hervorragende schauspielerische Nuancierung, die Jean-Louis Trintignant der Gestalt des Boris Varissa, einer Mischung von Don Juan und Münchhausen, angedeihen ließ. Wofür er mit Recht als bester Schauspielerdes Festivals ausgezeichnet wurde. Überhaupt waren die Franzosen mit fünf offiziellen Wettbewerbsbeiträgen rein zahlenmäßig die am stärksten vertretene Nation dieser Berlinale. Gar nicht revolutionär zauberte dabei der einstige Avantgardist Claude Chabrolmit „Zwei- Freundinnen“ ein anfangs zart lesbisch getöntes Abenteuer, in gepflegtester Umgebung zwischen Paris und St. Tropez pendelnd, auf die Leinwand, bei dem Stephane Audran mit wunderschönen Augen und Jacqueline Sassard voll mädchenhafter Herbheit seinen Intentionen adäquate Helfer waren.
Monströs und abstoßend, als Anarchist und Weltverächter, der allen menschlichen Regungen mit ätzendem Hohn begegnet, gebärdete sich wieder Jean-Luc Godardin seinem mit großem Aufwand inszenierten „Weekend“. Neben eindringlichen Passagen, wie zum Beispiel über die Autoraserei, stehen Szenen absoluter Geschmacklosigkeit, die zum Teil so widerwärtig und undelikat waren, daß sie noch während der Vorstellung lautstarken Widerspruch der Zuschauer heraufbeschworen.
Orson Welles aber formte in „Stunde der Wahrheit“ als Regisseur und Hauptdarsteller, mit Jeanne Moreau an seiner Seite, ein Kammerspiel über Macht und Ohnmacht des Reichtums, das thematisch oft hart an der Grenze der Sentimentalität eines Fünfkreuzerromans entlangglitt und nur durch die darstellerische Virtuosität Plastik und Intensität gewann.
Harte Realität, auf authentischen Unterlagen basierend, boten die Italiener mit den Filmen „Banditen in Mailand“ von Carlos Lizzani und „Der Tag der Eule“ von Damiano Damiani.
Der deutsche Film „Lebenszeichen“ des Jungfilmers Werner Herzog krankte trotz gelungener photographischer Atmosphäre an dem Bemühen, Aktionen und Seelenvorgänge, die eigentlich schauspielerischen Ausdruck hätten- finden müssen, durch einen neutralen Sprecher verkünden zu lassen. Menschlich rührend, aber doch ein wenig an Science-Fiction gemahnte der von dem Amerikaner Ralph Nelson inszenierte Beitrag „Charly“ über das Schicksal eines geistig Zurückgebliebenen, der durch eine Operation vorübergehend normal wird und dann doch wieder in das alte Leiden zurückfällt.
Selten einmütige und begeisterte Zustimmung fand die Entscheidung der neunköpfigen internationalen Jury unter Führung des spanischen Regisseurs Luis Garcia Berlanga, den Goldenen Bären an den schwedischen Film „Raus mit dir" von Jan Troell zu vergeben. Hart und lebenswahr wird darin das erschütternde Problem eines Lehrers aufgezeigt, der im täglichen Zusammenprall mit der kindlichen Grausamkeit ’an seiner nädagogischen Aufgabe scheitert. Seine innere Unsicherheit ruft immer heftigere Attacken seiner renitenten Zöglinge auf den Plan. Das Drama eines Mannes, der durch seine eigene Spröde und Verschlossenheit den Kontakt zu seiner Umwelt allmählich verliert. Zugleich auch eine hervorragende schauspielerische Leistung von Per Oscarsson, der den unglücklichen Lehrer verkörpert.
Wenn auch nicht in Konkurrenz, so doch in der Filmschau der Länder erlebten die Wiener Jungfilmer Walter Bannert und Herbert Link ermunternden Widerhall für ihren kurzen Beitrag „Johannes Maria Walddorf“, dessen makabrer Humor den Berlinern zu gefallen schien. Auch die gut besuchte österreichi sche Kulturfilmmatinee — sie wurde heuer zum zwölften Male durchgeführt — erwies sich als eine positive Visitenkarte vor diesem internationalen Forum. Und last not least ist die Verleihung des deutschen Bundesfilmpreises an den Wiener Architekten Otto Pischinger — er erhielt ihn zum drittenmal — und seine Gattin Herta Hareiter- Pischinger für die Arbeit in dem Film „Das Schloß“ nach Kafka ebenfalls nicht zu verachten.
Festivaldirektor Alfred Bauer aber hat sich bei dieser XVIII. Berlinale um eine Synthese zwischen Filmkunst und Filmindustrie bemüht. Beide Seiten haben sein Wollen vielleicht nicht immer richtig verstanden, aber er hat es doch erreicht, daß unter den Fittichen der Berlinale die internationalen Filmwirtschaftler vom Produzenten über den Verleiher bis zum Kinobesitzer ihre Geschäfte tätigten und ebenso zu Wort kamen, wie jene reformlüsternen, meist bärtigen Revoluzzer, die glauben, den Fortschritt des Films allein gepachtet zu haben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!