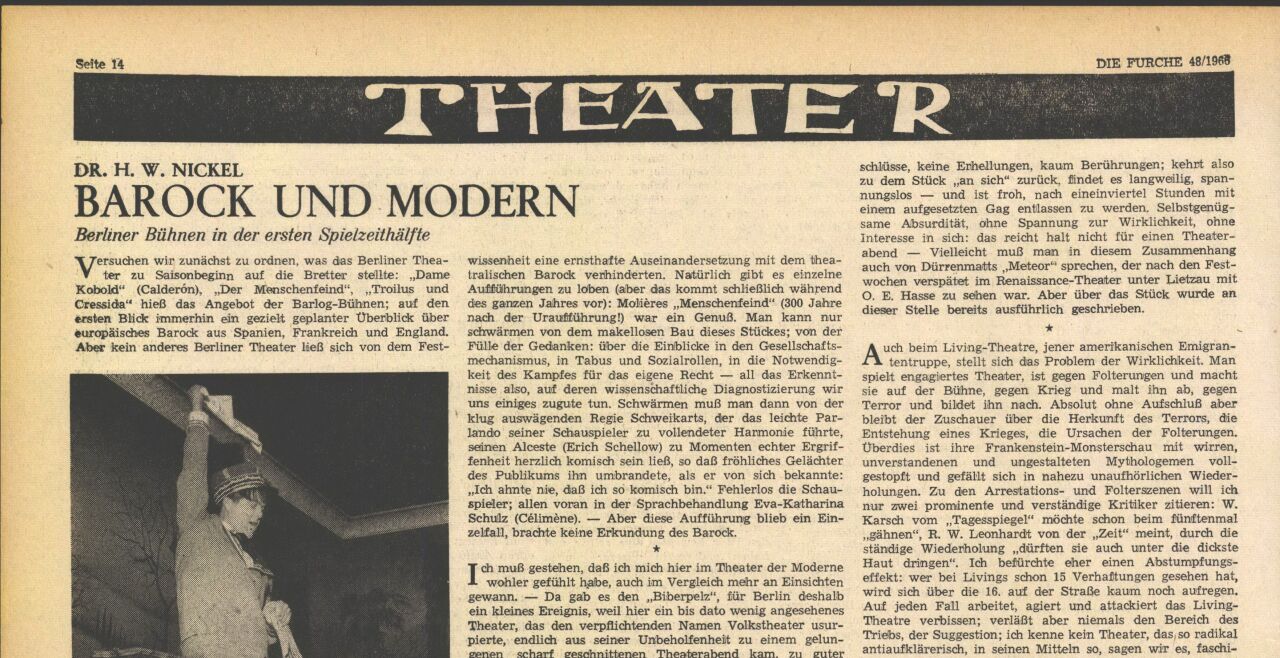
Versuchen wir zunächst zu ordnen, was das Berliner Theater zu Saisonbeginn auf die Bretter stellte: „Dame Kobold“ (Calderön), „Der Menschenfeind“, „Troilus und Cressida“ hieß das Angebot der Barlog-Bühnen; auf den ersten Blick immerhin ein gezielt geplanter Überblick über europäisches Barock aus Spanien, Frankreich und England. Aber kein anderes Berliner Theater ließ sich von dem Fest wochenthema „Barock“ inspirieren. Ergänzungen brachten lediglich die Gastspiele: „Ein Sommemachtstraum“' (aus Hamburg, Schuh), „Der Bauer als Millionär“ (Wien, Steinboeck), Purcells „Feenkönigin“ (München) und Glucks „Iphigenie“ (Zürich).
Selbst die Berliner Oper fand nichts Barockes; ersatzweise spielten die Philharmoniker Handels „Samson“. Dafür aber brachte die Deutsche Oper beachtliche moderne Werke: Hau- benstock-Ramatis „Amerika“ und Henzes „Die Bassariden", worüber an dieser Stelle bereits berichtet wurde.
Und moderne Stücke brachten auch die übrigen Bühnen: Dürrenmatt: „Der Meteor“, Hans Günter Michelsen: „Stienz“, Claude Mauriac: „Das Gespräch“ und Martin Sperr: „Jagdszenen in Niederbayem“. Dazu kamen die Eigenproduktionen des Living-Theatre: „Frankenstein“, „Mysteries“ sowie Genets vZofen“, und auf kleineren Bühnen Becket („Für Puppen“), Ionesco, Vian; schließlich, immerhin noch aus dem zwanzigsten Jahrhundert: „Biberpelz“, Vitrac: „Victor oder die Kinder an die Macht“ und Stemheims „Die Marquise von Arcis“1.
Natürlich gaben auch die Boulevardtheater ihre wenig bedeutenden Nichtigkeiten zum besten, teils schmuddelig („Sister George“), teils neckisch („Die Eule und das Kätzchen“). Aus der Zeit zwischen Barock und Moderne aber gab es eigentlich nur ein Stück: Vergas „La Lupa“ mit Anna Magnami in einer Inszenierung von Zeffirelli. — Welche Erkenntnisse und Erlebnisse gab es nun in Berlin zum Theater des Barock?
Festwochenintendant Nabokov hatte mit seinem Thema herausgefordert; aber niemand ging darauf ein; vielleicht reicht auch die Zeit eines Jahres nicht zu einer angemessenen Antwort. Jedenfalls entpuppte sich die Einfallslosigkeit der Theaterdramaturgien (während es in der bildenden Kunst höchst sehenswerte und aufschlußreiche Ausstellungen gab!): man blättert offensichtlich nur in den eigenen Archiven und gräbt alte Erfolge aus: kein Corneille, kein Cervantes (der immerhin in diesem Jahr seinen 350. Todestag hat; also keine Zwischenspiele, nicht die „Gefangenen von Algier“, erst recht nicht „Numamtia“), kein deutscher Barockdramatiker, kein Weise („Masaniello“), kein Gryphius („Squenz“, „Dornen- rose“, „Horribilicribrifax“), kein Schäferspiel, kein Elisabeth aner.
Doch halt; das kleine Rieichsikäbarett war es, das ganz am Rande fünf jungen unbekannten Schauspielern Gelegenheit gab, unbekanntes Barock zu zeigen. „Barock-Satiren“ hieß ihr mitternächtliches Programm, Rainer Stahlschmidt ist vor allem zu nennen; weniger als Regisseur, auch nicht für die Abfolge des Programms, die allzu willkürlich war, wohl aber durch sein Aufspüren der Texte, die das Publikum nicht nur durch derbe Sinnentfülle und barocke Sprachgewalt entzückten, sondern auch durch politische Gegenwartsbezüge „ernsthaft vermahnten und unterwiesen“ über die Gefährlichkeit des „teutschen Helden" etwa (Grimmelshausen) oder über den Prozeß gegen Berthold Schwartz (aus Moscherochs) „Philander“; ganz nahe bei des anderen Bertolds „Galilei“ und bei Kipphardts „Oppenheimer“.
In diesem Programm, das inzwischen auch den berechtigten Publikumserfolg einheimsen darf, war der Spürsinn am Werk, den man allen Berliner Theaterleitern gewünscht hätte: sie waren es, die mit ihrer Bequemlichkeit und Un wissenheit eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem theatralischen Barock verhinderten. Natürlich gibt es einzelne Aufführungen zu loben (aber das kommt schließlich während des ganzen Jahres vor): Moliėres „Menschenfeind“ (300 Jahre nach der Uraufführung!) war ein Genuß. Man kann nur schwärmen von dem makellosen Bau dieses Stückes; von der Fülle der Gedanken: über die Einblicke in den Gesellschaftsmechanismus, in Tabus und Sozialrollen, in die Notwendigkeit des Kampfes für das eigene Recht — all das Erkenntnisse also, auf deren wissenschaftliche Diagnostizierung wir uns einiges zugute tun. Schwärmen muß man dann von der klug auswägenden Regie Schweikarts, der das leichte Parlando seiner Schauspieler zu vollendeter Harmonie führte, seinen Alceste (Erich Schellow) zu Momenten echter Ergriffenheit herzlich komisch sein ließ, so daß fröhliches Gelächter des Publikums ihn umbrandete, als er von sich bekannte: „Ich ahnte nie, daß ich so komisch bin.“ Fehlerlos die Schauspieler; allen voran in der Sprachbehandlung Eva-Katharina Schulz (Cėlimėne). — Aber diese Aufführung blieb ein Einzelfall, brachte keine Erkundung des Barock.
Ich muß gestehen, daß ich mich hier im Theater der Moderne wohler gefühlt habe, auch im Vergleich mehr an Einsichten gewann. — Da gab es den „Biberpelz“, für Berlin deshalb ein kleines Ereignis, weil hier ein bis dato wenig angesehenes Theater, das den verpflichtenden Namen Volkstheater usurpierte, endlich aus seiner Unbeholfenheit zu einem gelungenen, scharf geschnittenen Theaterabend kam, zu guter Hausmannskost. Zudem wartete der Regisseur Balimann mit einem geschickten dramaturgischen Einfall auf: er ließ den Amtsvorsrteher von Wehrhann und den Julius Wolff von einem Darsteller spielen; das machte dem Hausherren Paul Esser sichtlich Freude, ergab aber auch einige zusätzliche Pointen und Durchblicke. Zum anderen war die Inszenierung dafür bezeichnend, wie sehr doch heutzutage politisches Theater marktgängig geworden ist; der Konjunktur zuliebe interpretierte man eine durchaus normale Aufführung zu einem politischen Knüller um. Ein Lokalereignis also.
Dann eine Nachholstunde: Vitracs „Kinder an der Macht“. Von Anouilh wird es als Vorläufer der Absurden angepriesen; einiges hat es schließlich auch damit zu tun. Aber es ist beileibe kein Beitrag zur Kinderpsychologie oder zum Genieproblem; der frühreife Victor ist nichts anderes als ein Motor, der das Stück in Gang bringt und hält und dadurch zur Demaskierung der bürgerlichen Gesellschaft führt: gut ist ihre sexuelle Verklemmung dargestellt; scharfe Spitzen gegen die Armee gibt es; aber man muß sie sehr auf die französische Geschichte projizieren, um die ganze Schärfe der einst aktuellen Kabarettspäße zu schmecken: das aber heißt: das Stück ist in Deutschland fehl am Platze oder müßte gründlich bearbeitet werden. Es half also nicht die brillante Regie Utzeraths; nicht die ausgezeichneten Schauspielerleistungen, auch nicht die dichten Momente in den Gesprächen zwischen den beiden Ehemännern, die einige Male bis nahe an die Wahrheit kommen (da wird dann wirklich aus Feydeau Strindberg): das Stück wird in seinem dritten Akt schwach, wenn es die Einfälle der Handlung wirr und ohne Distanzierung zu Ende führt. Da fiel dann auch dem Regisseur nichts mehr ein: er verließ den karikierten Boulevard, wurde ernst, echt, realistisch: setzte sich und das Stück der Nachprüfbarkeit aus und scheiterte daran.
An der Nachprüfbarkeit scheitert auch Micbelsens „Stienz“.
Sein 1963 uraufgeführtes Stück konnte man auf einer Kellerbühne sehen. Während sein Dialog immer wieder die gleichen Wendungen bringt, die beiden handelnden Personen monoton dahinreden, setzt der Zuschauer die erhaltenen Informationen zusammen — irgendwie muß er sich schließlich die Zeit vertreiben! Er findet Ungereimtheiten, vergleicht mit der ihm bekannten Wirklichkeit, findet keine Auf schlüsse, keine Erhellungen, kaum Berührungen; kehrt also zu dem Stück „an sich“ zurück, findet es langweilig, spannungslos — und ist froh, nach eineinviertel Stunden mit einem aufgesetzten Gag entlassen zu werden. Selbstgenügsame Absurdität, ohne Spannung zur Wirklichkeit, ohne Interesse in sich: das reicht halt nicht für einen Theaterabend — Vielleicht muß man in diesem Zusammenhang auch von Dürrenmatts „Meteor“' sprechen, der nach den Festwochen verspätet im Renaissance-Theater unter Lietzau mit O. E. Hasse zu seihen war. Aber über das Stück wurde an dieser Stelle bereits ausführlich geschrieben.
Auch beim Living-Theatre, jener amerikanischen Emigrantentruppe, stellt sich das Problem der Wirklichkeit. Man spielt engagiertes Theater, ist gegen Folterungen und macht sie auf der Bühne, gegen Krieg und malt ihn ab, gegen Terror und bildet ihn nach. Absolut ohne Aufschluß aber bleibt der Zuschauer über die Herkunft des Terrors, die Entstehung eines Krieges, die Ursachen der Folterungen. Überdies ist ihre Frankenstein-Monsterschau mit wirren, unverstandenen und ungestalteten Mythologemen vollgestopft und gefällt sich in nahezu unaufhörlichen Wiederholungen. Zu den Arrestations- und Folterszenen will ich nur zwei prominente und verständige Kritiker zitieren: W. Karsch vom „Tagesspiegel“ möchte schon beim fünftenmal „gähnen“, R. W. Leonhardt von der „Zeit“ meint, durch die ständige Wiederholung „dürften sie auch unter die dickste Haut dringen“. Ich befürchte eher einen Abstumpfungseffekt: wer bei Livings schon 15 Verhaftungen gesehen hat, wird sich über die 16. auf der Straße kaum noch aufregen. Auf jeden Fall arbeitet, agiert und attackiert das Living- Theatre verbissen; verläßt aber niemals den Bereich des Triebs, der Suggestion; ich kenne kein Theater, das, so radikal antiaufklärerisch, in seinen Mitteln so, sagen wir es, faschistisch ist wie diese Antifariegstruppe!
Während Frankenstein auf gerümpelvoller Bühne zumeist in mystischem Dämmer spielt und voller Lichtzauber steckt, vollzieht die Schaubühne Sperrs „Jagdszenen aus Niederbayern“ in der gleichbleibenden Klarheit des ungedämpften Bühnenlichts vor hellgrauen, fast weißen Hinter- grundsvorhängen und spärlichen Versatzstücken. Das ist symptomatisch für den deutlichen Willen zur Aufklärung. Sperr legt gesellschaftlichen Mechanismus bloß, er vermittelt soziologische Erkenntnisse, er zeigt die Genesis eines Verbrechers und die Krankheit der Gesellschaft. Dabei ist seine klare Demonstration durchaus von Stiller Poesie und läßt mehr als einmal an Büchners „Woyzeck“ denken. Wenn auch der zweite Teil zu ausführlich geraten ist in der Abschilderung der Vorgänge: hier ist ein gerade 20 Jahre alter deutscher Dramatiker (und Schauspieler!), der zu gestalten versteht. Und mit ihm hat die Schaubühne endlich auch den Autor gefunden, der zum Stil des Hauses paßt. Hoffentlich gelingt es ihm auch, nicht nur aus den eigenen Jugenderfahrungen seiner Heimat Niederbayern zu schreiben, sondern auch die komplizierten Vorgänge der städtischen Gesellschaft zu gestalten.
Sperrs Stück bringt „Jagdszenen“ im eigentlichen (und bescheidenen!) Sinn des Wortes: er zeigt den Außenseiter, der hier ein Homosexueller ist (wobei Sperr am Rande auch die Verfemung der Homosexualität attackieren will, vorzüglich aber an der Darstellung des Mechanismus der Gesellschaft interessiert ist). Nach einem vergeblichen Anpassungsversuch wird er von der dörflichen Gemeinschaft immer mehr an den Rand gedrängt und schließlich zum Mörder. Diese Entwicklung, so zeigte sich in einer Publikumsdiskussdon der rührigen Schaubühnenleute, wird von vielen Zuschauern nicht mehr akzeptiert: wenn Sperr sich schon für einen Außenseiter einsetzen wolle, dann solle er doch nicht gerade einen Mörder als Beispiel nehmen. Aber gerade dies scheint mit ein Beweis für den meihir als aufklärerischen, den dichterischen Wert des Stückes: es zeigt klar, wie auch das Opfer nicht unbeeinflußt bleibt vom öffentlichen Prozeß. — Trotz dieser Widerstände gegen die letzte Konsequenz gab es für die Schaubühne einen deutlichen Publikumserfolg; das deutsche Theater ist um einen Autor reicher.




































































































