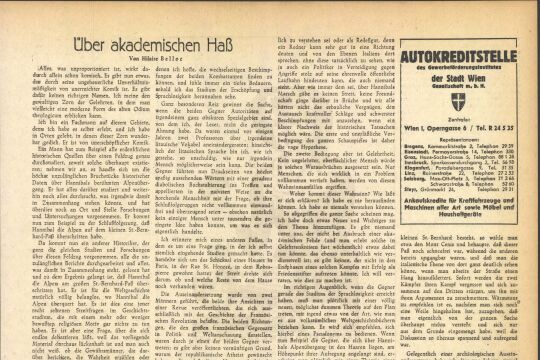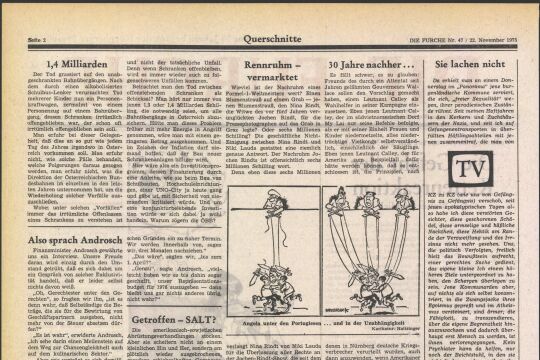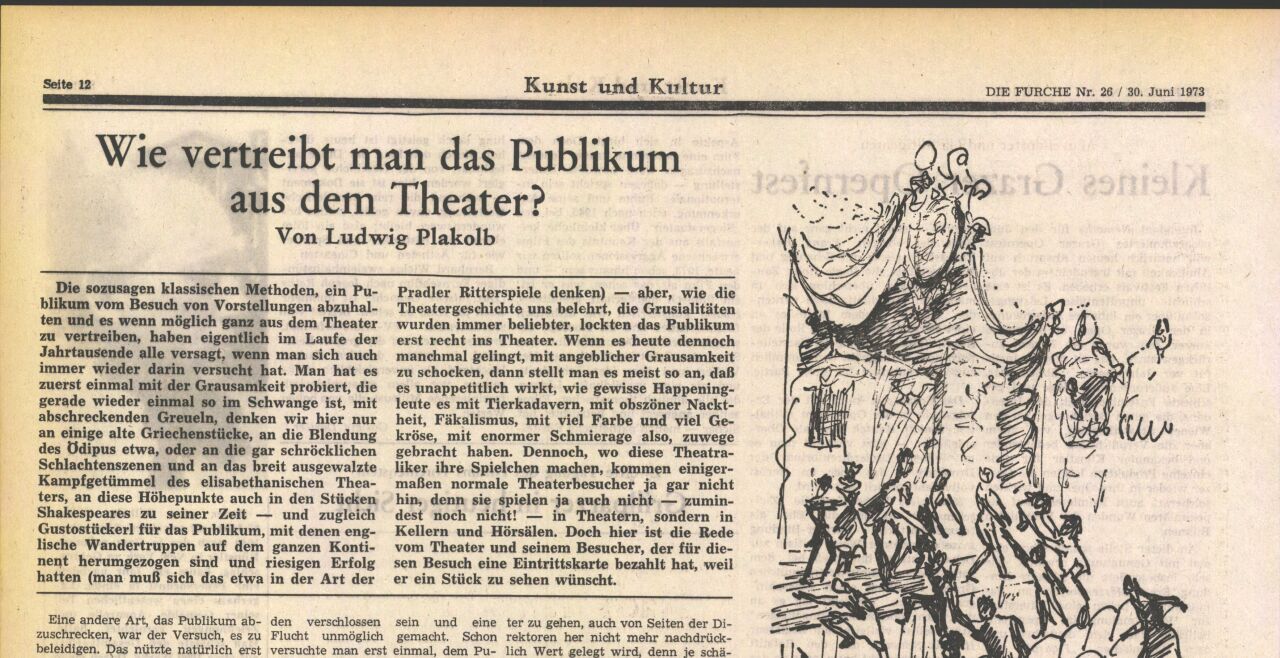
Wie vertreibt man das Publikum aus dem Theater?
Die sozusagen klassischen Methoden, ein Publikum vom Besuch von Vorstellungen abzuhalten und es wenn möglich ganz aus dem Theater zu vertreiben, haben eigentlich im Laufe der Jahrtausende alle versagt, wenn man sich auch immer wieder darin versucht hat. Man hat es zuerst einmal mit der Grausamkeit probiert, die gerade wieder einmal so im Schwange ist, mit abschreckenden Greueln, denken wir hier nur an einige alte Griechenstücke, an die Blendung des ödipus etwa, oder an die gar schröcklichen Schlachtenszenen und an das breit ausgewalzte Kampfgetümmel des elisabethanischen Theaters, an diese Höhepunkte auch in den Stücken Shakespeares zu seiner Zeit — und zugleich Gustostückerl für das Publikum, mit denen englische Wandertruppen auf dem ganzen Kontinent herumgezogen sind und riesigen Erfolg hatten (man muß sich das etwa in der Art der Pradler Ritterspiele denken) — aber, wie die Theatergeschichte uns belehrt, die Grusialitäten wurden immer beliebter, lockten das Publikum erst recht ins Theater. Wenn es heute dennoch manchmal gelingt, mit angeblicher Grausamkeit zu schocken, dann stellt man es meist so an, daß es unappetitlich wirkt, wie gewisse Happeningleute es mit Tierkadavern, mit obszöner Nacktheit, Fäkalismus, mit viel Farbe und viel Gekröse, mit enormer Schmierage also, zuwege gebracht haben. Dennoch, wo diese Theatraliker ihre Spielchen machen, kommen einigermaßen normale Theaterbesucher ja gar nicht hin, denn sie spielen ja auch nicht — zumindest noch nicht! — in Theatern, sondern in Kellern und Hörsälen. Doch hier ist die Rede vom Theater und seinem Besucher, der für diesen Besuch eine Eintrittskarte bezahlt hat, weil er ein Stück zu sehen wünscht.
Die sozusagen klassischen Methoden, ein Publikum vom Besuch von Vorstellungen abzuhalten und es wenn möglich ganz aus dem Theater zu vertreiben, haben eigentlich im Laufe der Jahrtausende alle versagt, wenn man sich auch immer wieder darin versucht hat. Man hat es zuerst einmal mit der Grausamkeit probiert, die gerade wieder einmal so im Schwange ist, mit abschreckenden Greueln, denken wir hier nur an einige alte Griechenstücke, an die Blendung des ödipus etwa, oder an die gar schröcklichen Schlachtenszenen und an das breit ausgewalzte Kampfgetümmel des elisabethanischen Theaters, an diese Höhepunkte auch in den Stücken Shakespeares zu seiner Zeit — und zugleich Gustostückerl für das Publikum, mit denen englische Wandertruppen auf dem ganzen Kontinent herumgezogen sind und riesigen Erfolg hatten (man muß sich das etwa in der Art der Pradler Ritterspiele denken) — aber, wie die Theatergeschichte uns belehrt, die Grusialitäten wurden immer beliebter, lockten das Publikum erst recht ins Theater. Wenn es heute dennoch manchmal gelingt, mit angeblicher Grausamkeit zu schocken, dann stellt man es meist so an, daß es unappetitlich wirkt, wie gewisse Happeningleute es mit Tierkadavern, mit obszöner Nacktheit, Fäkalismus, mit viel Farbe und viel Gekröse, mit enormer Schmierage also, zuwege gebracht haben. Dennoch, wo diese Theatraliker ihre Spielchen machen, kommen einigermaßen normale Theaterbesucher ja gar nicht hin, denn sie spielen ja auch nicht — zumindest noch nicht! — in Theatern, sondern in Kellern und Hörsälen. Doch hier ist die Rede vom Theater und seinem Besucher, der für diesen Besuch eine Eintrittskarte bezahlt hat, weil er ein Stück zu sehen wünscht.
Eine andere Art, das Publikum abzuschrecken, war der Versuch, es zu beleidigen. Das nützte natürlich erst recht nichts, denn es scheint dem Zuschauer geradezu ein Vergnügen zu bereiten, sich verhöhnen zu lassen. Das läßt man sich schon eine Loge kosten, wie Brecht/Weills kulinarische Operettenrevolutionsmodelle von der „Dreigroschenoper“ bis zu „Mahagonny“ zur Genüge bewiesen haben. Der jüngste, weithin bekannt gewordene Fall ist die sprichwörtlich zu Titelehren gekommene „Publikumsbeschimpfung“ von Peter Handke, der damit nicht einmal der erste war, der es so direkt versuchte. Ähnliches ging auch schon Ionesco durch den Kopf, doch damals waren die Theaterleiter noch nicht so weit, so progressiv, in dieses Geschäft gegen (vermeintlich gegen, wie sich inzwischen herausgestellt hat) das Publikum einzusteigen.
Martin Esslin berichtet, daß Ionesco, als er sein erstes Stück, „Die kahle Sängerin“, schrieb, sich vorgestellt habe, „das Publikum würde nach dem Fallen des Vorhangs in Pfuirufe ausbrechen und der Theaterdirektor würde daraufhin auf die Bühne gehen und versuchen, die Menge zu beschwichtigen, aber sie würde weiter schreien, bis er die Polizei holen müßte, die aber würde ein Maschinengewehr auf der Bühne montieren und ins Publikum schießen. Man erklärte Ionesco, das .wäre doch etwas zu kostspielig', und so schlug er einen Schluß vor, in dem er, als Autor, auf die Bühne gehen und das Publikum mit einer Flut von Beschimpfungen überschütten wollte. Die Direktion war noch immer nicht einverstanden, und so entschloß man sich zuletzt, das Stück ohne Schluß zu lassen; wenn es zu Ende war, fing man einfach wieder von vorne an, und das ist tatsächlich bis heute der Abschluß geblieben.“
Diese Episode wurde deshalb so ausführlich zitiert, weil sie genau das Mittel zeigt, mit dem heute — mit beachtlichem Erfolg, in der Bundesrepublik mit größerem, bei uns erst in Ansätzen — versucht wird, dem Publikum eine Theaterflucht nahezulegen: mit Langeweile.
Langeweile kann man auf verschiedene Arten erzielen. Gewisse linke Langeweiler verstehen sich darauf, endlose ideologische Diskussionen — nicht politische, bitte das nicht zu verwechseln, wie das heute so leichtfertig und so gern getan wird! — als Stücke anzupreisen. Merk's Bürger, oder merk's auch nicht, aber jetzt sitzt du einmal da, in der Theaterfalle, und hörst uns zu, was wir zu sagen haben! Auch dir, und zwar ohne Pardon! Eilends schalten auch die Regisseure auf die nämliche Angriffstaktik und spielen das zu alledem auch noch lange, sehr lange aus. Es lebe die Pause! Aber nicht die gute alte Pause in Opas Theater, die man im Gespräch, in Geselligkeit, bei Sekt oder einem Stückerl Schokolade oder mit einer Zigarette im Foyer verbrachte, sondern jene vielen Pausen im Stück. Nicht lange mehr wird es dauern, und — die Baupolizei sei da vor, und Gott sei Dank, noch ist sie lebensret-tend in Funktion — die Türen werden verschlossen sein und eine Flucht unmöglich gemacht. Schon versuchte man erst einmal, dem Publikum das Licht auszublasen, das Notlicht an den Ausgängen für eine Notflucht, so geschehen unter reger negativer Anteilnahme und gerichtlichem Nachspiel zu Salzburg bei den Festspielen. Der Regisseur empfand dieses verhinderten Blackouts wegen, der nicht mehr war als ein solcher, also ein Gag, seine Inszenierung als „geschmissen“, und der Autor des Stückes sprach einem Publikum, das nicht einmal so kurze Zeit die Finsternis ertragen könne, die Berechtigung ab, sich als Zuschauer und damit als Mensch zu fühlen.
Dabei geht man doch ins Theater, um zuzuschauen, was Leute, die dafür eine Lehre absolviert haben, machen. Üble Praktiken, die auch eine recht wirkungsvolle Art sind, das Publikum abzuschrecken, sind, nach ihm zu greifen. Man geht daran, die gute alte Guckkastenbühne, bei der jeder seinen Platz hatte, die Spieler und die Zuschauer, die Rampe sie schützte wie ein eiserner Vorhang, wenn ein Brand ausbrechen sollte, abzuschaffen, sie als unzeitgemäße Form zu verteufeln. Denn man will das Publikum doch endlich in die Zange nehmen, will es nicht nur mitspielen lassen, sondern zum Mit-agieren zwingen. Man will aus Konsumenten Aktivisten machen. Wer einmal eine bewußt provozierte Rangelei auf der Bühne zwischen professionell agierenden und aus dem Zuschauerraum dazu Verleiteten erlebt hat, wie es das Living Theatre auch in Wien einmal bei einem Gastspiel vorgeführt hat, kann nicht umhin, sich vorzustellen, daß der Abendanzug eines Theaterbesuchers einmal dem Asbestschutzkleid eines Feuerwehrmannes mit Gasmaske im Einsatz ähneln wird, unter dem der Gewitzte zudem die kugelsichere Weste trägt. Jedenfalls soll es schon Leute geben, die ihre langjährigen Abonnementsitze in der ersten Reihe oder am Rande gegen solche in der Mitte eintauschen, der größeren Sicherheit wegen. Gegen vorläufig angewandte Praktiken, wie etwa mit Scheinwerfern ins Publikum zu leuchten, Schüsse direkt ins Parkett abzufeuern oder mit starker Rauchentwicklung ein ganzes Haus zu vernebeln, ist man ja, weil es sich dabei gleichsam nur um Theaternapalm handelt, inzwischen fast schon immun geworden.
Überdenkt man diese Tendenzen, versteht man auch, daß auf die althergebrachte Sitte, in Gala ins Theater zu gehen, auch von Seiten der Direktoren her nicht mehr nachdrücklich Wert gelegt wird, denn je schäbiger gekleidet man eine Vorstellung besucht, desto unbeschädigter hat man, zumindest äußerlich, die Chance, sie wieder zu verlassen. Darum weg auch von den alten Schauspielhäusern! Fabrikhallen, Remisen, noch besser Hinterhöfe, wie Straßentheaterredakteure sie bevorzugen, letztlich wohl Gummizellen, in denen am wenigsten passieren kann, sind im Kommen.
Es gibt aber auch noch eine andere Art, Langeweile zu erzielen, die auf jede Ideologie verzichten kann, wie sie ja fast überhaupt auf alles verzichtet, einschließlich der Verständlichkeit. Man langweilt die Zuschauer, weil, erstens, nichts auf der Bühne passiert, und weil sie, zweitens, nicht von dem verstehen, was eventuell noch oben gesprochen wird. Das ist die sogenannte Darstellung unserer allgemeinen Kontaktlosigkeit, die über kurz oder lang zur Folge haben wird, daß auch der Kontakt zwischen Zuschauerraum und Bühne zusammenbricht. Übertrieben, aber nur wenig, schaut das dann so aus: Auf der Bühne sitzen zwei Personen; stumm. Und der Zuschauer hat sich nun zu bemühen, sich vorzustellen, was die zwei da oben sich wohl denken könnten. Ein sehr bewährtes und beliebtes Mittel, das Publikum zu vergrämen. Wenn es trotzdem nicht ausbleibt, so deshalb, weil man gerne die besten Schauspieler, wenn möglich Stars, für diese Zwecke abnützt, und weil man überdies im Programmheft nachlesen kann, was man auf der Bühne nicht sieht.
Hand in Hand damit ist eine Entwicklung zu verzeichnen, die das Programm unentbehrlich für das Verständnis einer Vorstellung macht, es in den Rang einer theaterwissenschaftlichen oder noch öfter einer philosophischen Abhandlung erhebt, und somit endlich einmal auch die Dramaturgen ins rechte Licht setzt, die sich ohnehin, seit es ein Theater gibt, vernachlässigt fühlen. Je unverständlicher das Theater, desto angesehener wird dieser Beruf. Daher gelingt es den Dramaturgen heute ja auch schon, eigene Kongresse zu veranstalten, für die sogar Subventionsgelder flüssig gemacht werden können, Erfahrungsaustauschgespräche in Szene zu setzen und, wenn schon nicht wirksam, so doch gehört zu werden.
Eine andere Art, zum Teil noch im
Versuchsstadium, die es in einer bundesdeutschen und in einer österreichischen Variante gibt, die Leute aus dem Theater zu treiben, ist, zuviel des Teuren an Subventionen zu geben; mit anderen Worten, das Geld zur Bühne hinauszuschmeißen.
Die heimische Variante ist, unserer Tradition entsprechend, feudaler. Der Fiskus schießt unseren Staatsbühnen derartige Summen zu, daß diese es gar nicht nötig haben, sich darum zu kümmern, wie sie theaterspielen und was. Hauptsache: man sieht es! Bei den Dekorationen und bei den Kostümen. Das Beste ist da immer noch nicht teuer genug. Und so kommt es auch nicht von ungefähr, daß ein prominentes Mitglied der Staatsoper erst unlängst anläßlich eines besonders aufwendigen Inszenierungsdebakels festgestellt hat: „Schade ... Hier ist soviel Potenz vorhanden. Aber ich glaube, im Überfluß an Geld liegt der Hauptschaden.“
Die deutsche Variante, mit der auch schon die Schweizer liebäugeln, ist, ebenfalls ihrer — zum Teil zwar erst jüngeren und jüngsten — Tradition entsprechend, demokratischer. Man denkt dort an die totale Subvention, an den Nulltarif, als ob das Theater ein öffentliches Verkehrsmittel wäre. Jeder, der auch nur einigermaßen die Intentionen kennt, die von jenen Leuten zur Diskussion gestellt werden und auch ausgeführt werden möchten und die diese Bühnen der Zukunft leitend bestimmen würden (selbstverständlich im Kollektiv, mit dem Mitspracherecht auch der Souffleure und der Billeteure, auch der Theaterwissenschaft studierenden Jugend, die bei den Proben anwesend ist und Inszenierungsprotokolle verfaßt) jeder also, der diese Intentionen kennt, weiß auch, wohin das führen würde. Die Mitspracherecht Besitzenden würden sich selbst etwas vorreden und vorspielen. Ob et noch zu einer Premiere überhaupt kommen würde statt des heute schon so beliebten spektakulärem Abbruchs, bleibt dahingestellt; eine Teilnahme des Publikums aber scheint ausgeschlossen.
„Mit viel Fleiß werden da die verkümmerten Pferdchen geritten, die einer kleinen Clique gefallen, die sich als .Generalintendanz Deutschlands' fühlt“, hat der alte Theatermann Boleslaw Barlog diese wortgewandten Kümmerererneuerer genannt. Und so weiter: „Dabei schielen die Progressiven von ,theater heute' sowieso immer mit linken Augen in die rechten Westentaschen, wo das Geld steckt. Und die, die behaupten, daß Intoleranz für sie das rote Tuch sei, die sind doch selbst die Intolerantesten.“
Apropos „theater heute“ — die Rede ist hier von der weit verbreiteten, weil einzigen Theaterzeitschrift für den gesamtdeutschen
Sprachraum — „theater heute“ zu lesen ist auch gar keine so üble Methode, dem Publikum einen Theaterbesuch als nicht gerade vergnüglich und verlockend hinzustellen!
Was könnte man also tun, die Leute trotzdem ins Theater zu bringen? Was soll die Menschen bewegen, nicht froh darüber zu sein, nach einem anstrengenden Arbeitstag die Patschen anzuziehen und sich vor das mit eben diesem Terminus bezeichnete bequeme Kino zu setzen, sich das Abendessen schmecken zu lassen in aller Ruhe und ein Flascherl Wein dazu, sondern sich vom Schmutz des Tages zu säubern, widerspenstige Krawatten in steife Kragen zu zwängen und sich selbst in einen dunklen Anzug, ein Taxi herbeizurufen, weil mit einem Parkplatz vor dem Theater nicht zu rechnen ist, die nicht gerade billige Eintrittskarte zu zücken, in zweifacher Ausführung, denn Theaterabende sind nun einmal nicht Herrenabende, und schließlich, nachdem man all das überstanden hat, was man nicht verstanden hat, endlich,- um einen ganzen teuren Vergnügungsabend reicher, todmüde ins Bett zu fallen.
Um diesem Problem auf die Spur zu kommen, werden Zettelaktionen gestartet, Publikumsbefragungen durchgeführt, werden neue Strukturen ausgearbeitet und getestet, werden Interviews gegeben und Stellungnahmen abgegeben, die allesamt nicht um die Tatsache herumkommen, daß „im mitteleuropäischen Durchschnitt nur etwa sechs Prozent der Bevölkerung vom Bühnengeschehen Notiz nehmen“, was nicht einmal darüber Auskunft gibt, wieviel Prozent auch daran Anteil haben.