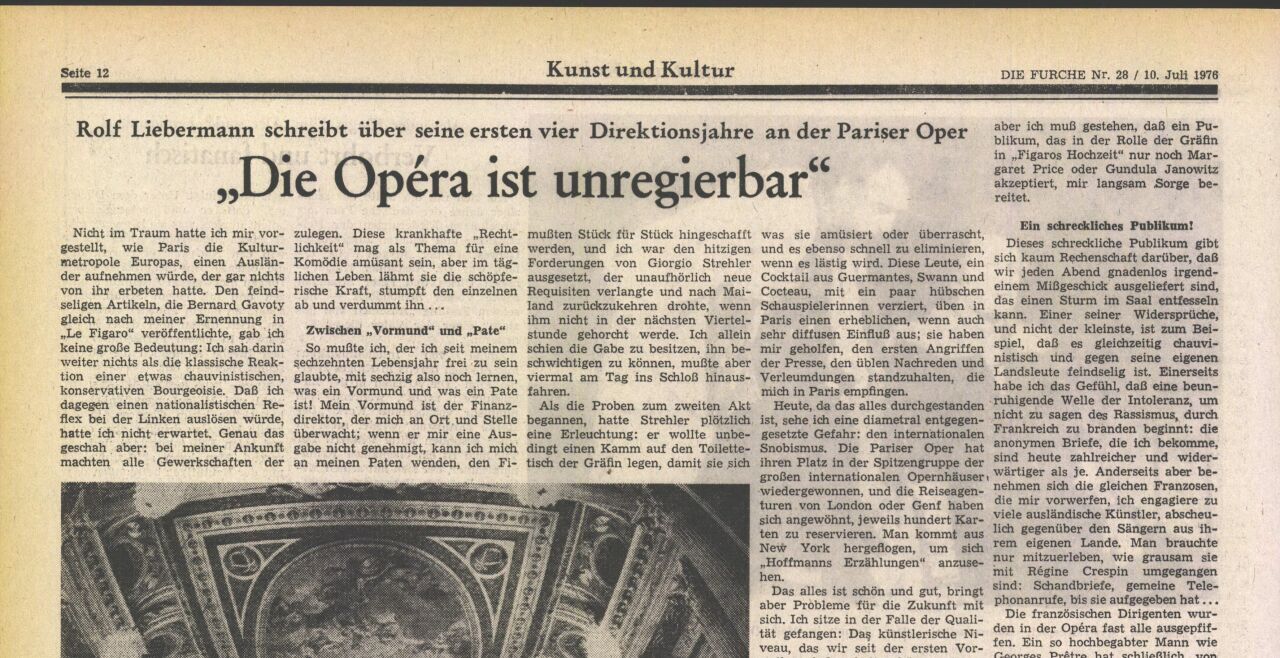
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Die Opera ist unregierbar“
Nicht im Traum hatte ich mir vorgestellt, wie Paris die Kulturmetropole Europas, einen. Ausländer aufnehmen würde, der gar nichts von ihr erbeten hatte. Den feindseligen Artikeln, die Bernard Gavoty gleich nach meiner Ernennung in „Le Figaro“ veröffentlichte, gab ich keine große Bedeutung: Ich sah darin weiter nichts als die klassische Reaktion einer etwas chauvinistischen, konservativen Bourgeoisie. Daß ich dagegen einen nationalistischen Reflex bei der Linken auslösen würde, hatte ich nicht erwartet. Genau das geschah aber: bei meiner Ankunft machten alle Gewerkschaften der
Pariser Oper sofort einen Katzenbuckel.
So landete ich als völliger Neuling in Paris, wo ich alsbald zum Sündenbock wurde.
Obwohl die Vorurteile heute beseitigt sind, habe ich immer noch gegen einen gewissen französischen Formalismus zu kämpfen. Ein Beispiel: Vor einigen Monaten suchten mich die Gewerkschaftsvertreter der Choristen auf. Die Choristen hatten eben eine „Italienne“, das heißt eine Probe mit Orchester, absolviert. Im Arbeitsplan war anschließend eine halbstündige Ruhepause und dann eine Stunde Stellprobe vorgesehen. Nun steht im Kollektivvertrag tatsächlich, daß der Chor nach einer Studiositzung auf der Bühne zu arbeiten habe. Und das war das ganze Drama: „Studio“ bedeutet in unserem Jargon Partiturstudium mit Klavierbegleitung. Die Delegierten weigerten sich infolgedessen, an der Stellprobe teilzunehmen mit der Begründung, „kein Vertragsartikel verpflichtet uns, nach einer Italienne auf der Bühne zu arbeiten; wir sind nur nach einem Studio dazu gezwungen.“
Vergeblich versuchte ich, ihnen begreiflich zu machen, wenn Choristen mit einer Partitur in der Hand auf einer Bank säßen, sei es doch ziemlich egal, ob ein Klavier oder Orchester sie begleite. Es war nichts zu machen, und schließlich entschied ich mich fürs Lachen und sagte, ich würde mich weigern, über solche Torheiten zu diskutieren.
Dieser Art sind die Probleme, die mir die ganze Zeit stehlen. Ich begreife einfach das sadistische Vergnügen nicht, das die Franzosen dabei haben, administrativen Text aus-
zulegen. Diese krankhafte „Rechtlichkeit“ mag als Thema für eine Komödie amüsant sein, aber im täglichen Leben lähmt sie die schöpferische Kraft, stumpft den einzelnen ab und verdummt ihn ...
So mußte ich, der ich seit meinem sechzehnten Lebensjahr frei zu sein glaubte, mit sechzig also noch lernen, was ein Vormund und was ein Pate ist! Mein Vormund ist der Finanzdirektor, der mich an Ort und Stelle überwacht; wenn er mir eine Ausgabe nicht genehmigt, kann ich mich an meinen Paten wenden, den Fi-
nanzkontrollor, der mir im übrigen jeden Kredit sperrt, falls mein Mentor ihm zuvor beigebracht hat, ich gäbe mein Taschengeld unbesonnen aus.
Kurz, die Befugnisse des Leiters der Pariser Oper sind rein theoretisch. Ich kann keine einzige Frage erledigen; was ich beschließe, wird von Funktionären lediglich als Vorschlag entgegengenommen, über den sie an meiner Stelle entscheiden.
Tatsächlich ginge an der Opera der Vorhang überhaupt nie hoch, wenn es nur auf die Administration ankäme. Dabei sind die Herren, von denen unser Schicksal abhängt, gar nicht etwa kalte Monstren wie aus einem Roman von George Orwell; sie sind meist liebenswürdig und gescheit. Aber was hält einen ehrgeizigen Beamten von rund dreißig Jahren, den man zum administrativen oder finanziellen Direktor der Oper ernennt, in Trab? Nur eins: seine Karriere ...
In Versailles, wo wir unsere Eröffnungsvorstellung probten, entdeckte ich zum erstenmal die sinnlosen Komplikationen der französischen Verwaltung. Ich wollte näm-ich mein Pariser Mandat mit einer Aufführung von „Figaros Hochzeit“ im Schloß Versailles, genauer im Theätre Gabriel, eröffnen. Mein Traum war, dort ein regelrechtes Mozartfest zu organisieren.
Das „Theätre Gabriel“ hatte übrigens von einem Theater nichts als den Namen: jegliche Bühnenausrüstung fehlte. Ich wußte damals noch nicht, daß für die Pariser Oper Versailles am Ende der Welt liegt und daß wir uns mit Transportkosten und Spesen aller Art ruinieren würden. Die Scheinwerfer beispielsweise
mußten Stück für Stück hingeschafft werden, und ich war den hitzigen Forderungen von Giorgio Strehler ausgesetzt, der unaufhörlich neue Requisiten verlangte und nach Mailand zurückzukehren drohte, wenn ihm nicht in der nächsten Viertelstunde gehorcht werde. Ich allein schien die Gabe zu besitzen, ihn beschwichtigen zu können, mußte aber viermal am Tag ins Schloß hinausfahren.
Als die Proben zum zweiten Akt begannen, hatte Strehler plötzlich eine Erleuchtung: er wollte unbedingt einen Kamm auf den Toilettetisch der Gräfin legen, damit sie sich
nach dem Singen ihrer Kavatine „Porgi, amor...“ frisieren könne. Ich gab also dem Requisiteur den Auftrag, in den nächst besten Laden zu laufen und einen zu kaufen. „Haben Sie einen Bon?“, gab er zurück, und als ich verblüfft den Kopf schüttelte, setzte er mir den einzuschlagenden Weg auseinander: ich mußte einen Spesenantrag stellen, damit ich einen Bestellschein bekäme, unterschrieben vom Finanzdirektor der Vereinigung der Nationaltheater und überprüft vom Finanzkontrollor, der das offizielle Visum erteilen würde, auf Grund dessen ich dann das Recht hätte, den Kamm zu kaufen ... Ich unterbrach ihn: „Ist das bis heute abend zu regeln?“ — „O nein, zehn Tage muß man schon rechnen.“ Da bezahlte ich den Kamm aus meiner eigenen Tasche; er kostete 18 Franc 50.
Alle diese Scherereien, diese rein formalen Komplikationen, lähmen meine Arbeitslust. Ich verkümmere, ich verliere den Rhythmus, ich versuche zu spät, eine Idee zu packen, ich prüfe die verlockendsten Vorschläge mit Mißtrauen, weil ich von vornherein überzeugt bin, daß sie schließlich doch im administrativen Sumpf versinken ...
Man kann „Tout-Paris“ wegen seiner Leichtfertigkeit oder seiner Bosheit bespötteln, aber es stellt eine wirklich spaßige Mischung von Adeligen, Finanzleuten, Schriftstellern, Couturiers, Schauspielern und Parfumeurs dar. Es ist eine elegante Gesellschaft, die die Gabe hat, alles an sich zu reißen, was originell ist, und es fallen zu lassen, so es sie zu langweilen anfängt. Sie besitzt eine auf der ganzen Welt einmalige Fähigkeit, unverzüglich aufzunehmen,
was sie amüsiert oder überrascht, und es ebenso schnell zu eliminieren, wenn es lästig wird. Diese Leute, ein Cocktail aus Guermantes, Swann und Cocteau, mit ein paar hübschen Schauspielerinnen verziert, üben in Paris einen erheblichen, wenn auch sehr diffusen Einfluß aus; sie haben mir geholfen, den ersten Angriffen der Presse, den üblen Nachreden und Verleumdungen standzuhalten, die mich in Paris empfingen.
Heute, da das alles durchgestanden ist, sehe ich eine diametral entgegengesetzte Gefahr: den internationalen Snobismus. Die Pariser Oper hat ihren Platz in der Spitzengruppe der großen internationalen Opernhäuser wiedergewonnen, und die Reiseagenturen von London oder Genf haben sich angewöhnt, jeweils hundert Karten zu reservieren. Man kommt aus New York hergeflogen, um sich „Hoffmanns Erzählungen“ anzusehen.
Das alles ist schön und gut, bringt aber Probleme für die Zukunft mit sich. Ich sitze in der Falle der Qualität gefangen: Das künstlerische Niveau, das wir seit der ersten Vorstellung haben halten können, ist so hoch, daß die kleinste Schwäche schon als Katastrophe erscheinen würde.
Sofern unser Budget nicht beschnitten wird, kann ich hoffen, daß dieses Niveau bis 1980 unverändert bleibt, und voraussagen, daß unsere Programme sich zwischen erstklassig und außerordentlich bewegen werden. Manche Reprisen werden sogar besser sein als die Erstaufführungen,
aber ich muß gestehen, daß ein Publikum, das in der Rolle der Gräfin in „Figaros Hochzeit“ nur noch Margaret Price oder Gundula Janowitz akzeptiert, mir langsam Sorge bereitet.
Dieses schreckliche Publikum gibt sich kaum Rechenschaft darüber, daß wir jeden Abend gnadenlos irgendeinem Mißgeschick ausgeliefert sind, das einen Sturm im Saal entfesseln kann. Einer seiner Widersprüche, und nicht der kleinste, ist zum Beispiel, daß es gleichzeitig chauvinistisch und gegen seine eigenen Landsleute feindselig ist. Einerseits habe ich das Gefühl, daß eine beunruhigende Welle der Intoleranz, um nicht zu sagen des Rassismus, durch Frankreich zu branden beginnt: die anonymen Briefe, die ich bekomme, sind heute zahlreicher und widerwärtiger als je. Anderseits aber benehmen sich die gleichen Franzosen, die mir vorwerfen, ich engagiere zu viele ausländische Künstler, abscheulich gegenüber den Sängern aus ihrem eigenen Lande. Man brauchte nur mitzuerleben, wie grausam sie mit Regine Crespin umgegangen sind: Schandbriefe, gemeine Telephonanrufe, bis sie aufgegeben hat...
Die französischen Dirigenten wurden in der Opera fast alle ausgepfiffen. Ein so hochbegabter Mann wie Georges Pretre hat schließlich, von den Anfeindungen entmutigt, seine Verträge annulliert.
Darüber hinaus muß man mit einer Minderheit von internationalen Verrückten rechnen: den besessenen Anhängern des Hi-Fi und seiner künstlichen Perfektion. Die sind die Geißel aller großen Bühnen der Welt und in Paris nicht zahlreicher als anderswo.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































