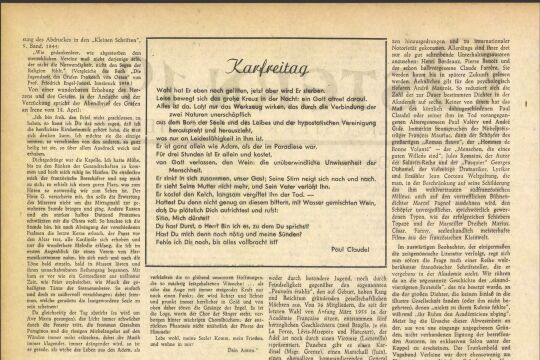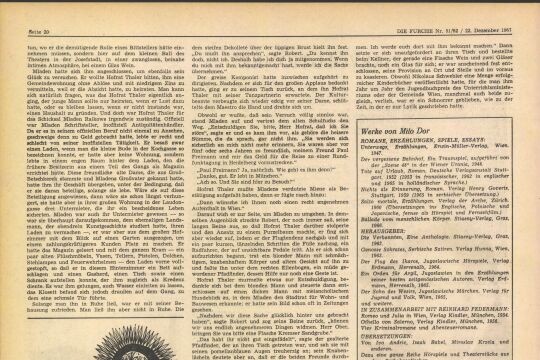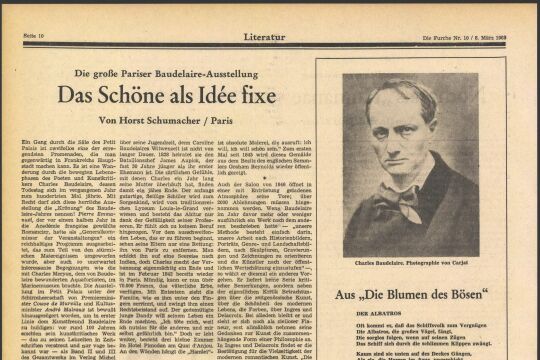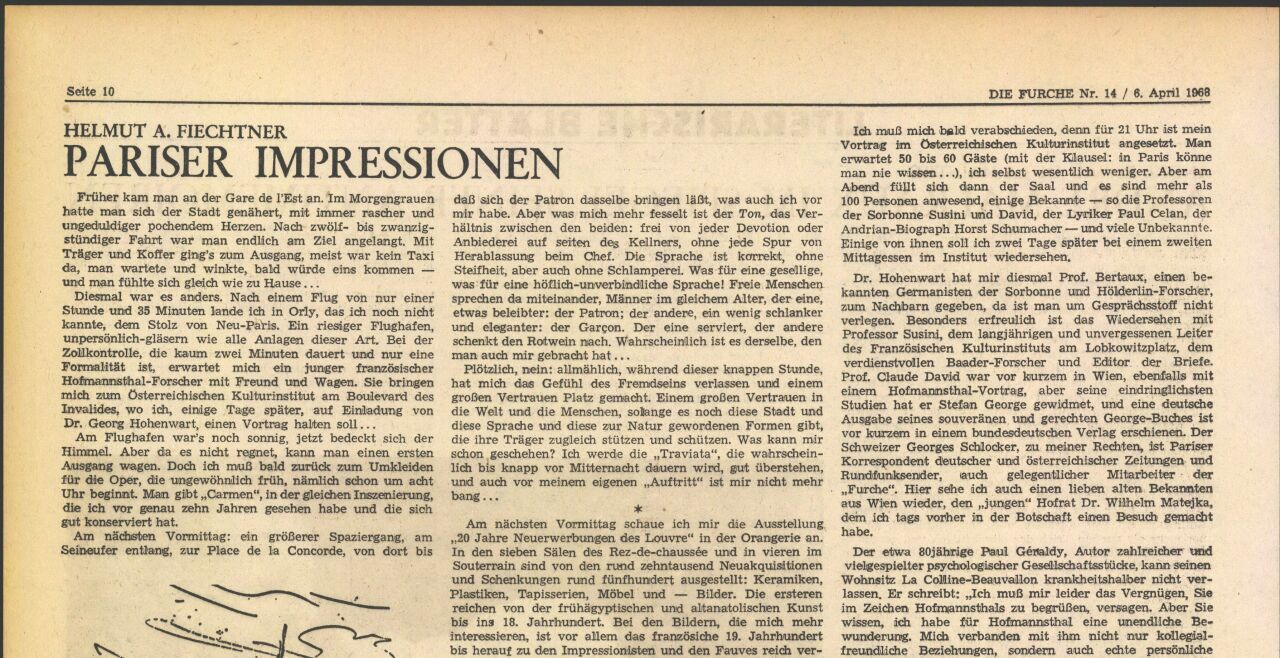
Früher kam man an der Gare de l’Est an. Im Morgengrauen hatte man sidi der Stadt genähert, mit immer rascher und ungeduldiger pochendem Herzen. Nach zwölf- btis zwanzig- stündiger Fahrt war man endlich am Ziel angelangt. Mit Träger und Koffer ging’s zum Ausgang, meist war kein Taxi da, man wartete und winkte, bald würde eins kommen — und man fühlte sich gleich wie zu Hause
Diesmal war es anders. Nach einem Flug von nur einer Stunde und 35 Minuten lande ich in Orly, das ich noch nicht kannte, dem Stolz von Neu-Pa’ris. Ein riesiger Flughafen, unpersönlich-gläsern wie alle Anlagen dieser Art. Bei der Zollkontrolle, die kaum zwei Minuten dauert und nur eine Formalität ist, erwartet mich ein junger französischer Hofmannsthal-Forscher mit Freund und Wagen. Sie bringen mich zum österreichischen Kulturinstitut am Boulevard des Invalides, wo ich, einige Tage später, auf Einladung von Dr. Georg Hohenwart, einen Vortrag halten soll
Am Flughafen war’s noch sonnig, jetzt bedeckt sich der Himmel. Aber da es nicht regnet, kann man einen ersten Ausgang wagen. Doch ich muß bald zurück zum Umkleiden für die Oper, die ungewöhnlich früh, nämlich schon um acht Uhr beginnt. Man gibt „Carmen“, in der gleichen Inszenierung, die ich vor genau zehn Jahren gesehen habe und die sich gut konserviert hat.
Am nächsten Vormittag: ein größerer Spaziergang, am Seineufer entlang, zur Place de la Concorde, von dort bis zur Madeleine und durch kleinere Straßen zurück. Aber es will sich keine rechte Wiedersehensfreude einstellen. Die Stadt scheint sich diesmal zu verschließen, sie kehrt dem Besucher den Rücken zu Man war zu lange nicht hier gewesen. Gewiß, das Wetter ist nicht gerade freundlich. Unter bleifarbenem Himmel bläst ein kalter Wind. Diese Unzeit — nicht mehr Winter und noch kein Hauch von Frühling — fördert die Melancholie. Aber das ist es nicht So beschließe ich, den Nachmittag über in meinem Zimmer zu bleiben und ein wenig in den vom Hausherrn bereitgelegten Journalen zu blättern. Das ist interessant und deprimierend zugleich. Das Niveau — sowohl des „Figaro Litteraire“1 wie der „Nouvelles Litteraires“ — ist unverändert geblieben. Der Abstand zu heimischen Erzeugnissen ähnlicher Art wirkt entmutigend. Diese wache Präsenz, diese ständige Teilnahme an der Produktion, die Wohlinformiertheit, die freie und persönliche Art des Urteils Man tat das Gefühl, aus einer entlegenen Provinz zu kommen. Auch auf diesem Weg scheint keine Annäherung möglich. Ich soll am übernächsten Tag über „Hofmannsthal und Frankreich“ sprechen. Wird das irgend jemand interessieren, wo die Franzosen, speziell die Pariser, so intensiv mit sich selbst beschäftigt sind und jederlei Neigung von ihren eigenen Autoren befriedigt werden kann?
Obwohl an diesem zweiten Tag die Oper (mein obligates Vergnügen) erst um neun Uhr beginnt, mache ich midi schon in der Abenddämmerung auf den Weg und trete auf einem der großen Boulevards, die zur Oper führen, in ein mittelgroßes Lokal. Im vorderen Teil: der gewohnte Betrieb an der Bar, wo die Laufkundschaft bedient wird. Im rückwärtigen Teil sieht es recht manierlich aus: viele kleine weißgedeckte Tischdien für je zwei Personen und angenehmes Licht. Hier ist es um diese Stunde noch fast leer. Nachdem ich meine Bestellung aufgegeben habe, richtet der Kellner mir gegenüber einen der kleinen Tische her, bringt die Rotweinflasche und den Korb mit dem Weißbrot und „geleitet“, man kann’s nicht anders sagen, den Patron herein. Dieser ist in „Zivil“ und etwa gleichalt wie der Oberkellner, zwischen Vierzig und Fünfundvierzig. Nachdem die Suppe aufgettfagen ist, lädt er den in blütenweißer Jacke mit korrekter schwarzer Binde Bedienenden zu sich an den Tisch ein. Und dann entspinnt sidi ein Gespräch zwischen den beiden, vielmehr: sie machen Konversation. Zunächßt ist von einer Hochzeit aus dem Quartier die Rede. Die Dame scheint Stammkundin im Lokal gewesen zu sein und wurde von einem älteren, offenbar reichen Herrn geheiratet, was mit einem kurzen, sehr maskulinen Kommentar versehen wird. Dann wendet sich das Gespräch, dessen unfreiwilliger, aber interessierter Zeuge ich bin, noch alltäglicheren Dingen zu. Zwischendurch wird vom Oberkellner weiterserviert, nachdem der umfangreiche Suppentopf geleert ist. Zu meiner Befriedigung stelle ich fest,
daß sich der Patron dasselbe bringen läßt, was auch ich vor mir habe. Aber was mich mehr fesselt ist der Ton, das Verhältnis zwischen den beiden: frei von jeder Devotion oder Anbiederei auf seiten des Kellners, ohne jede Spur von Herablassung beim Ohef. Die Sprache ist korrekt, ohne Steifheit, aber auch ohne Schlamperei. Was für eine gesellige, was für eine höflich-unverbindliche Sprache! Freie Menschen sprechen da miteinander, Männer im gleichem Alter, der eine, etwas beleibter: der Patron; der andere, ein wenig schlanker und eleganter: der Garęon. Der eine serviert, der andere schenkt den Rotwein nach. Wahrscheinlich ist es derselbe, den man auch mir gebracht hat
Plötzlich, nein: allmählich, während dieser knappen Stunde, hat mich das Gefühl des Fremdseins verlassen und einem großen Vertrauen Platz gemacht. Einem großen Vertrauen in die Welt und die Menschen, solange es noch diese Stadt und diese Sprache und diese zur Natur gewordenen Formen gibt, die ihre Träger zugleich stützen und schützen. Was kann mir schon geschehen? Ich werde die „Traviata“, die wahrscheinlich bis knapp vor Mitternacht dauern wird, gut überstehen, und auch vor meinem eigenen „Auftritt“ ist mir nicht mehr bang
Am nächsten Vormittag schaue ich mir die Ausstellung „20 Jahre Neuerwerbungen des Louvre“ in der Orangerie an. In den sieben Sälen des Rez-de-chaussėe und in vieren im Souterrain sind von den rund zehntausend Neuakquisitionen und Schenkungen rund fünfhundert ausgestellt: Keramiken, Plastiken, Tapisserien, Möbel und — Bilder. Die ersteren reichen von der frühägyptischen und altanatolischen Kunst bis ins 18. Jahrhundert. Bei den Bildern, die mich mehr interessieren, ist vor allem das französiche 19. Jahrhundert bis herauf zu den Impressionisten und den Fauves reich vertreten. Das Arrangement ist zunächst verwirrend: ganz unsystematisch, wtas die diversen Kunstepochen und was die einzelnen Gattungen betrifft, sondern einzig nach Gesichtspunkten der Harmonie und der Ästhetik. Im Ganzen: ein fast unvorstellbarer Reichtum, schon in dieser gedrängten Form. Besonders eindrucksvoll: ein Selbstporträt Chardins, zwei Lancrets, ein „Ecce homo“ von Tiepolo, die vier Jahreszeiten des Manieristen Arcimboldo, ein düsterer Gėrioault (Le Dėluge), zwei mächtige Delacroix, das Porträt des Titus von Rembrandt und ein herrlicher flandrischer Wandteppich (Der Tod des Elephanten). Hier mag der Kenner tagelang schwelgen. Den Liebhaber zieht es zu den Impressionisten, deren Heimstatt ja die Orangerie und das „Jeu de p&umes“ ist. Und hier gehen einem tatsächlich die Augen über. Vor allem aus Schenkungen sind an die hundert unbekannte Meisterwerke nicht nur in den Besitz des Louvre, sondern überhaupt ersit ans Licht gekommen, Bilder, die sieh mit den besten und berühmtesten der betreffenden Maler messen können: herrliche Meisterwerke also von Monet, Manet, Degas, Cėzanne, Gauguin, van Gogh, Signac, Seurat, Toulouse-Lautrec und dem Zöllner Rousseau, die „Grande laveuse“ von Renoir nicht zu vergessen und die berühmte „Arlesienne“ von Van Gogh, ein Geschenk von M-me. Gold- schmidt-Rothsdiild, die am Tag der Befreiung von Paris an die Direktion des Louvre aus Amerika schrieb: „Ich schenke, was mir das Kostbarste bedeutet, der Stadt, die mir die teuerste ist.“ Damals erhielt der Louvre besonders viele Schenkungen dieser Art, von Sammlern, wie es sie wohl nur in Paris gibt.
Am Montag gibt Graf Hohenwart ein Mittagessen, um dem Gast Gelegenheit zu bieten, einige Freunde und Kollegen wiederzusehen und andere kennenzulemen. Ich habe zu meiner Rechten den seit vielen Jahren in Paris ansässigen russischen Komponisten Alexander Tscherepnin, dem wieder zu begegnen mir besondere Freude bereitet. Er hat Hofmannsthals „Hochzeit der Sobeide“ vertont, die zu Beginn der dreißiger Jahre in der Volksoper uraufgeführt wurde und deren sich seither niemand mehr angenommen hat Zur Linken: Marcel Brion von der Acadėmie Franęaise, ein eminenter Kenner der deutschen Romantik, der literarischen wie der musikalischen. Es ist für mich bedeutungsvoll und rührend zugleich, von ihm zu hören: „Die Lektüre der Verse des jungen Hofmannsthal und die Begegnung mit ihm haben mein Leben verändert. loh war darnach ein anderer als ich vorher gewesen war!“ Mir gegenüber: mein Freund und Kollege Claude Rostand, der die erste große Brahms- Monographie in französischer Sprache geschrieben hat (die, wie sidi im Gespräch herausstellt, Marcel Brion genauestens kennt und sehr schätzt), der vor kurzem ein kleines, überaus einfühlsames Hugo-Wolf-Büchlein veröffentlicht hat und der gegenwärtig an einer Webem-Studie arbeitet. Auch der junge Germanist Francis Claudon ist unter den Gästen, der gegenwärtig seine Agrėgation vorbereitet, darnach für zwei Jahre an eine französisch-kanadische Universität gehen will, um nachher seine Hofmannsthal-Studien fortzusetzen und sich der akademischen Laufbahn zuzuwenden. Von österreichischer Seite sind an der Tafel: Presserat Dr. Zidek von der Botschaft, Prof. Pochmarski, Lektor an der Sorbonne, Dr. Lewandowski, der langjährige Korrespondent der „Furche“ in Paris, zwei Mitglieder des österreichischen Instituts und, natürlich, der Hausherr. Auch der vielbeschäftigte Präsident des französischen PEN-Clubs, Yves Gandon, ist erschienen, was ich als eine besondere Aufmerksamkeit empfinde.
Er lädt für den nächsten Nachmittag zu einem Empfang in seine Wohnung auf dem Montmartre ein, wo etwa 20 Personen versammelt sind, größtenteils, aber nicht ausschließlich, Literaten, unter ihnen auch je zwei aus Rumänien und Jugoslawien. Der große Salon ist mit kostbaren Kunst- gegenständen geschmückt, die der Hausherr auf seinen zahlreichen Weltreisen gesammelt hat. Gandon ist der Autor von etwa 40 Büchern, der typische „homme de lettres“ und ein Freund Österreichs. Im größten Sessel hat Jules Romains Platz genommen, der sich gern an seinen letzten Besuch in Wien erinnert. Er hält ein wenig Cercle und erzählt von seinem toten Freund Stefan Zweig. — Daß hier andere Zeitgesetze regieren, bemerke ich, als midi eine alte russische Dame, die noch Diaghilews Anfänge in Paris miterlebt hat, einlädt, sie am nächsten Abend zu besuchen, um weiterzuplaudern. Als ich midi entschuldige, weil ich bereits Karten für die Oper (mein obligates Vergnügen; in den Theatern gäbe es so viel Neues und Interessantes zu sehen!) besorgt habe, sagt sie: „Aber kommen Sie doch nach der Oper! Die Vorstellung ist bestimmt vor Mitternacht zu Ende!“
Ich muß mich bald verabschieden, denn für 21 Uhr ist mein Vortrag im österreichischen Kulturinstitut angesetzt. Man erwartet 50 bis 60 Gäste (mit der Klausel: in Paris könne man nie wissen ), ich selbst wesentlich weniger. Aber am Abend füllt sich dann der Saal und es sind mehr als 100 Personen anwesend, einige Bekannte ~r- so die Professoren der Sorbonne Susini und David, der Lyriker Paul Celan, der Andrian-Biograph Horst Schumacher — und viele Unbekannte. Einige von ihnen soll ich zwei Tage später bei einem zweiten Mittagessen im Institut Wiedersehen.
Dr. Hohenwart hat mir diesmal Prof. Bertajux, einen bekannten Germanisten der Sorbonne und Hölderlin-Forscher, zum Nachbarn gegeben, da ist man um Gesprächsstoff nicht verlegen. Besonders erfreulich ist das Wiedersehen mit Professor Susini, dem langjährigen und unvergessenen Leiter des Französischen Kulturinstituts am Lobkowitzplatz, dem verdienstvollen Baader-Forscher und Editor der Briefe. Prof. Claude David war vor kurzem in Wien, ebenfalls mit einem Hofmannsthal-Vortrag, aber seine eindringlichsten Studien hat er Stefan George gewidmet, und eine deutsche Ausgabe seines souveränen und gerechten George-Budies ist vor kurzem in einem bundesdeutschen Verlag erschienen. Der Schweizer Georges Schiocker, ziu meiner Rechten, ist Pariser Korrespondent deutscher und österreichischer Zeitungen und Rundfunksender, auch gelegentlicher Mitarbeiter der „Furche“. Hier seihe ich auch einen lieben alten Bekannten aus Wien wieder, den „jungen“ Hofrat Dr. Wilhelm Matejka, dem ich tags vorher in der Botschaft einen Besuch gemacht habe.
Der etwa 80jährige Paul Gėflaldy, Autor zahlreicher und vielgespielter psychologischer Gesöllsehaftssbücke, kann seinen Wohnsitz La Colline-Beauvallon krankheitshalber nicht verlassen. Er schreibt: „Ich muß mir leider das Vergnügen, Sie im Zeichen Hofmannsthals zu begrüßen, versagen. Aber Sie wissen, ich habe für Hofmannsthal eine unendliche Bewunderung. Mich verbanden mit ihm nicht nur kollegial- freundliche Beziehungen, sondern auch echte persönliche Freundschaft. Das war ein Mann nach meinem Herzen, wie Nietzsche von Wagner gesagt hat “ Unmittelbar hach Beendung des Dejeuners ruft Marcel Dunan an. Er war vor dem ersten Weltkrieg Kulturattachėe an der französischen Botschaft in Wien, hat zahlreiche historische Werke henausgegeben und geschrieben, ist Memibre de l’Institut und Präsident des „Institut Napolėon“. Er erkundigt sich nach dem-Wohlergehen von Jean de Boungoing, hat von den Feiern zu dessen 80. Geburtstag gehört und bittet, diesem die herzlichsten Grüße zu bestellen — die ich auf diesem Wege übermittle.
Im österreichSschen’Institut herrscHli-reger •Beft’ičb. Es gibt mehrere gutbesuchte Sprachkurse, eine wohlassortierte Österreichbibliothek und mehr als 20 Stipendiaten zu betreuen (zur Hälfte Österreicher, zur Hälfte Franzosen), die im rückwärtigen Trakt des Instituts in freundlich-modernen Einzelzimmern untergebracht sind. Hier ist das Hauptbetätigungsfeld von Prof. Karl Kogler, der nach etwa fünfjähriger Tätigkeit am Institut nach Wien ins Unterrichtsministerium zurückkehrt (miit französischer Frau und zwei Buben),
und an dessen Stelle soeben der junge Artur Schuschnigg, ein Neffe des ehemaligen Bundeskanzlers, einrückte. Dr. Hohenwart ist von morgens bis abends vollbeschäftigt. Samstag-, Sonntagruhe gibt es kaum, für den übernächsten Tag wird der Besuch des Unterrichtsministers erwartet, und eine Veranstaltung folgt rasch auf die andere. Als nächster spricht Gabriel Marcel über Ferdinand Ebner
Am letzten Abend möchte Ich eine Aufführung von Claudels „Tėte d’Or“ im Theater von Louis Barrault sehen. Aber es gibt keine einzige Karte mehr, und so improvisieren zwei junge französische Freunde einen Abschiedslabend nicht weit vom „Odeon“ in einem ganz reizenden, erst seit kurzer Zeit in Mode gekommenen kleinen Lokal mit dem Namen „Baroque“ — was ich als eine ganz stilvolle .Vorbereitung zur Heimreise am nächsten Tag empfinde