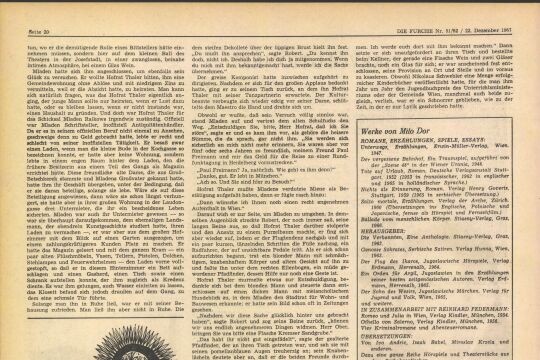„Mit dem ,Tod in Venedig” ist es eine ganz komische Geschichte, insofern als sämtliche Einzelheiten der Erzählung passiert und erlebt sind”, teilt Ka- tia Mann ohne viele Umschweife in ihren „Ungeschriebenen Memoiren” mit. Gott segne sie - endlich einmal eine ehrliche Zeugin, die sich nicht spreizt und nicht ziert, die nicht für jeden Beistrich im Werk eines Dichters, dem sie über die Schulter hat schauen können, das Walten einer höheren Vorsehung in Anspruch nimmt, die über das Phänomen des literarischen Rohstoffs nicht anders spricht als über eine gute Mahlzeit oder über Erziehungsprobleme im Flegelalter. Da wimmelt’s nur so von Modellen - ich kann sie mir nachgerade aussuchen. Es ist klar, daß meine Wahl auf das berühmteste unter ihnen fällt: Tadzio, den „kleinen Phäaken”, den „lieblichen Psychagogen”, dem der Schriftsteller Gustav von Aschenbach „Andacht und Studium” widmet, dessen vollkommene Schönheit - „schöner, als es sich sagen läßt” - den alternden Künstler so sehr erschüttert und unter dessen Lächeln, „voranschwebend ins Verheißungsvoll-Ungeheure”, er schließlich seinen letzten Atemzug tut.
Frühjahr 1911. Das Ehepaar Mann - er 36, sie 28 - reist zur Erholung nach Istrien, man hat ihnen Brioni empfohlen. Aber sie bleiben nur kurz, es gefällt ihnen nicht besonders. Erstens fehlt der Sandstrand, zweitens verdrießen sie die Allüren der am selben Ort zur Kur weilenden Erzherzogin Maria Josepha, Mutter des späteren letzten österreichischen Kaisers, bei deren Auftritt und Abgang im Speisesaal des Hotels sich regelmäßig die gesamte Gästeschaft devot von den Sitzen erhebt.
So fahrt man mit dem Dampfschiff weiter nach Venedig. Am Lido, im Hotel des Bains, sind Zimmer bestellt. „Und gleich bei Tisch, gleich den ersten Tag, sahen wir diese polnische Familie, die genau so aussah, wie mein Mann sie geschildert hat: mit den etwas steif und streng gekleideten Mädchen und dem sehr reizenden, büd- hübschen, etwa dreizehnjährigen Knaben, der mit einem Matrosenanzug, einem offenen Kragen und einer netten Masche gekleidet war und meinem Mann sehr in die Augen stach. Er hatte sofort ein Faible für diesen Jungen, er gefiel ihm über die Maßen, und er hat ihn auch immer am Strand mit seinen Kameraden beobachtet. Er ist ihm nicht durch ganz Venedig nachgestiegen, das nicht, aber der Junge hat ihn fasziniert, und er dachte öfters an ihn.”
Frühjahr 1977 - Sechsundsechzig Jahre später. Thomas Manns Novelle ist fünfundsechzig Jahre alt, Viscontis Verfilmung hat das Werk, obgleich keinen Augenblick vergessen, erneut weltweit ins Gespräch gebracht und den tausenderlei Phantasiebüdern vom Knaben Tadzio in der Gestalt des Schweden Björn Andresen ein sehr dezidiertes weiteres hinzugefügt. Wird es sich als starker erweisen als die eigene Vorstellung? Wird, wer von nun an den „Tod in Venedig” liest, immer den blondlockigen Skandinavier vor Augen haben?
Ich nicht. Ich werde an einen alten Herrn in einer Dachwohnung in Krakau denken, der sich behutsam seiner Krücken entledigt, sich vorsichtig in seinem schleißigen Fauteuil zurücklehnt und mir in einem amüsanten Sprachgemisch aus Deutsch und Englisch und Französisch von jenem venezianischen Kuraufenthalt 1911 berichtet, bei dem er, ein Kind von elf Jahren, ohne jedes Wissen für ein Stück Weltliteratur Modell stand …
1923, auf einem Ball in gräflichem Warschauer Hause, erfuhr er es zum erstenmal: „Der Tod in Venedig” war gerade in polnischer Übersetzung herausgekommen, Gabriella Czes- nowska, seine Tanzpartnerin, hatte das Buch als eine der ersten gelesen. „Du weißt wohl gar nicht, was für ein Held du bist?” hänselte sie den jungen Baron, und als Wladyslaw von Moes daraufhin Nachschau hielt und selber den strittigen Text prüfte, gab es auch für ihn nicht den geringsten Zweifel: Wahrhaftig-dieserTadzio, das binich.
Zeit und Ort, Personnage und Geschehensablauf- in allem herrschte die vollkommenste Übereinstimmung. Die drei Geschwister, „bis zum Entstellenden herb und keusch hergerichtet” - ganz klar: das waren seine Schwestern Jadwiga, Alexandra und Maria Anna; die „große Frau, grauweiß gekleidet und sehr reich mit Perlen geschmückt, kühl und gemessen, die Anordnung ihres leicht gepuderten Haares sowohl wie die Machart ihres Kleides von jener Einfachheit, die überall da den Geschmack bestimmt, wo Frömmigkeit als Bestandteil der Vornehmheit gilt”, mit „zurückhaltendem Lächeln” den Kindern die Hand zum Kusse reichend: das war das perfekte Spiegelbild seiner Mutter; die Gouvernante, „eine kleine und korpulente Halbdame mit rotem Gesicht”, die das strenge Aufmarschzeremoniell mit knappen Kommandos dirigierte: das war das Fräulein Lina Perisich aus Cilli; und „Jaschu”, der derbe Spielkamerad am Strand, der stämmige Bursche mit dem leinenen Gürtelanzug und dem pomadisierten Haar: das war Janek Fudakowsky, mit dessen Familie die Moes ihre Tage am Lido teilten, bis sie der plötzliche Ausbruch einer leichten Choleraepidemie zu überstürzter Abreise zwang.
Wladyslaw von Moes, eben aus dem polnisch-russischen Krieg heimgekehrt, wo er als Ulane seinen Mann gestellt hat, kann nicht den ihm vorgezeichneten Plan verwirklichen, in Grenoble Papiertechnik zu studieren. Eine schwere Erkrankung des Vaters zwingt ihn, ohne Verzug in den elterlichen Betrieb einzutreten, der ihm als Erbe zugedacht ist: die Papierfabrik in Pilica. Von seiner Entdeckung, in die Literatur eingegangen zu sein, macht er weiter kein Aufhebens - es gibt Wichtigeres. Natürlich schmeichelt es ihm, natürlich amüsiert es ihn - er ist auch mit 23 eine attraktive Erscheinung, von Frauen und Mädchen umschwärmt. Doch auf den Gedanken, sich dem Dichter zu erkennen zu geben, käme er nicht. Auch als Thomas Mann im März 1927 auf Einladung des polnischen PEN-Clubs in Warschau weilt und, mit Ehrungen überhäuft und von einem Empfang zum anderen eilend, Schlagzeilen macht, hält sich „Tadzio” diskret im Hintergrund. Frühstück beim Prinzen Radziwill, Empfang beim Grafen Branicki in Schloß Wüanow, Warschaus Adel drängt sich um den Dichter aus Deutschland - es wäre für den jungen Herrn aus bestem Hause ein Leichtes, seine Bekanntschaft zu machen. Doch erst 1964, als alter Herr, neun Jahre nach Thomas Manns Tod, findet er den Mut, das Geheimnis zu lüften: in einem Brief an Witwe Katia, für die die späte Decouvrierung ein „drolliges Nachspiel” ist.
Anna Lewandowska, die mir von der staatlichen Agentur Interpress als Organisatorin, Betreuerin und Dolmetscherin zugeteilt ist, unterzieht sich mit bewundernswerter Selbstverleugnung der Aufgabe, mir bei der Ausforschung des „Tadzio”-Modells zur Hand zu gehen: Sie ist es gewohnt, westliche Journalisten mit Minister- Interviews zu versorgen, an Gedenkstätten zu lotsen, Betriebsbesichtigungen zu arrangieren - mich mit einem Vertreter des verarmten Adels, einem ehemaligen Fabrikanten und Gutsbesitzer, einem Klassenfeind also, zusammenzubringen, kann unmöglich nach ihrem Geschmack sein. Aber sie läßt sich nichts davon anmerken. Auch später, wenn ich dem alten Hertn gegenübersitze, wird sie sich nobler Zurückhaltung befleißigen, wird nie korrigierend in unser Gespräch eingrei- fen: kein Ordnungsruf, kein Einschüchterungsversuch; auch dem abgehalfterten „kapitalistischen Ausbeuter” gegenüber wird sie es nicht einen Augenblick an Respekt fehlen lassen - seine gewinnende, bescheidene Art, selbst in der Aufzählung all der armseligen Stationen seiner Nachkriegsexistenz frei von Groll und Bitterkeit, macht es ihr freilich auch leicht
Unser Wagen hält vor einem älteren Mietshaus in der Ulica Smolensk, gleichweit vom Weichselknie wie vom Krakauer Altstadtkern entfernt. Nebenan das Sportstadion, yis-ä-vis das neue Großhotel Cracovia. Wir fahren mit dem Aufzug in den letzten Stock, die Lifttür ist zugleich das Entree zur Wohnung. Der Neffe läßt uns ein - er hat den „Herrn Onkel”, zu dessen Anrede er sich beharrlich des ehrerbietigen „Sie” bedient, zu sich genommen, seit dessen Frau, eine geborene Gräfin Miaczynskia, schwerkrank darniederliegt und in ihrem Haus in der Warschauer Vorortsgemeinde Komorow nicht einmal mit sich selbst mehr zurechtkommt. Der Neffe betreibt eine kleine Krawattenmanufaktur in der Stadt - dazu ein paar Schafe auf einem winzigen Wiesengrundstück an der Peripherie, das er vor kurzem erworben hat.
Wir werden in die Wohnstube gebeten: ein nicht zu großes Balkonzimmer mit einigen wenigen Antiquitäten, in der Mitte des Raumes der Lehnstuhl für „Tadzio”. Sein Auftritt läßt allerdings noch auf sich warten: Wladyslaw Moes, so alt wie unser Jahrhundert, ist seit seinem Hüftbruch gehbehindert, jeder falsche Schritt bereitet Schmerzen, für das Anlegen der Krücken braucht er fremde Hilfe. Er muß erst die richtige Position in seinem Fau- teuü eingenommen haben - früher ist an Begrüßung nicht zu denken. Ein ei genes Lächeln umspielt dabei seinen Mund: bei allem Stolz immer dieses gewisse Erstaunen, wie man mit solch flüchtigem Gastspiel in der Literatur so nachdrückliches Interesse erwek- ken kann. Sogar Selbstironie wird laut: Wenn er an all die Post denke, die er in den vergangenen Jahren im Zeichen Thomas Manns erhalten habe (und sei es mitunter auch nur, um einem Schreiber aus der Bundesrepublik bei der Ausfindigmachung eines Kriegsgefallenengrabes behilflich zu sein), komme er sich bisweilen direkt wie eine „fameuse artiste” vor, Sängerinnen und berühmten Schauspielerinnen gehe es wohl ebenso, und vielleicht erwarteten sich auch seine Fans eine Autogrammpostkarte von ihm, dabei wüßte er doch gar nicht, wie er sie rechtens zu unterschreiben hätte: „Tadzio”, wie ihn, auf Grund eines Hörfehlers, der Dichter genannt habe, oder „Adzo”, wie er tatsächlich als Kind gerufen würden sei. Als ich ihn später selber um Signierung meines „Tod in Venedig”-Exemplars ersuche, entscheidet er sich ohne Zögern für die korrekte Version und kritzelt mit leicht zittriger Hand „Adzo Moes” aufs Titelblatt.
Die Frau des Hauses schleppt während unserer Unterhaltung zierliche Jour-Tischchen ins Zimmer und breitet unauffällig Sandwiches darauf aus, dazu gibt es Wodka. Einer der Söhne photographiert den alten Onkel - im Keller hat er sich ein Labor eingerichtet, wo er den Film selber entwickeln kann. Der andere, den sie seit seiner großen Uberseereise den „Amerikaner” nennen, hängt auf dem Balkon die Jeans zum Trocknen auf, er hält sich von unserer Runde fern. Die Tochter steht am Herd und bereitet das Mittagessen vor - wir werden dazu in überschwenglicher Gastfreundschaft mit eingeladen: in der Sitzecke der Küche. Wir dürften uns allerdings nicht daran stoßen, daß es ein einfaches Mahl sei, baut der Onkel vor, Langusten kämen keine auf den Tisch - so wie etwa damals am Lido, im Frühjahr 1911. Dabei habe er als Kind alle diese Meeresdelikatessen gar nicht gemocht, vor Fischen habe ihn geradezu geekelt: der großen Augen wegen, die ihn bei derlei Mahlzeiten vom Teller angeblickt hätten - übersensibel, wie er damals gewesen sei. Ja, die bewußte Venedig-Reise sei ja eigentlich überhaupt nur zustandegekommen, weil sie ihm vom Nervenarzt, den man in Wien konsultiert habe, verordnet worden sei: „Frau Baronin, ich rate Ihnen, reisen Sie mit dem Kind für drei Monate nach Venedig, und sorgen Sie dafür, daß er recht viel mit dem Vaporetto fahrt - das wird seine Nerven wieder in Ordnung bringen.”
In Wien, wo man im vornehmen Hotel Krantz an der Kärntnerstraße abgestiegen war, wurde also rasch das Passende an Kleidung besorgt: das „englische Matrosenkostüm, dessen bauschige Ärmel sich nach unten verengerten” und „mit seinen Schnüren, Maschen und Stickereien der zarten Gestalt etwas Reiches und Verwöhntes” verlieh, der „leichte Blusenanzug aus blau und weiß gestreiftem Waschstoff mit rotseidener Masche und Stehkragen, die „dunkelblaue See- mannsüberjacke mit den goldenen Knöpfen”, der blauweiße Badeanzug. Kurz darauf traf man am Lido mit dem Rest der Famüie zusammen: Vater und Geschwistern. Von diesen allen ist Wladyslaw-Tadzio der einzige, der heute noch lebt. Ich sehe Photos von der Mutter: eine überragende Erscheinung, ganz in Spitze, darüber die Zobelboa und die „dreifache Kette kirschengroßer, mild schimmernder Perlen”, Photos von den drei Schwestern, schließlich Photos von ihm selbst. Der zarte Wuchs ist ihm bis ins hohe Alter geblieben, desgleichen der edle Kopf, die vornehme Haltung, die Eleganz der Bewegungen - dem Greis gegenüberzusitzen und sich den Knaben vorzustellen, bereitet keine Schwierigkeiten: Da ist noch immer sehr viel Ähnlichkeit, noch immer sehr viel Kontinuum. Beim Kaffee erfahre ich die weiteren Stationen dieses Lebens.
Als Visconti seinerzeit auf der Suche nach einem Tadzio-Darsteller auch nach Polen kam (und unverrichteter Dinge wieder abreiste), wurde er gefragt, wieso er es denn bei dieser Gelegenheit verabsäumt habe, dem in Reichweite befindlichen Urbüd zu begegnen. Er gab zur Antwort: „Weil ich von dieser Figur eine eigene Vision habe - die will ich mir nicht durch die Realität zerstören.” Und Moes selbst: „Ich hätte mich nicht anders verhalten. Visconti hatte recht.”
Es wird Zeit, Abschied zu nehmen: Der alte Herr ist seinen Mittagsschlaf gewöhnt. Das aufrechte Sitzen, stundenlang, bereifet ihm Pein-jetzt, seitdem er invalid ist. Aber er würde sich’s nie anmerken la’ssen. Und er ist ja auch, von diesem einen Malheur abgesehen, ein in keiner Weise angeschlagen wirkender Mann. In diesem Punkt hat der Dichter gründlich geirrt: „Er ist sehr zart, er ist kränklich. Er wird wahrscheinlich nicht alt werden.” Tadzio ist 77.
Zurück nach Warschau. Im Hotel Europejski, wo man mich in der Nobelsuite des zweiten Stocks einquartiert hat, schließt sich der Kreis: Hier hat Thomas Mann - damals im März 1927 - seinen polnischen Gastgebern, die sich in „herzlicher Aufmerksamkeit” nicht hatten genugtun können, mit einem Vortrag seinen Dank abgestattet. Der große Saal des „Europejski” war überfüllt, der Titel seines Referats könnte der Titel meiner Tad- zio-Story sein: „Freiheit und Vornehmheit.” Denn ist das nicht genau die Formel, die auch das Wesen dieses bemerkenswerten Mannes ausdrückt - weit zutreffender als der alte Wappenspruch der Moes? „Ūbi venio ibi vinco”: was für ein Unsinn-heute. Ich lese die anachronistische Devise im Stammbuch der Moes, das „Tadzios” Bruder Alexander in Verwahrung hält. Denn auch ihm mache ich meine Aufwartung - draußen in seiner Datscha in Milanowek, tief in den Wäldern von Warschau.
Wieder dieser kuriose Hang zum Zeremoniell, auch hier dieses überzeugte Festhalten an den alten Umgangsformen - über alle Zeitenwende hinweg: der Sohn, der dem alten Vater die Hand küßt, die französische Floskel als Aufputz der Konversation, allgemeines Sich-erheben, wenn einer bei Tisch die Sprache auf den Zarenhof bringt. Thomas Mann und den „Tod in Venedig” auf die Tagesordnung zu setzen, bereitet dagegen Mühe. Verständlich: Alexander war nicht mit von der Partie - damals, im Frühjahr 1911. Er hatte schlechte Noten aus der Schule heimgebracht - zur Strafe durfte er nicht mit an den Lido fahren. „Tadzios” exklusiver Rang war damit gesichert: das „verzärtelte Vorzugskind, von parteilicher und launischer Liebe getragen”. Daß ich auf alle meine Fragen nach ihm so karge Auskunft erhalte, daß man mich hier, wie ich bald merke, sehr viel lieber über „Magdeburger Morgen” und Getreidesorten instruierte, über die ehemals bewirtschafteten Ländereien, über Schloßpersonal und Viehbestand - sollte das Reste von geschwisterlicher Eifersucht verraten, Geringschätzung des „Tadzio”-Kults?
Wie auch immer: Alexanders schlechtes Schulzeugnis und Wladys- laws nervenärztliches Attest hatten ihr Gutes - literaturgeschichtlich gesehen. Sie haben einem Dichter die ideale Modellkonstellation beschert - so wie der Dichter seinerseits von dieser Konstellation idealen Gebrauch gemacht hat. Aber das alles wissen wir ja längst. Was wir nicht gewußt, was ich erst auf dieser Reise erfahren habe, ist dies: wie sehr dieses Modell - auch über die Novelle hinaus - sich treu geblieben ist, ein Leben lang. Thomas Mann brauchte seinem „Tadzio” auch heute nichts von seiner Zuneigung zu entziehen.